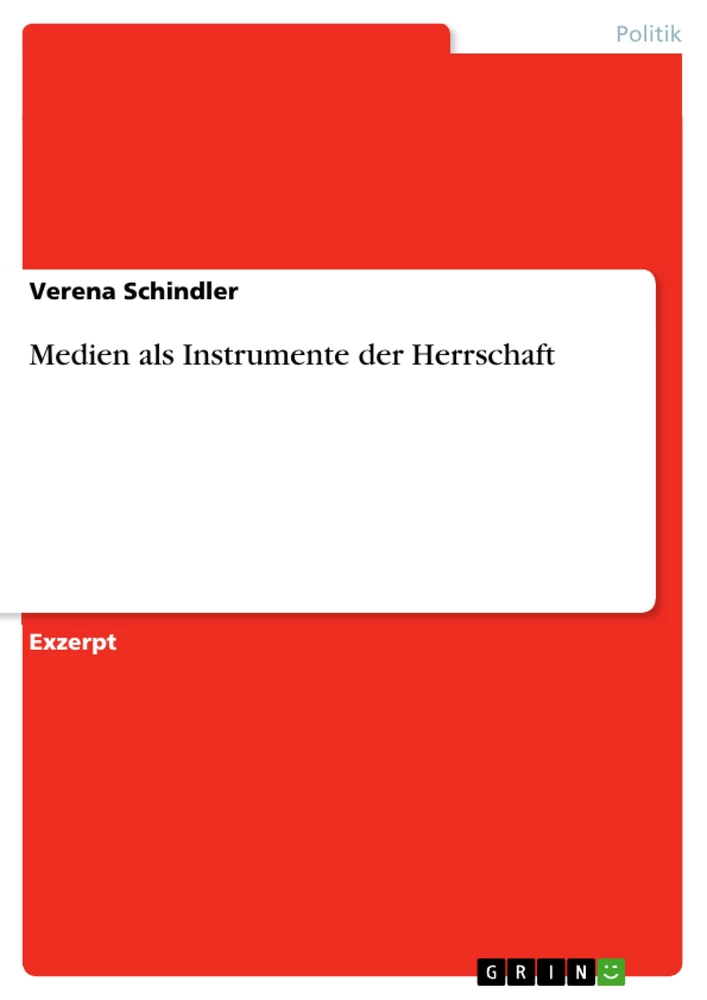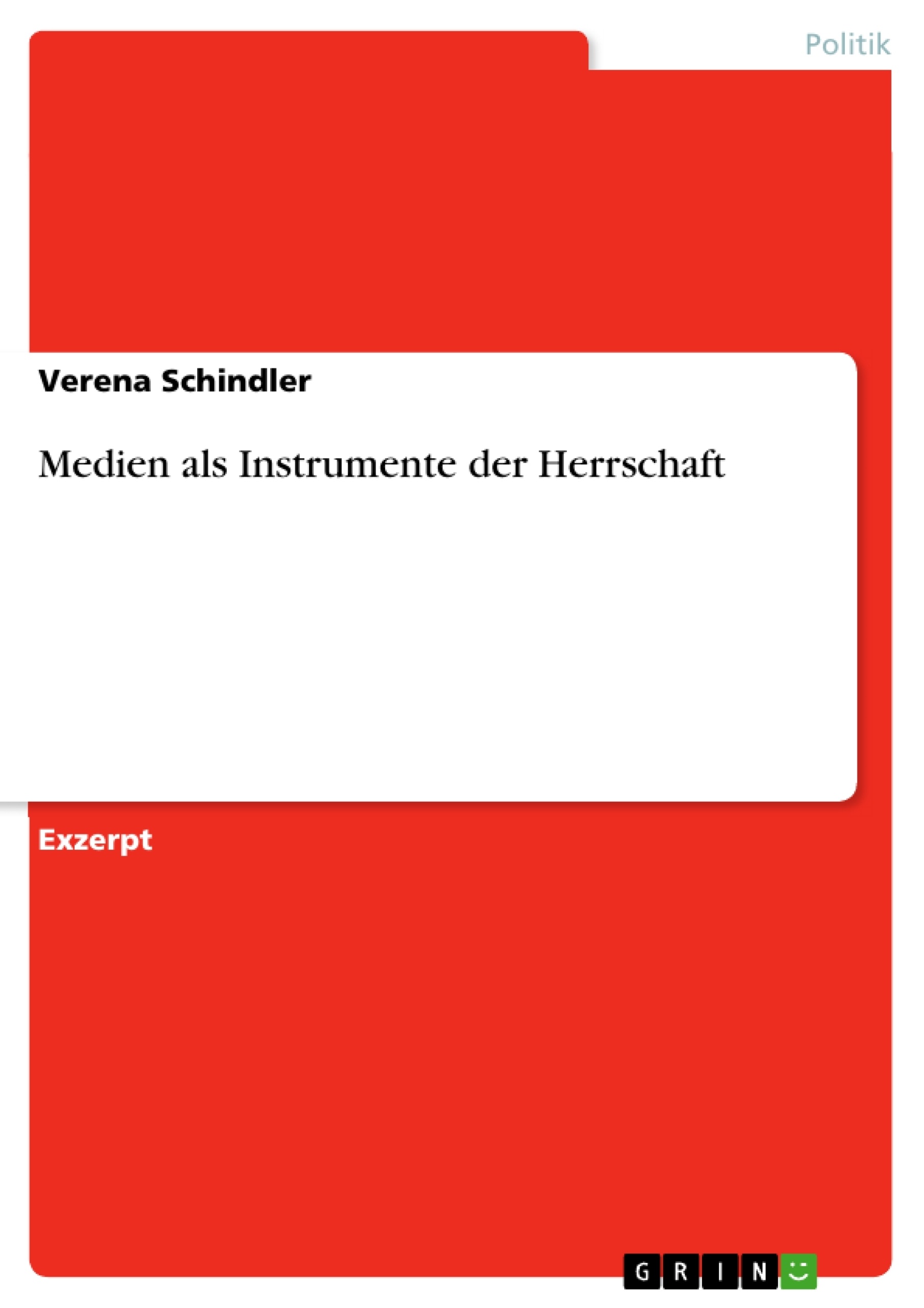„Medien als Instrumente der Herrschaft“ – Dem Titel des Seminars aber auch der Aussage an sich kann durchaus zugestimmt werden, wenn man die aktuelle Medienlandschaft in Deutschland betrachtet. Zum einen wird den Medien als vierte Gewalt vorgeworfen, dass sie nicht kritisch genug gegenüber den herrschenden Machtstrukturen sind. Zum anderen werden Medien immer mehr zum Sprachrohr ökonomischer Eliten, was unter anderem in der Medienkonzentration deutlich wird. Wenige große Verlage beherrschen den Medienmarkt in Deutschland und können somit als Kapitalunternehmen bezeichnet werden. Aber auch Nachrichteninhalte werden systematisch ausgewählt, je nachdem was Machteliten gerade beschäftigt und was sie lesen wollen.
Wird dadurch der ursprüngliche Gedanke der Medien, eine objektive Willensbildung der Bürger zu fördern, überhaupt noch verwirklicht?
Die folgenden Lektürereflexionen werden sich zum einen mit dieser Frage, aber auch mit Themen wie öffentlicher Kommunikation, Medien und deren Verhältnis zur Politik und Gesellschaft oder Medienkontrolle auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lektürereflexionen
- Immanuel Kant: Was ist Aufldärung?
- Jeremy Bentham: An Essay on Political Tactics
- Karl Marx: Debatten über die Preßfreiheit
- Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit
- Noam Chomsky: Media Control- Wie die Medien uns manipulieren
- Jürgen Habermas: Drei normative Modelle der Demokratie
- Nancy Fraser: Transnationalizing the Public Sphere
- Peter Dahlgren: The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation
- Niels Ole Finnemann: Mediatization theory and digital media
- Grant Blank: Who creates content?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Medien als Instrumente der Herrschaft verwendet werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von verschiedenen Texten, die sich mit dem Verhältnis von Medien und Politik auseinandersetzen. Dabei werden sowohl klassische Texte der politischen Philosophie als auch aktuelle Beiträge zur Mediatisierung und Digitalisierung der Gesellschaft betrachtet.
- Öffentliche Kommunikation und Medien
- Medien und Politik
- Medien und Gesellschaft
- Medienkontrolle
- Digitale Medien und ihre Auswirkungen auf die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird Immanuel Kants Text „Was ist Aufklärung?" analysiert. Kant argumentiert, dass Menschen unmündig sind, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren Verstand ohne fremde Hilfe zu nutzen. Er kritisiert die Bequemlichkeit und Angst der Menschen, ihren Verstand einzusetzen und fordert die Freiheit des öffentlichen Gebrauchs der Vernunft.
Jeremy Benthams Essay „On Political Tactics" wird im zweiten Kapitel beleuchtet. Bentham plädiert für Transparenz und Öffentlichkeit staatlichen Handelns und betont die Bedeutung der Öffentlichkeit für die Kontrolle von Machthabern. Er sieht die Öffentlichkeit als unverzichtbar für die Förderung der Willensbildung im Staat.
Das dritte Kapitel widmet sich Karl Marx' Text „Debatten über die Preßfreiheit". Marx setzt sich vehement für die Pressefreiheit und gegen die Zensur ein. Er kritisiert Politiker, die die Zensur als weniger schlimm ansehen als den Unsinn, der von der Presse verbreitet wird, und betrachtet die Pressefreiheit als eine unverzichtbare Freiheit des Menschen.
Walter Benjamins Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" wird im vierten Kapitel betrachtet. Benjamin argumentiert, dass durch die technischen Reproduktionen von Kunstwerken, wie z.B. in der Fotografie und im Film, die Aura des Kunstwerks verloren geht. Er sieht in der technischen Reproduzierbarkeit eine Gefahr für die Gesellschaft, da sie zu Manipulation und Verfälschung von Informationen führen kann.
Im fünften Kapitel wird Noam Chomskys Text „Media Control: Wie die Medien uns manipulieren" behandelt. Chomsky kritisiert die Medien in den USA scharf und sieht sie als manipulierend und sogar „böswillig" an. Am Beispiel des Vietnamkrieges zeigt er auf, wie die Medien durch unsachliche Berichterstattung die Öffentlichkeit beeinflussen und den Kriegsverlauf beeinflussen können.
Das sechste Kapitel analysiert Jürgen Habermas' Text „Drei normative Modelle der Demokratie". Habermas stellt ein neues Modell der deliberativen Demokratie vor, in dem die Bürger aktiv an der öffentlichen Kommunikation und den Diskursen über politische Entscheidungen beteiligt sind. Er kritisiert das liberale und republikanische Verständnis von Politik und plädiert für eine stärkere Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung.
Im siebten Kapitel wird Nancy Frasers Text „Transnationalizing the Public Sphere" beleuchtet. Fraser argumentiert, dass die Öffentlichkeit durch die Globalisierung transnationalisiert wird und die klassischen Theorien der Öffentlichkeit, die sich auf den Nationalstaat beziehen, überdacht werden müssen. Sie fordert eine Institutionalisierung einer globalen Bürgerschaft, die die Grenzen von Nationalität, Sprache und Religion überwindet, um eine weltweite und offene Kommunikation zu ermöglichen.
Peter Dahlgrens Text „The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation" wird im achten Kapitel analysiert. Dahlgren untersucht den Einfluss des Internets auf die Öffentlichkeit und betont die Bedeutung der Interaktion im digitalen Raum. Er sieht im Internet sowohl Chancen als auch Risiken für die politische Kommunikation und die Demokratie.
Das neunte Kapitel widmet sich Niels Ole Finnemanns Abstract „Mediatization theory and digital media". Finnemann beschreibt das Phänomen der Mediatisierung von Gesellschaften und den Eintritt in ein neues digitales Zeitalter. Er argumentiert, dass die digitalen Medien einen tiefgreifenden Einfluss auf alle Bereiche der Gesellschaft haben, einschließlich Politik und Kultur.
Im zehnten Kapitel wird Grant Blanks Text „Who creates content?" betrachtet. Blank untersucht das Phänomen des „Web 2.0" und das „Mitmachnetz" und stellt die Frage, ob und inwiefern der soziale Status mit der Verbreitung von bestimmten Inhalten im Internet zusammenhängt. Er analysiert die unterschiedlichen Arten von Inhalten im Netz und diskutiert die Bedeutung von Medienkompetenz in der digitalen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Medien, Herrschaft, Politik, Kommunikation, Öffentlichkeit, Digitalisierung, Mediatisierung, Demokratie, Pressefreiheit, Propaganda, Manipulation, und Medienkompetenz. Die Arbeit analysiert verschiedene Texte, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Medien als Instrumente der Herrschaft verwendet werden können, und beleuchtet dabei sowohl klassische Ansätze der politischen Philosophie als auch aktuelle Entwicklungen in der digitalen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern können Medien als Instrumente der Herrschaft dienen?
Medien können durch einseitige Berichterstattung, Medienkonzentration in den Händen weniger Eliten und gezielte Informationsauswahl zur Manipulation der öffentlichen Meinung genutzt werden.
Was kritisierte Noam Chomsky an der Medienkontrolle?
Chomsky argumentiert, dass Medien in demokratischen Gesellschaften oft als Propagandawerkzeuge fungieren, um die Zustimmung der Bevölkerung zu den Zielen der Machteliten zu sichern ("Manufacturing Consent").
Was bedeutet "Mediatisierung" der Gesellschaft?
Mediatisierung beschreibt den Prozess, in dem soziale und politische Bereiche zunehmend von der Logik und den Formaten der Medien durchdrungen und abhängig werden.
Wie verändert das Internet die politische Kommunikation?
Das Internet ermöglicht zwar eine breitere Partizipation, führt aber auch zur Fragmentierung der Öffentlichkeit und bietet neue Räume für gezielte Desinformation.
Was ist Habermas' Modell der deliberativen Demokratie?
Es ist ein Modell, in dem politische Entscheidungen durch einen herrschaftsfreien Diskurs und die aktive Beteiligung der Bürger an der öffentlichen Kommunikation legitimiert werden.
- Citar trabajo
- Verena Schindler (Autor), 2014, Medien als Instrumente der Herrschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275252