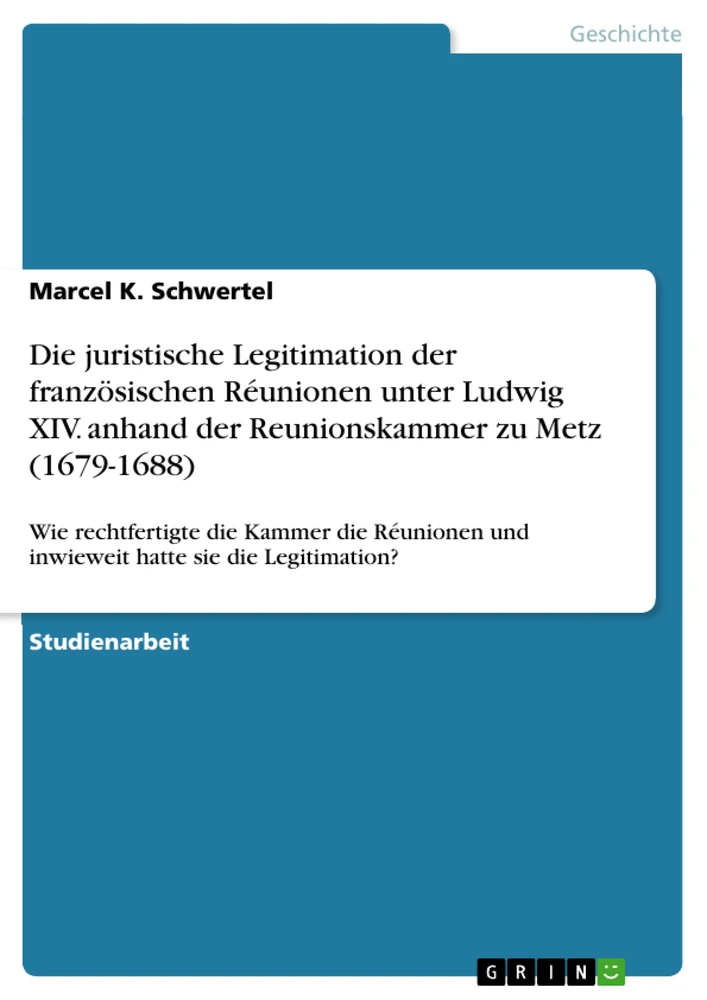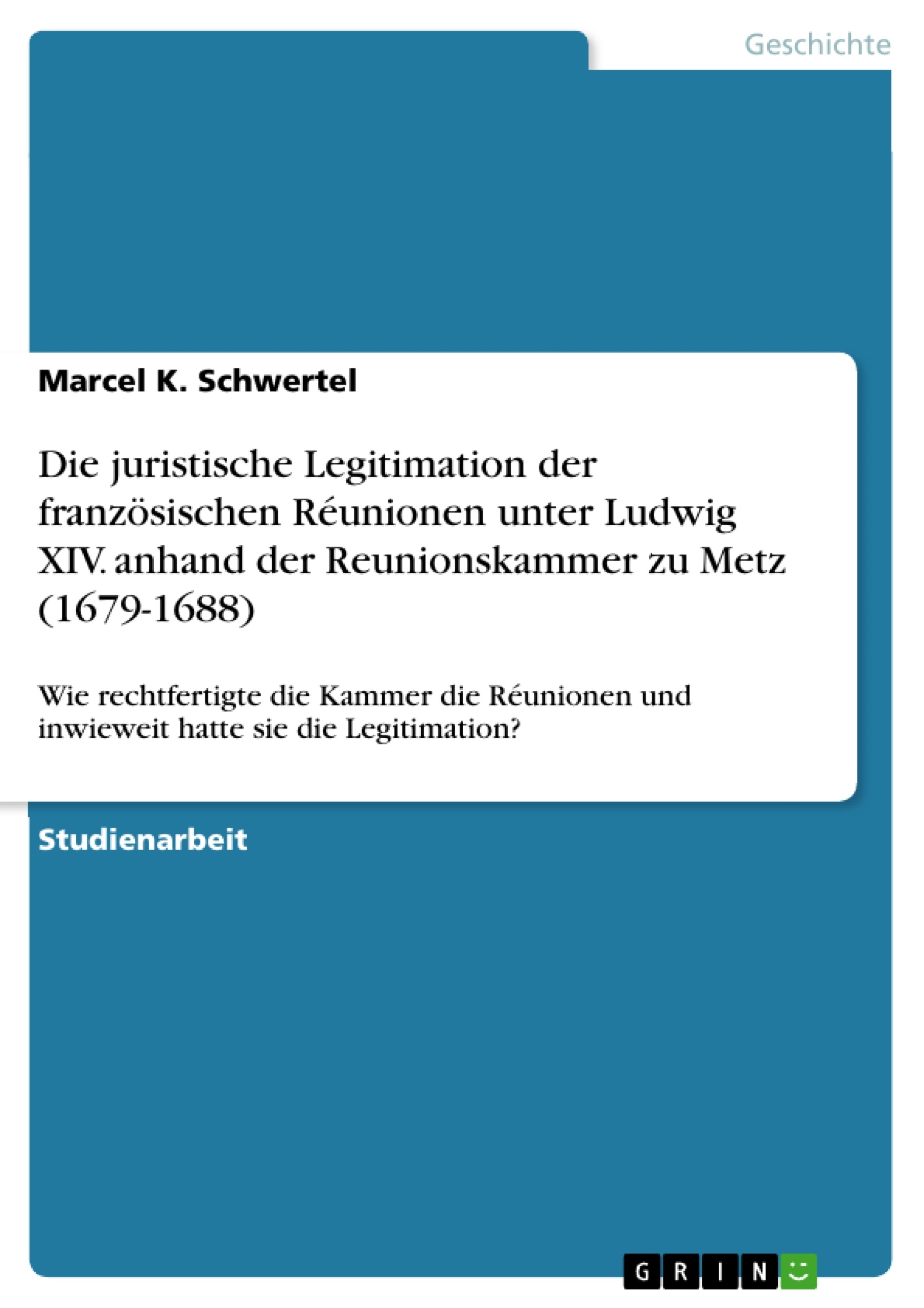Die deutsche Westgrenze und die französische Ostgrenze existieren seit sehr langer Zeit. Nach der Spaltung des Fränkischen Reiches, und seit dem Vertrag von Meerssen aus dem Jahr 870, gab es eine gemeinsame Grenze zwischen dem Ostfränkischen Reich und dem Westfränkischen Reich. Auch die nachfolgenden französischen sowie deutschen Staaten und Staatenverbunde behielten die gemeinsame Grenze bei. Dieser Grenzverlauf unterlag in mehr als 1000 Jahren einer kontinuierlichen Veränderung. Die letzte faktische Veränderung der Grenze ereignete sich am 1. Januar 1957, als das spätere Bundesland Saarland ein Teil der Bundesrepublik Deutschland wurde.
Natürlich gab es verschiedene Ursachen des Zustandekommens solcher Grenzveränderungen. Es gab Verträge, die eine friedliche Umsetzung der Veränderungen herbeiführten. Aber auch Kriege wie die Koalitionskriege von 1792 bis 1815, der Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und natürlich der Ersten und der Zweiten Weltkrieg, um nur einen Teil der Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland zu nennen. Diese Arbeit wird sich aber auf eine Phase beziehen, welche etwa 100 Jahre vor der Französischen Revolution liegt. Genauer gesagt geht es um die Zeit der Kriege Ludwigs XIV. und der sogenannten Reunionen.
Reunionen, beziehungsweise Reunionspolitik, nennt man die Angliederungen, oder wie der französische Begriff nahelegt, die Vereinigungen deutscher Gebiete mit dem französischen Mutterland. Dabei bezogen sich die Franzosen auf alte Vertragswerke und vor allem auf die Gebiete die durch den Westfälischen Frieden im Jahre 1648 und den späteren Verträgen von Nimwegen aus den Jahren 1678/79 unter die Lehnsherrschaft Frankreichs gelangten. Ein wichtiger Teil der Reunionspolitik waren, neben den Reunionskriegen, die Reunionskammern, welche den Angliederungen der deutschen Gebiete an Frankreich eine juristische Legitimation geben sollten. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Reunion von Reichsterritorium wirklich ein korrekter Vorgang war oder ob hier lediglich ein Scheinprozess unter französischer Feder stattfand.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte
- Außenpolitik und Kriege Ludwigs XIV.
- Die Reunionskammer zu Metz
- Zur Legitimation der Reunionsansprüche
- Die Ziele der Reunionspolitik
- Die Arbeit der Reunionskammer
- Folgen der Reunionspolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die juristische Legitimation der französischen Reunionspolitik unter Ludwig XIV. anhand der Reunionskammer zu Metz (1679-1688). Sie analysiert, wie die Kammer die Reunionen rechtfertigte und inwieweit sie als Instanz zur Legitimation fungierte.
- Die Reunionspolitik Ludwigs XIV. als Mittel zur Erweiterung des französischen Territoriums
- Die Rolle der Reunionskammern in der Legitimation der Annexion deutscher Gebiete
- Die Methoden und Argumente der Reunionskammer zu Metz
- Die Folgen der Reunionspolitik für die deutsch-französischen Beziehungen
- Die Kontroversen um die Legitimität der Reunionen in der historischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die deutsche Westgrenze und die französische Ostgrenze in einen historischen Kontext und führt in die Thematik der Reunionspolitik ein.
- Das Kapitel "Vorgeschichte" beleuchtet die Rolle des Dreißigjährigen Krieges und die Folgen des Westfälischen Friedens für die deutsch-französischen Beziehungen.
- Das Kapitel "Außenpolitik und Kriege Ludwigs XIV." gibt einen Überblick über die Expansionspolitik des französischen Königs und die damit verbundenen Kriege.
- Das Kapitel "Die Reunionskammer zu Metz" analysiert die Arbeit der Kammer, ihre Methoden der Legitimation und die Ziele der Reunionspolitik.
Schlüsselwörter
Reunionen, Reunionspolitik, Ludwig XIV., Frankreich, Deutschland, Reunionskammer, Metz, Legitimation, Annexion, Westfälischer Friede, Dreißigjähriger Krieg, deutsch-französische Beziehungen, Historische Forschung.
- Arbeit zitieren
- Marcel K. Schwertel (Autor:in), 2013, Die juristische Legitimation der französischen Réunionen unter Ludwig XIV. anhand der Reunionskammer zu Metz (1679-1688), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275305