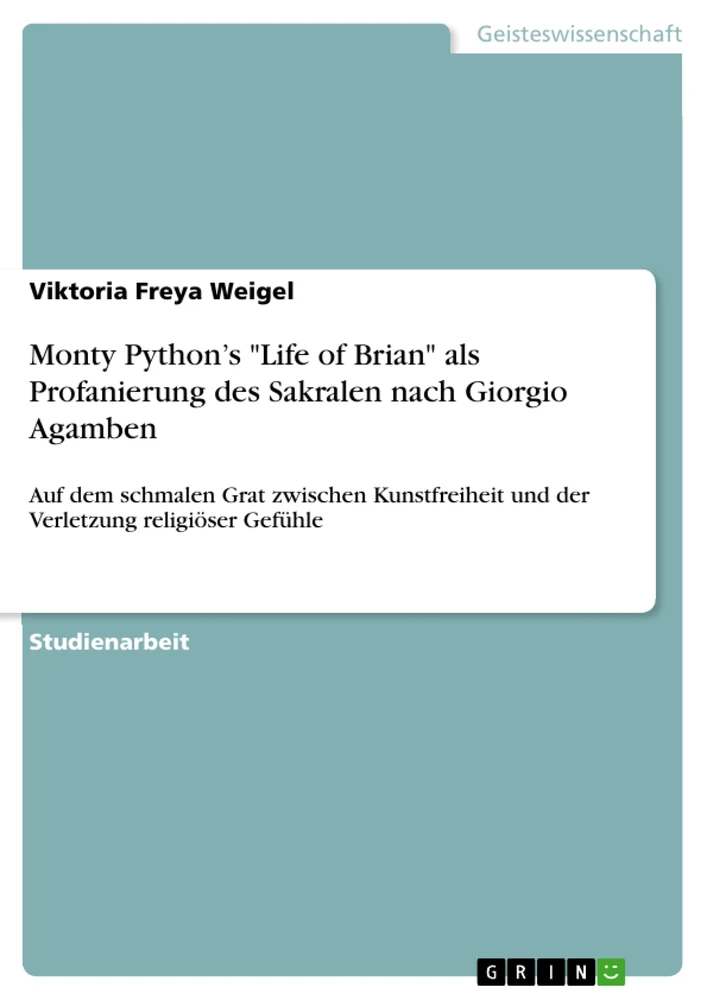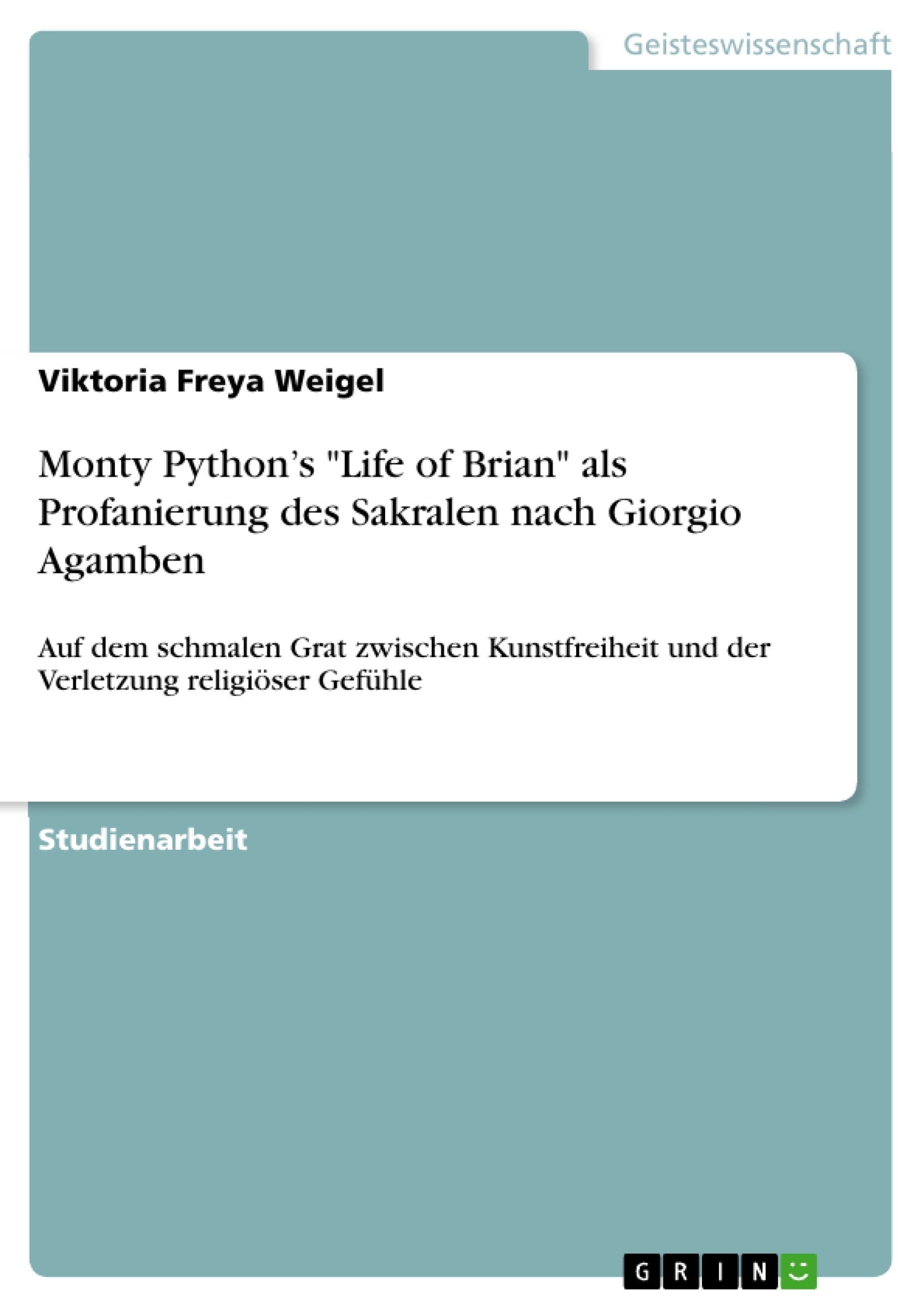Seit vielen Jahrhunderten ist Satire ein wichtiges gesellschaftliches Mittel, um Herrscher und regierende Kräfte zu kontrollieren bzw. um auf Missstände aufmerksam zu machen. In einem demokratischen Staat, wie dem, in dem wir heute leben, sind Kunstfreiheit und Satire als Mittel der politischen Meinungsäußerung nicht mehr wegzudenken.
Zielt der satirische Angriff jedoch auf die Religion, so entsteht häufig ein angespannteres Verhältnis im Vergleich zu anderen Angriffsobjekten. Oftmals bestehen Bedenken, christliche Würdenträger oder religiöse Inhalte allzu hart oder auf anstößige Weise zu kritisieren.
Ein besonders brisanter Fall, in dem Religionssatire auf entsetzte Reaktionen und Unverständnis stieß, waren die Mohammed-Karikaturen von 2005, auf die sogar mit Gewalt reagiert wurde. Es würde zu weit führen, zu untersuchen, aus welchem Grund Religionsgemeinschaften besonders sensibel auf Satire reagieren, doch es lässt sich ein Zusammenhang mit der Verletzung religiöser Gefühle vermuten. Der Glaube ist eine Einstellung, die in besonderem Maße mit Emotionen, Vertrauen und dem Gefühl einer Gemeinschaftszugehörigkeit zusammenhängt und die deshalb nicht primär rational herzuleiten ist. Und was gefühls- und nicht verstandesbedingt ist, tendiert eher dazu, auf emotionale Verletzungen sensibel zu reagieren. Der Gesetzgeber hat in unserem Staat dieser besonderen Sensibilität der Gläubigen dadurch Rechnung getragen, dass er die Religionsfreiheit unter den besonderen Grundrechtsschutz unserer Verfassung gestellt hat. So erklärt sich, dass Religionssatire als Ausdruck der Kunstfreiheit, die ebenfalls als Grundrecht geschützt ist, stets in einem besonderen rechtlichen Kollisionsverhältnis zum Grundrecht der freien Religionsausübung steht.
Der Film "Monty Python’s Life of Brian" von 1979 führte zu heftigen Diskussionen um Blasphemie und ebendieses Kollisionsverhältnis. Entsprechend den in Giorgio Agambens "Profanierung des Sakralen" benutzten Begrifflichkeiten untersucht diese Hausarbeit die Frage, inwiefern die satirische Abbildung biblischer Inhalte in "Monty Python’s Life of Brian" eine Profanierung bzw. Banalisierung des Sakralen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorwürfe und Rechtfertigungen
- 3. Untersuchung der ausgewählten Filmszenen
- 3.1 Die Predigt(en)
- 3.2 Kreuzigung
- 3.3 Darstellung von Brians Mutter
- 4. Religionssatire als Profanierung des Sakralen nach Giorgio Agamben
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht Monty Python's Life of Brian aus dem Jahr 1979. Der Film stieß aufgrund seiner satirischen Darstellung biblischer Inhalte auf heftige Kritik und wurde von vielen als blasphemisch empfunden. Im Fokus der Arbeit steht die Frage, ob Monty Python's Life of Brian tatsächlich als Profanierung des Sakralen im Sinne von Giorgio Agamben gedeutet werden kann.
- Die Reaktion christlicher Kritiker auf den Film
- Die satirische Darstellung biblischer Inhalte
- Die Rolle von Kunstfreiheit und dem Schutz religiöser Gefühle
- Die Anwendung des Konzepts der Profanierung des Sakralen auf den Film
- Die Frage nach dem Verhältnis von Satire und Blasphemie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Religionssatire im Kontext von Kunstfreiheit und dem Schutz religiöser Gefühle dar. Sie beleuchtet die Problematik, die entsteht, wenn satirische Angriffe auf die Religion gerichtet sind und führt Beispiele für kontroverse Fälle wie die Mohammed-Karikaturen von 2005 und den Kirchen-Rap Dunk dem Herrn von Carolin Kebekus an.
2. Vorwürfe und Rechtfertigungen
Dieses Kapitel beleuchtet die heftigen Reaktionen auf Monty Python's Life of Brian im Jahr 1979. Es analysiert die Kritik von Malcolm Muggeridge und Bischof Mervyn Stockwood, die den Film als persönliche Beleidigung empfanden, und setzt diese mit den Rechtfertigungen der Monty Python-Mitglieder John Cleese und Michael Palin in Beziehung.
3. Untersuchung der ausgewählten Filmszenen
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Filmszenen aus Monty Python's Life of Brian im Hinblick auf mögliche Blasphemie-Vorwürfe. Es analysiert die Predigten, die Kreuzigungsszene und die Darstellung von Brians Mutter.
Schlüsselwörter
Monty Python's Life of Brian, Religionssatire, Profanierung des Sakralen, Giorgio Agamben, Blasphemie, Kunstfreiheit, Schutz religiöser Gefühle, Christentum, Kritik, Rechtfertigung.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in der Hausarbeit zu „Das Leben des Brian“ untersucht?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die satirische Darstellung biblischer Inhalte im Film eine Profanierung des Sakralen im Sinne von Giorgio Agamben darstellt.
Warum galt der Film bei seinem Erscheinen 1979 als blasphemisch?
Kritiker wie Malcolm Muggeridge sahen in der Parodie auf biblische Motive (wie die Kreuzigung oder die Bergpredigt) eine tiefe Beleidigung religiöser Gefühle und des christlichen Glaubens.
Wie rechtfertigten die Monty Python-Mitglieder ihren Film?
John Cleese und Michael Palin argumentierten, dass der Film nicht Jesus Christus verspottet, sondern den blinden Fanatismus und das Verhalten der Anhänger parodiert.
Was bedeutet „Profanierung“ nach Giorgio Agamben?
Agamben beschreibt Profanierung als die Rückgabe von Dingen, die dem sakralen Bereich (dem Geheiligten) entzogen waren, an den freien Gebrauch der Menschen – oft durch Spiel oder Satire.
Welche Filmszenen werden in der Arbeit detailliert analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Predigten, die Kreuzigungsszene am Ende des Films und die Charakterisierung von Brians Mutter.
- Arbeit zitieren
- Viktoria Freya Weigel (Autor:in), 2014, Monty Python’s "Life of Brian" als Profanierung des Sakralen nach Giorgio Agamben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275325