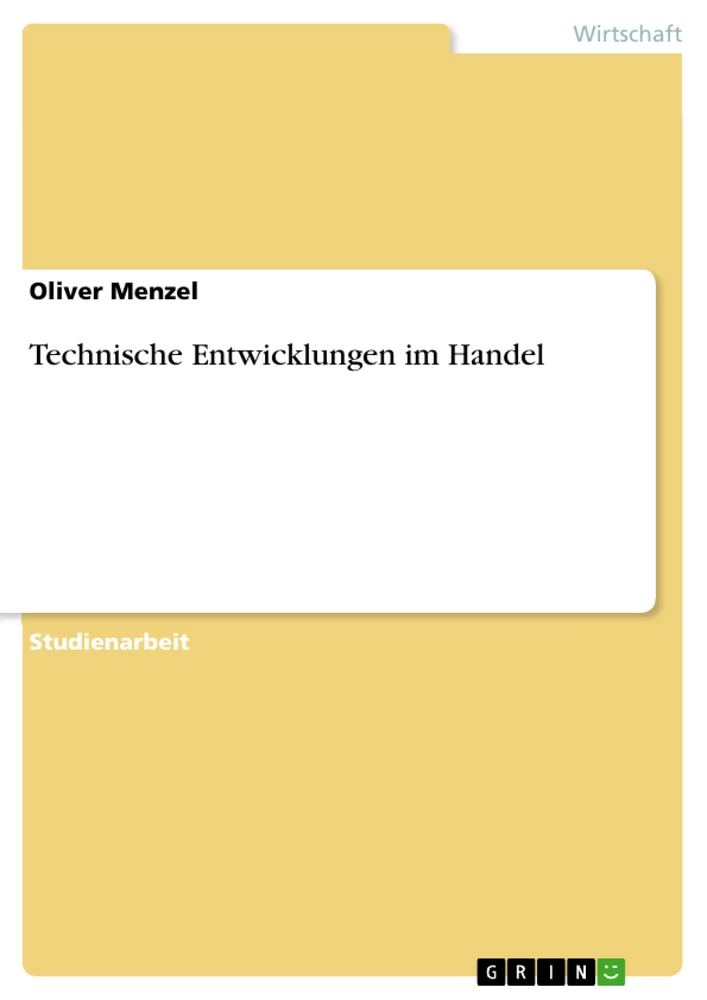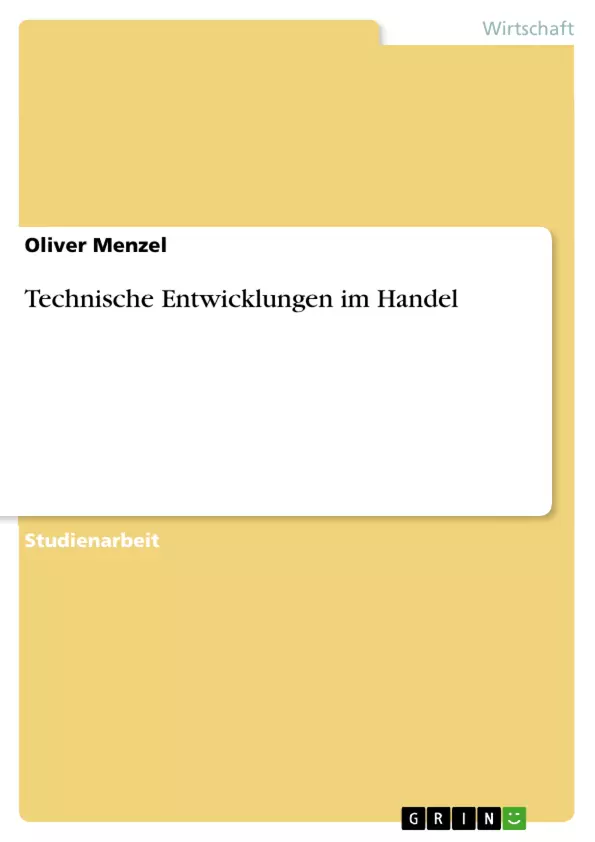Der Handel ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Dabei wurde der Verkauf von Waren schon immer durch technische Entwicklungen geprägt. Man denke dabei nur einmal an die Erfindung der Glühbirne. Händler hatten zum ersten mal die Chance ihre Ware unabhängig vom Wetter oder der Tageszeit in geschlossenen Räumen zu verkaufen. Dank des gespendeten Lichtes war es dem Kunden nun möglich, fernab der Witterung Produkte zu erwerben. Ähnliches ist auch in der heutigen Zeit erkennbar. Genauso wie die Glühbirne den Handel vom Marktplatz in die Warenhäuser geholt hat, bringen moderne Informationstechnologien den stationären Handel in die
digitale Welt. Durch den Einsatz von IT-Systemen und dem Internet entwickelt der Handel eine ganz neue Dynamik. Mehr denn je kann spezifisch auf den Kunden eingegangen und neue
Innovationen verwirklicht werden.
Die folgende Seminararbeit soll dem Leser einen Einblick in diese technologischen Entwicklungen verschaffen. Dabei stellt ein gewöhnlicher Einkauf den Rahmen der Hausarbeit dar. Von der
Erstellung einer Einkaufsliste bis hin zur Bezahlung der Produkte, sollen neuartige Technologien vorgestellt werden. Das erste Kapitel bildet diese Einleitung. Die Auflistung der Produkte, welche man gewillt ist zu kaufen, und das finden einer geeigneten Geschäftsstelle werden, unter Berücksichtigung der Digitalisierung, Bestandteil des zweiten Kapitels sein. Das dritte Kapitel soll die Technologischen Innovationen im Handel selbst präsentieren. No-Line-Systeme, welche für eine maximale Vernetzung zwischen dem stationären Handel und dem Internet stehen, sind besonderes Augenmerk dieses Kapitels. Informationstechnologien und das Internet haben ebenfalls die Art der Bezahlung revolutioniert. Auf diese Thematik wird im vierten Kapitel genauer eingegangen. Das fünfte Kapitel stellt ein Fallbeispiel dar, in dem näher auf das Projekt der Metro Group Future Store Initiative eingegangen wird. Hier wurde bereits im Jahre 2003 eine Filiale eröffnet, welche die neusten technischen Entwicklungen direkt am Kunden testet. Den Abschluss der Seminararbeit stellt das Fazit dar, dies wird im sechsten und letzten Kapitel präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Digitale Einkaufsplanung und Location Based Services
- Der digitale Einkaufszettel
- Location Based Services
- Eingesetzte Technologien im Handel
- Persönliche Ansprache des Kunden durch technischen Fortschritt
- Smartcart: intelligenter Einkaufswagen der Zukunft
- QR-Codes und Augmented Reality
- Neuartige Zahlungs- und Kassensysteme
- Mobile Endgeräte für moderne Zahlungssysteme
- Selbstbedienungskassen
- Der Fingerabdruck als Zahlungsmittel
- Fallbeispiel: METRO Group Future Store Initiative
- Entwicklung der Metro Group Future Store Initiative
- Das technisch geprägte Einkaufserlebnis
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Integration von technischen Entwicklungen im stationären Handel, wobei der Fokus auf den alltäglichen Einkaufsprozess gelegt wird. Die Arbeit beleuchtet, wie digitale Technologien den Einkauf von der Planung bis zur Bezahlung verändern und welche neuen Möglichkeiten sich für Händler und Kunden eröffnen.
- Digitale Einkaufsplanung und Location Based Services
- Einsatz von Informationstechnologie und Internet im stationären Handel
- Neuartige Zahlungs- und Kassensysteme
- Das Einkaufserlebnis der Zukunft: Das Beispiel des METRO Group Future Store
- Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Handel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von technischen Entwicklungen im Handel dar und erläutert den Rahmen der Seminararbeit, der den Einkaufsprozess vom Erstellen einer Einkaufsliste bis zur Bezahlung umfasst.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der digitalen Einkaufsplanung und Location Based Services. Hier werden Anwendungen wie digitale Einkaufszettel und Ortungsdienste vorgestellt, die den Kunden beim Planen und Finden von Geschäften unterstützen.
Das dritte Kapitel thematisiert die eingesetzten Technologien im Handel selbst. Es werden verschiedene Ansätze zur persönlichen Ansprache des Kunden vorgestellt, wie beispielsweise die Nutzung von GPS-Daten für individuelle Begrüßungen und Werbung.
Das vierte Kapitel widmet sich neuartigen Zahlungs- und Kassensystemen. Hier wird der Einsatz von mobilen Endgeräten für moderne Zahlungssysteme, die Nutzung von Selbstbedienungskassen und die Bezahlung via Fingerabdruck erläutert.
Das fünfte Kapitel stellt das Fallbeispiel der METRO Group Future Store Initiative vor. Hier werden die Entwicklung des Projekts, die eingesetzten Technologien und das technisch geprägte Einkaufserlebnis im Future Store in Tönisvorst beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die technischen Entwicklungen im Handel, digitale Einkaufsplanung, Location Based Services, mobile Endgeräte, QR-Codes, Augmented Reality, NFC, RFID, Smartcart, Selbstbedienungskassen, Fingerabdruck als Zahlungsmittel, METRO Group Future Store Initiative, mobile Einkaufsassistent, Online- und Offline-Handel, Verschmelzung von Kanälen, Kundenansprache, Individualität, technischer Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert die Digitalisierung die Einkaufsplanung?
Durch digitale Einkaufszettel und Location Based Services können Kunden Einkäufe effizienter planen und erhalten standortbezogene Angebote direkt auf ihr Smartphone.
Was sind Location Based Services (LBS) im Handel?
LBS nutzen GPS- oder Beacon-Daten, um Kunden beim Betreten eines Ladens persönlich zu begrüßen oder ihnen individuelle Rabatte basierend auf ihrem Standort im Geschäft zu senden.
Welche Rolle spielen QR-Codes und Augmented Reality beim Shoppen?
QR-Codes ermöglichen den schnellen Zugriff auf Produktinformationen, während Augmented Reality (AR) es Kunden erlaubt, Produkte virtuell zu testen oder zusätzliche digitale Inhalte im Laden zu sehen.
Was ist die „METRO Group Future Store Initiative“?
Dies war ein Pionierprojekt (ab 2003), bei dem neue Technologien wie RFID, intelligente Einkaufswagen und elektronische Preisetiketten unter realen Bedingungen mit Kunden getestet wurden.
Welche neuartigen Zahlsysteme gibt es im stationären Handel?
Neben Mobile Payment via Smartphone werden Selbstbedienungskassen und sogar biometrische Verfahren wie die Bezahlung per Fingerabdruck erprobt.
- Quote paper
- Oliver Menzel (Author), 2014, Technische Entwicklungen im Handel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275424