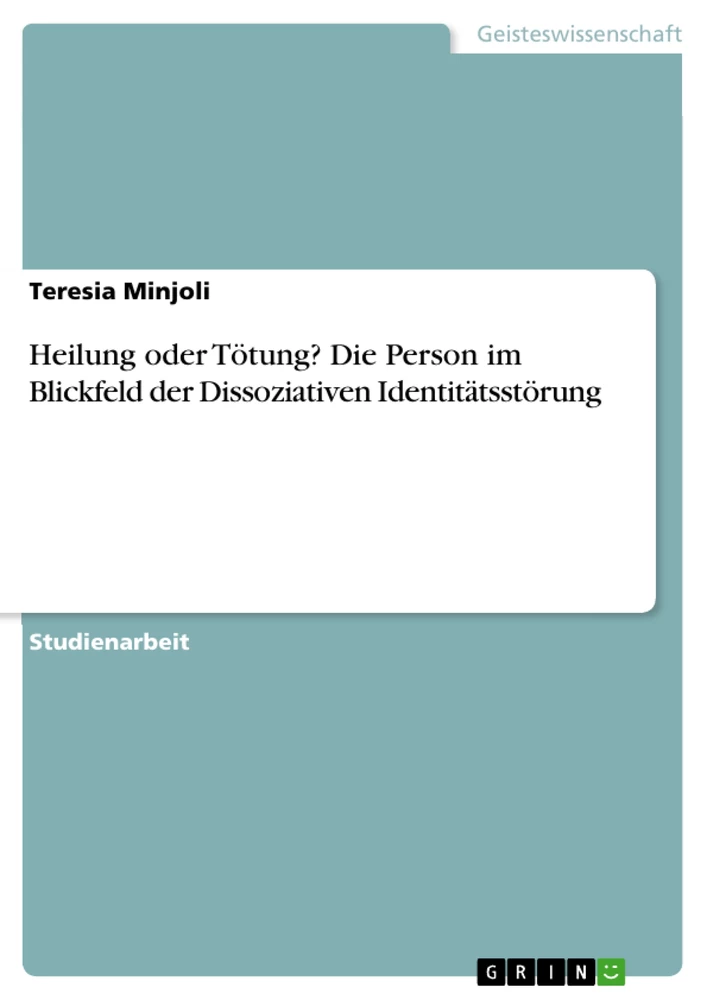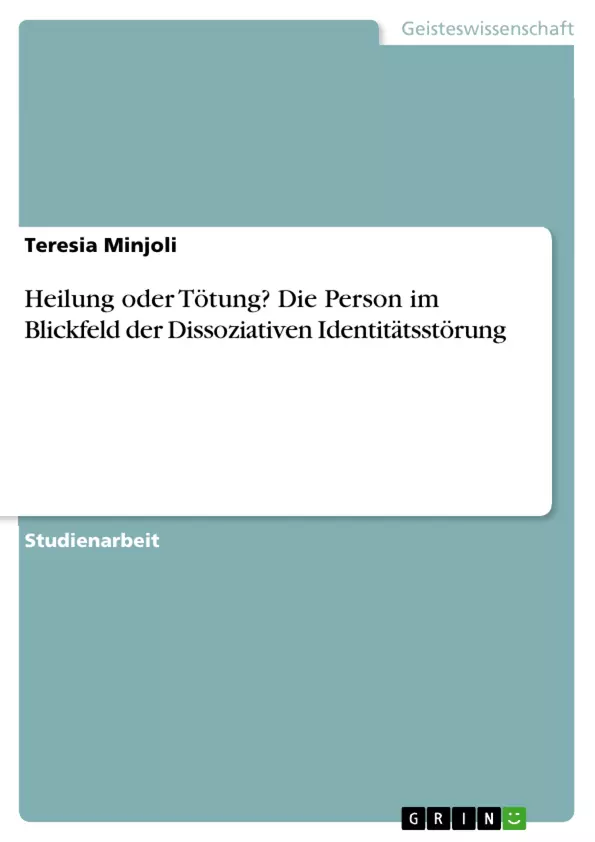Die Unterschiedlichsten Fallbeispiele von Patienten mit Dissoziativer Identitätsstörung zeigen, wie extrem sich die Abspaltungen mit der Zeit voneinander unterscheiden. Sie führen mehr und mehr ein Eigenleben, entwickeln unterschiedliche Charakterzüge, Vorlieben, haben andere Freunde und Hobbys. Wenn diese schließlich doch als Personen anzusehen sind, welche Bedeutung hätte für sie dann eine Heilung von der Krankheit? Wie so oft in der Debatte um den Person-Begriff stellt sich auch hier die Frage: Wo fängt "Person sein" an und wo hört es auf?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identitätsstörung
- Der Fall Christine Beauchamp
- Multiple Persönlichkeiten und Person-Begriffe
- Person-Begriff in der Psychologie
- Person-Begriff in der Philosophie
- Die Person bei Locke
- Die Person bei Singer
- Heilung durch Therapie
- Folgen für die Personen
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Dissoziativen Identitätsstörung, auch bekannt als multiple Persönlichkeitsstörung, und untersucht die Frage, ob die verschiedenen Persönlichkeiten, die sich im Laufe der Krankheit entwickeln, als eigenständige Personen betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert, wie diese Persönlichkeiten im Kontext verschiedener Person-Begriffe in der Psychologie und Philosophie zu verstehen sind und welche ethischen Implikationen eine Heilung der Krankheit für diese Persönlichkeiten haben könnte.
- Dissoziative Identitätsstörung und die Frage der Personhood
- Der Person-Begriff in der Psychologie und Philosophie
- Ethische Aspekte der Heilung und die Auswirkungen auf die Persönlichkeiten
- Der Fall Christine Beauchamp als Beispiel für die Entwicklung und Interaktion von Persönlichkeiten
- Die Rolle von Trauma und Dissoziation in der Entstehung der Krankheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Dissoziativen Identitätsstörung ein und stellt die zentrale Frage der Arbeit: ob eine Heilung der Krankheit einer Tötung der verschiedenen Persönlichkeiten gleichkommt. Das zweite Kapitel erklärt die Dissoziative Identitätsstörung und beschreibt die Entstehung und Entwicklung von verschiedenen Persönlichkeiten im Laufe der Krankheit. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Persönlichkeiten anhand des Fallbeispiels von Christine Beauchamp, das die komplexe Dynamik der Persönlichkeiten und deren Interaktion im Laufe der Therapie verdeutlicht. Das dritte Kapitel analysiert den Person-Begriff in der Psychologie und Philosophie, um die Frage nach der Personhood der verschiedenen Persönlichkeiten zu beleuchten. Es werden die Definitionen von Person bei John Locke und Peter Singer vorgestellt, die verschiedene Aspekte des Bewusstseins, der Selbstwahrnehmung und der individuellen Biografie in den Vordergrund stellen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Heilung durch Therapie und den möglichen Folgen für die verschiedenen Persönlichkeiten. Es werden die Methoden der Integration und Fusion sowie die ethischen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Verlust von Persönlichkeiten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Dissoziative Identitätsstörung, multiple Persönlichkeiten, Person-Begriff, Psychologie, Philosophie, John Locke, Peter Singer, Heilung, Therapie, Integration, Fusion, ethische Implikationen, Trauma, Dissoziation, Christine Beauchamp.
- Arbeit zitieren
- Teresia Minjoli (Autor:in), 2013, Heilung oder Tötung? Die Person im Blickfeld der Dissoziativen Identitätsstörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275476