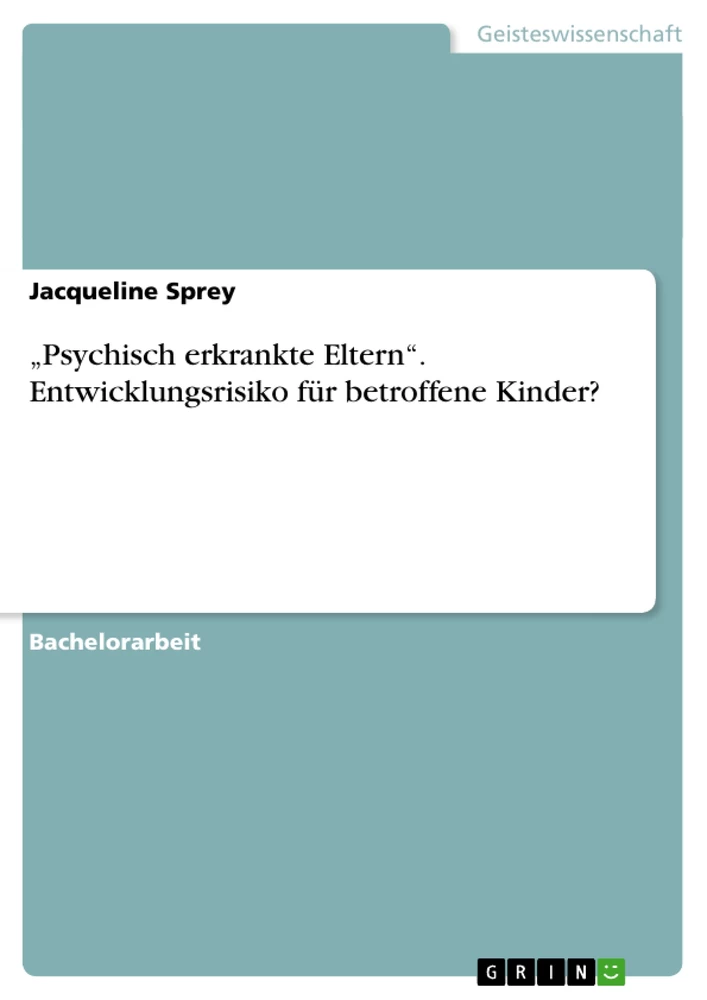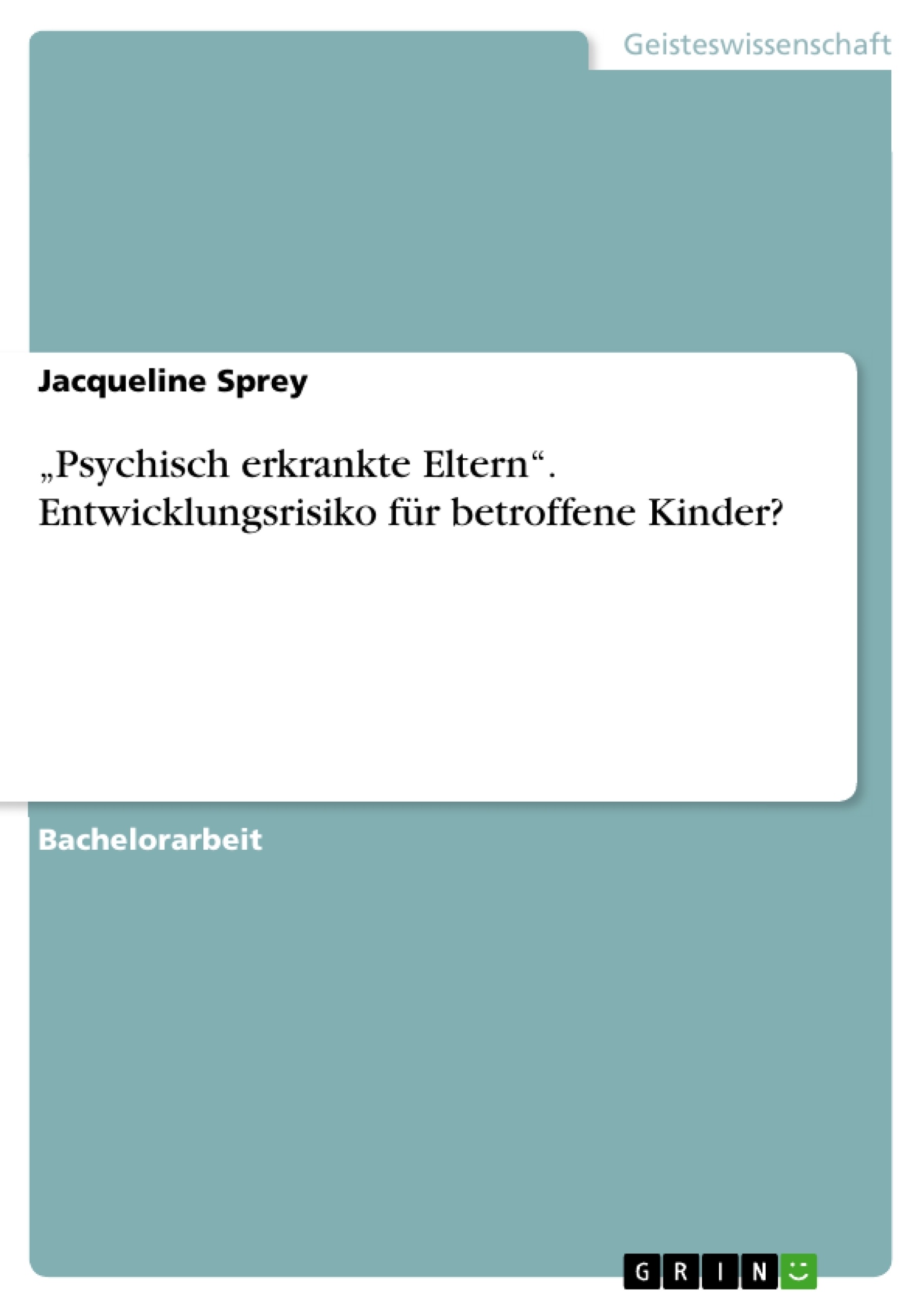Kinder psychisch kranker Eltern stellen in der Bundesrepublik Deutschland keine Randgruppe dar. Hochrechnungen zufolge wachsen in Deutschland etwa drei Millionen Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Da sich die psychische Erkrankung nicht nur auf den betroffenen Elternteil, sondern auch auf das komplette Familiensystem und somit auch auf die Kinder auswirkt, sind diese in vielfältiger Hinsicht von der elterlichen Erkrankung betroffen. In dieser Arbeit soll betrachtet werden, ob und in welchem Ausmaß die elterliche Erkrankung ein Risiko für die Entwicklung betroffener Kinder darstellt.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Thema: Leben mit psychisch kranken Eltern. Dabei werden zunächst die familiären Rahmenbedingungen, wie Alter der Kinder, Geschlecht der Eltern, ökonomische Bedingungen und die Art der Erkrankung, beleuchtet. Im Anschluss werden die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf Bindung, Beziehung und Interaktion sowie die Auswirkungen auf die Gestaltung des Lebensalltags behandelt. Danach wird im dritten Kapitel ein Überblick über die Forschungen zu Kindern psychisch kranker Eltern gegeben. Dabei sollen sowohl Einblicke in die Risikoforschung als auch in die Vulnerabilitäts- und Resilienzforschung gegeben werden. Das darauffolgende Kapitel setzt sich speziell mit den Entwicklungsrisiken betroffener Kinder auseinander und betrachtet dabei nicht nur die Risiken der Ausbildung allgemeiner Entwicklungsauffälligkeiten, sondern auch das Risiko, selbst psychisch zu erkranken. In Kapitel 5 sollen Hilfsmöglichkeiten dargelegt werden, wobei sich der Unterpunkt 5.1 mit den Präventionsangeboten in Deutschland beschäftigt und der Unterpunkt 5.2 näher auf die Leistungen der Jugendhilfe eingeht. Abschließend soll ein Einblick in die Spannungsfelder zwischen Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie gegeben werden. In einem kurzen Fazit wird die Fragestellung „Psychisch kranke Eltern – Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder?“ anhand der vorangegangenen Kapitel erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Leben mit psychisch kranken Eltern
- Familiäre Rahmenbedingungen
- Art der Erkrankung
- Geschlecht des erkrankten Elternteils
- Alter der Kinder und Geschlechtsspezifität
- Wohnverhältnisse
- Ökonomische Bedingungen
- Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf Bindung, Beziehung und Interaktion
- Bindungsverhalten
- Eltern-Kind-Beziehung
- Interaktionsverhalten
- Auswirkungen auf die Gestaltung des Lebensalltags
- Unmittelbare Probleme
- Folgeprobleme
- Familiäre Rahmenbedingungen
- Forschungsüberblick
- Risikoforschung
- Resilienz- und Bewältigungsforschung
- Vulnerabilitätsforschung
- Entwicklungsrisiken von Kindern psychisch kranker Eltern
- Elterliche Erkrankung und Entwicklungsverlauf von Kindern
- Risiken allgemeiner Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern psychisch kranker Eltern
- Risiken allgemeiner Entwicklungssauffälligkeiten nach dem Alter der Kinder
- Weitere Auffälligkeiten
- Risiko der Ausbildung einer psychischen Erkrankung bei den Kindern
- Risiko- und Belastungsfaktoren
- Resilienz
- Coping
- Hilfemöglichkeiten für betroffene Kinder und ihre Eltern
- Präventionsangebote für Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil
- Leistungen der Jugendhilfe für Familien mit einem psychisch kranken Elternteil
- Spannung zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anlage 1: Übersicht über die Diagnosekriterien der oben aufgeführten Erkrankungen nach ICD-10
- Anlage 2: Auflistung der Belastungsfaktoren
- Anlage 3: Detaillierte Übersicht der Schutzfaktoren
- Anlage 4: Überblick über die Leistungen der Jugendhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welchem Ausmaß die psychische Erkrankung eines Elternteils ein Risiko für die Entwicklung betroffener Kinder darstellt.
- Familienleben mit psychisch kranken Eltern
- Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf die kindliche Entwicklung
- Risikofaktoren und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern psychisch kranker Eltern
- Präventionsangebote und Hilfemöglichkeiten für betroffene Kinder und Familien
- Spannungsfelder zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet das Leben mit psychisch kranken Eltern, indem es die familiären Rahmenbedingungen wie Alter der Kinder, Geschlecht des erkrankten Elternteils, ökonomische Bedingungen und die Art der Erkrankung beleuchtet. Anschließend werden die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf die Bindung, Beziehung und Interaktion sowie die Auswirkungen auf die Gestaltung des Lebensalltags behandelt.
Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über die Forschung zu Kindern psychisch kranker Eltern. Dabei werden sowohl Einblicke in die Risikoforschung als auch in die Vulnerabilitäts- und Resilienzforschung gegeben.
Das vierte Kapitel setzt sich mit den Entwicklungsrisiken betroffener Kinder auseinander und betrachtet dabei nicht nur die Risiken der Ausbildung allgemeiner Entwicklungsauffälligkeiten, sondern auch das Risiko, selbst psychisch zu erkranken.
Das fünfte Kapitel erläutert Hilfemöglichkeiten für betroffene Kinder und ihre Eltern. Der Unterpunkt 5.1 beschäftigt sich mit den Präventionsangeboten in Deutschland, während der Unterpunkt 5.2 näher auf die Leistungen der Jugendhilfe eingeht.
Das sechste Kapitel gibt einen Einblick in die Spannungsfelder zwischen Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die psychische Erkrankung von Eltern, die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Resilienz, Coping, Präventionsangebote, Jugendhilfe, Erwachsenenpsychiatrie, und die Spannungsfelder zwischen diesen Institutionen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Entwicklung von Kindern psychisch kranker Eltern zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf die Bindung, Beziehung und Interaktion sowie auf die Gestaltung des Lebensalltags. Weitere Themen sind die Bewältigung von Belastungen, die Bedeutung von Schutzfaktoren, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und die Praxis der Jugendhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder sind in Deutschland von psychisch kranken Eltern betroffen?
Hochrechnungen zufolge wachsen in Deutschland etwa drei Millionen Kinder mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil auf.
Stellt die psychische Erkrankung der Eltern ein Entwicklungsrisiko dar?
Ja, die Arbeit untersucht, wie sich die Erkrankung auf das Familiensystem auswirkt und Risiken für allgemeine Entwicklungsauffälligkeiten sowie das Risiko, selbst psychisch zu erkranken, erhöht.
Welche Faktoren beeinflussen die kindliche Entwicklung in diesem Kontext?
Wichtige Faktoren sind die Art der Erkrankung, das Geschlecht des Elternteils, das Alter des Kindes, die ökonomischen Bedingungen und die Qualität der Bindung und Interaktion.
Was versteht man unter Resilienz bei diesen Kindern?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, trotz der belastenden Lebensumstände eine gesunde Entwicklung zu nehmen, oft unterstützt durch spezifische Schutzfaktoren.
Welche Hilfemöglichkeiten gibt es für betroffene Familien?
Es gibt Präventionsangebote sowie spezifische Leistungen der Jugendhilfe, die darauf abzielen, die Familien zu stabilisieren und die Kinder zu schützen.
Wo liegen die Spannungsfelder zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie?
Häufig gibt es Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der Erwachsenenpsychiatrie (Fokus auf den kranken Elternteil) und der Jugendhilfe (Fokus auf das Kindeswohl), was eine ganzheitliche Betreuung erschweren kann.
- Quote paper
- Jacqueline Sprey (Author), 2014, „Psychisch erkrankte Eltern“. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275492