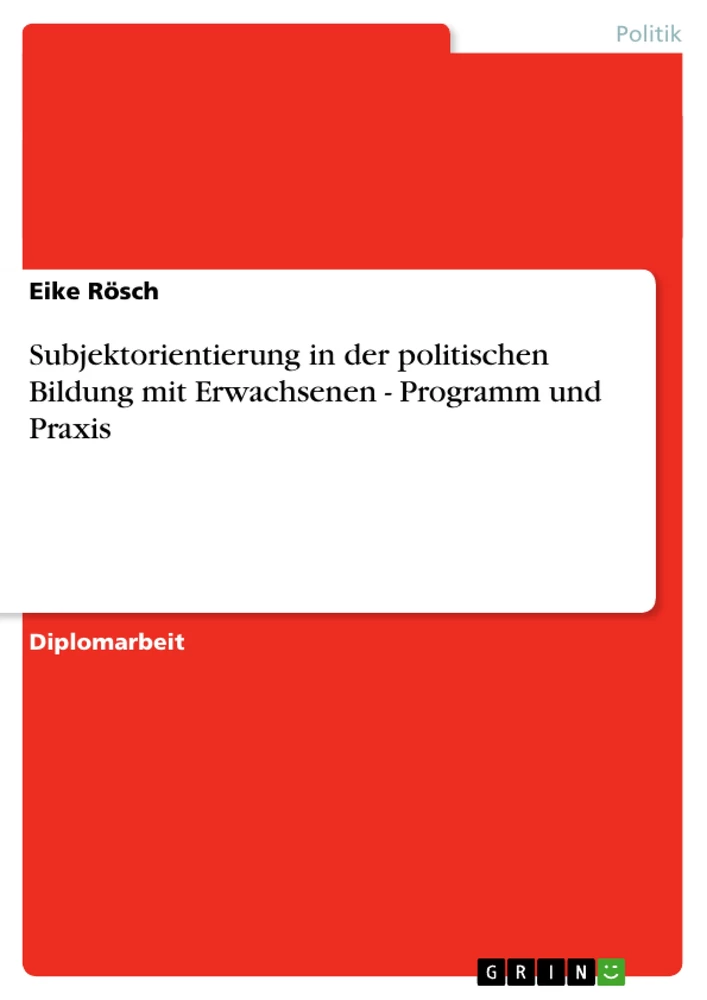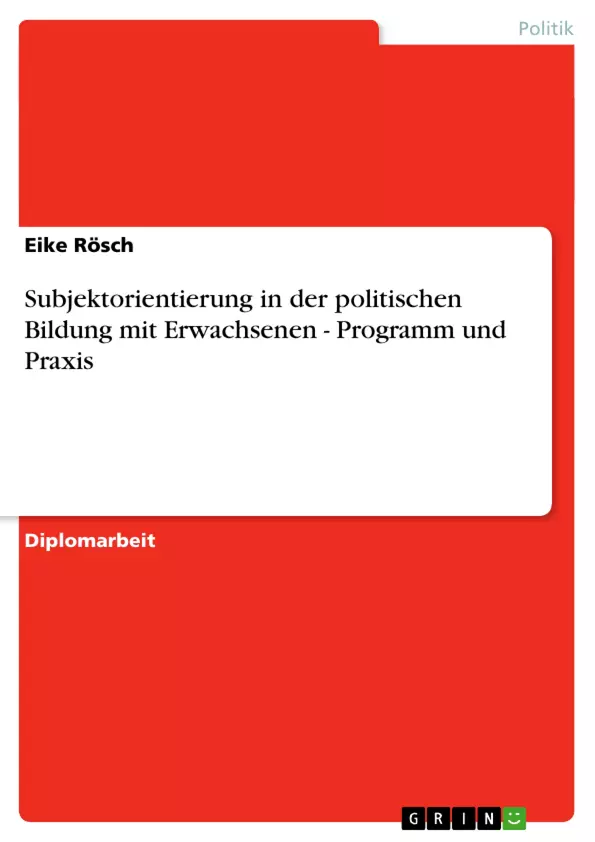Weltweit sind die Menschen aktuell von einer Situation bzw. einem Prozess betroffen, die teilweise als „neoliberale Globalisierung“ bezeichnet werden, für die aber auch das Etikett „real existierender Kapitalismus“ gewählt werden kann: Insbesondere nach dem Ende der Blockkonfrontation wird die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform als alternativlos bezeichnet und als „Globalisierung“ ein Prozess voran getrieben, der in den 1980er Jahren begonnen wurde und seitdem mit steigender Geschwindigkeit abläuft.
Damit werden die Rahmenbedingungen kapitalistischen Wirtschaftens verbessert, indem mehr und mehr gesellschaftliche Bereiche in die kapitalistische Verwertung einbezogen werden. Gleichzeitig verschärfen sich jedoch die „Kollateralschäden“ der Wirtschaftsform, wie weltweite Umweltzerstörung, Kriege, globale Machtverhältnisse, Gewalt, Unterdrückung und Migration. Für die meisten Menschen hat beides negative Auswirkungen.
Menschen werden dabei vielfach und umfassend zum Objekt: durch Marktbeziehungen, Tauschlogik, Macht- und Herrschaftsverhältnisse, strukturelle und offene Gewalt.
Dagegen wird mehr und mehr protestiert. Neben ‚traditionellen’, staatsorientierten, reformistischen, kommunistischen Zielsetzungen, verbreiten sich mehr und mehr auch Ansätze, die Herrschaftsfreiheit, Selbstbestimmung und Emanzipation in den Mittelpunkt stellen.
In allen Organisationsformen politischer Arbeit findet dabei auch immer politische Bildung statt – egal ob selbst organisiert oder professionell begleitet. Pädagogik, die sich nicht in den Dienst von Herrschafts- und Machtstrukturen stellen will, muss klar die Freiheit und Emanzipation des Einzelnen zum Ziel haben und auch ihre Methoden danach ausrichten. Der Ausbau der subjektorientierten Bildung in der politischen Arbeit ist daher ein möglicher Schritt auf dem Weg hin zu mehr Selbstbestimmung, Emanzipation und Beseitigung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen.
Es muss also gefragt werden, was subjektorientierte Bildung zunächst im Detail bedeutet, welche Relevanz sie genau für die politische Erwachsenenbildung hat und welche Rolle sie in der praktischen Arbeit der AkteurInnen im Bereich der politischen Bildung mit Erwachsenen spielt.
Mit der vorliegenden Arbeit soll genau dies getan werden. Es sollen Begrifflichkeiten geklärt, Kernpunkte des Konzepts heraus gearbeitet und vor diesem Hintergrund die Praxis der Subjektorientierung in Zusammenhängen der politischen Erwachsenenbildung betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- PROLOG
- KAPITEL I INHALTLICHE UND METHODISCHE EINFÜHRUNG
- I.1 Anlass und Problem der Arbeit
- I.2 Fragestellungen
- I.3 Methodische Ausrichtung der Arbeit
- I.4 Materialabgrenzung
- I.5 Aufbau der Arbeit
- I.6 Angrenzende, aber nicht behandelte Probleme
- KAPITEL II BEGRIFFSKLÄRUNGEN
- II.1 Subjekt
- II.1.1 Historischer Begriffshintergrund
- II.1.2 Moderner Subjektbegriff
- II.1.3 Zusammenfassung
- II.2 Bildung
- II.2.1 Historischer Begriffshintergrund
- II.2.2 Moderne Bildungstheorien
- II.2.3 Zusammenfassung
- II.3 Politische Erwachsenenbildung
- II.3.1 Begriff und Theorie der politischen Bildung
- II.3.2 Politische Bildung mit Erwachsenen
- II.3.3 Ausblick in die Praxis der politischen Erwachsenenbildung
- II.3.4 Zusammenfassung
- KAPITEL III SUBJEKTORIENTIERUNG IN DER POLITISCHEN ERWACHSENENBILDUNG
- III.1 Vorbelegungen
- III.1.1 Begriffliche Abgrenzung
- III.1.2 Motivationen/Begründungen des Konzepts
- III.1.2.1 Historische Entwicklungen
- III.1.2.2 Gesellschaftspolitisch-philosophische Begründung
- III.1.3 Ziele von subjektorientierter politischer Erwachsenenbildung
- III.2 Grundlinien subjektorientierter Erwachsenenbildung
- III.2.1 Subjekttheoretische Grundannahmen
- III.2.2 Möglichkeiten der Subjektentwicklung
- III.3 Bedeutungen für die Praxis
- III.3.1 Anforderungen an pädagogische Arbeit
- III.3.1.1 Die Beteiligten und ihre Rollen
- III.3.1.2 Die Inhalte
- III.3.1.3 Die Gestaltung der Zusammenarbeit
- III.3.2 Mögliche Probleme und Gefahren
- III.4 Zusammenfassung
- KAPITEL IV UNTERSUCHUNGSKONZEPTION
- IV.1 Erhebung
- IV.1.1 Methode
- IV.1.1.1 Methodenwahl
- IV.1.1.2 Grundsätzliches zur Methode des problemzentrierten Interviews
- IV.1.2 Konzeption der Befragung
- IV.1.2.1 Interviews
- IV.1.2.2 Kurzfragebogen
- IV.1.2.3 Leitfaden
- IV.1.3 Durchführung
- IV.1.3.1 Äußere Bedingungen (Zeit, Ort, Atmosphäre)
- IV.1.3.2 InterviewpartnerInnen
- IV.1.3.3 Aufzeichnungen und Transkription
- IV.1.3.4 Qualitatives Interview
- IV.2 Auswertungsmethoden
- IV.2.1 Methoden
- IV.2.1.1 Wahl der Methoden
- IV.2.1.2 Grundsätzliches zu den Methoden
- IV.2.2 Grundlegende analytische Überlegungen
- IV.2.3 Erster Interpretationsschritt
- IV.2.3.1 Kategorien
- IV.2.3.2 Zuordnung und Zusammenfassung
- IV.2.4 Zweiter Interpretationsschritt
- KAPITEL V UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
- V.1 Fallbezogene Betrachtung
- V.1.1 Herr A
- V.1.1.1 Strukturierende Betrachtung
- V.1.1.2 Interpretative Herangehensweise
- V.1.2 Frau B
- V.1.2.1 Strukturierende Betrachtung
- V.1.2.2 Interpretative Herangehensweise
- V.1.3 Herr C
- V.1.3.1 Strukturierende Betrachtung
- V.1.3.2 Interpretative Herangehensweise
- V.2 Fallübergreifender Vergleich der Ergebnisse
- V.2.1 Handlungsleitende Ziele und Prinzipien der AkteurInnen
- V.2.2 Genannte Problemfelder der Arbeit
- V.3 Subjektorientierung im professionellen Handeln der AkteurInnen
- KAPITEL VI ZUSAMMENFÜHRUNG UND AUSBLICK
- Begriffsdefinition und historische Entwicklung der Subjektorientierung
- Theoretische Grundlagen und Praxisrelevanz der politischen Erwachsenenbildung
- Analyse von Fallstudien zur subjektorientierten Praxis in der politischen Erwachsenenbildung
- Ermittlung von Herausforderungen und Chancen der Subjektorientierung in der politischen Bildung mit Erwachsenen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Gestaltung subjektorientierter Bildungsprozesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Konzept der Subjektorientierung in der politischen Bildung mit Erwachsenen. Sie analysiert die Bedeutung, Ziele und Praxisbezüge dieses Konzeptes, um ein tieferes Verständnis für die Gestaltung und Implementierung subjektorientierter Bildungsprozesse im Erwachsenenbereich zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert den Hintergrund, die Fragestellungen, die methodische Vorgehensweise und die Struktur der Arbeit. Kapitel II beleuchtet die zentralen Begriffe der Arbeit: Subjekt, Bildung und politische Erwachsenenbildung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze und historische Entwicklungen beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der relevanten Konzepte zu schaffen. Kapitel III fokussiert auf die Subjektorientierung in der politischen Erwachsenenbildung. Es werden die Motivationen, Ziele und Grundlinien des Konzepts analysiert und die Auswirkungen auf die pädagogische Praxis beleuchtet. Kapitel IV beschreibt die methodische Vorgehensweise der Diplomarbeit, einschließlich der Erhebungs- und Auswertungstechniken. Kapitel V präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung anhand von Fallstudien und analysiert die Ergebnisse im Vergleich. Kapitel VI fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Subjektorientierung, politische Bildung, Erwachsenenbildung, Pädagogik, Partizipation, Empowerment, Handlungskompetenz, qualitative Forschung, Interview, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Subjektorientierung“ in der politischen Bildung?
Es ist ein Ansatz, der die Freiheit, Emanzipation und Selbstbestimmung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, anstatt Menschen nur als Objekte von Machtstrukturen zu behandeln.
Warum ist dieser Ansatz in Zeiten der Globalisierung wichtig?
In einer Welt, die oft von ökonomischer Verwertung und Machtverhältnissen geprägt ist, hilft subjektorientierte Bildung dabei, individuelle Handlungsfähigkeit und Kritikfähigkeit zu stärken.
Welche Ziele verfolgt die subjektorientierte politische Erwachsenenbildung?
Zentrale Ziele sind Empowerment, die Förderung von Partizipation und die Beseitigung von Herrschaftsverhältnissen durch Bildung.
Welche methodische Vorgehensweise nutzt die Diplomarbeit?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, insbesondere problemzentrierte Interviews mit Akteuren der Erwachsenenbildung.
Welche Anforderungen stellt dieser Ansatz an die pädagogische Arbeit?
Er erfordert eine Neugestaltung der Rollen von Lehrenden und Lernenden, eine partizipative Gestaltung der Inhalte und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Gibt es Gefahren bei der Subjektorientierung?
Die Arbeit beleuchtet auch mögliche Probleme, wie die Gefahr der Überforderung oder die Instrumentalisierung des Subjektbegriffs.
- Arbeit zitieren
- Eike Rösch (Autor:in), 2004, Subjektorientierung in der politischen Bildung mit Erwachsenen - Programm und Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27551