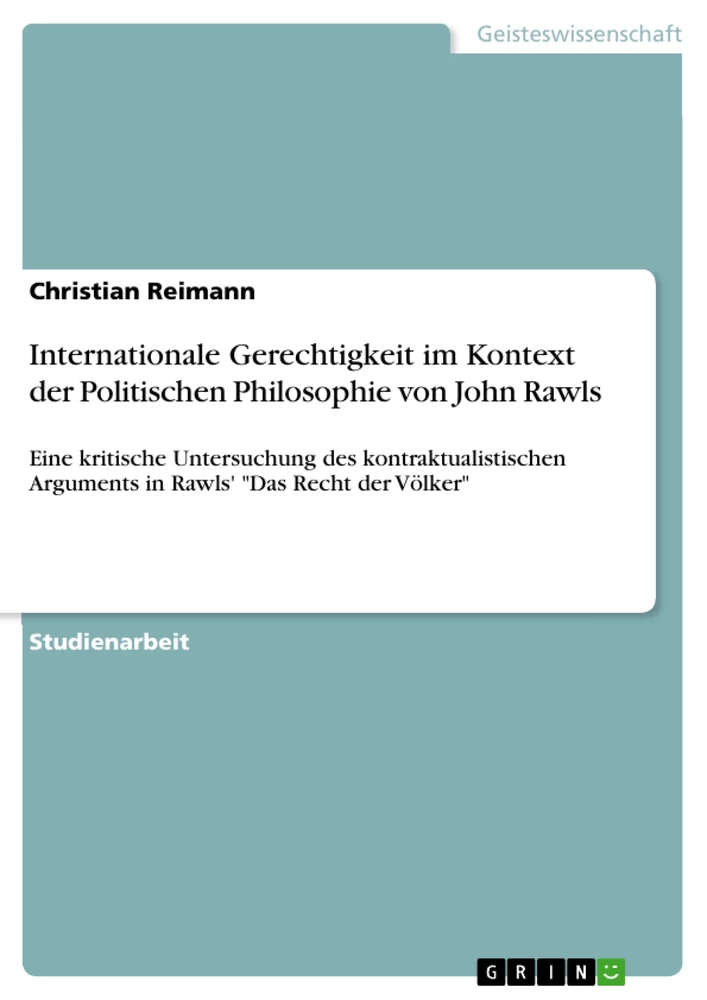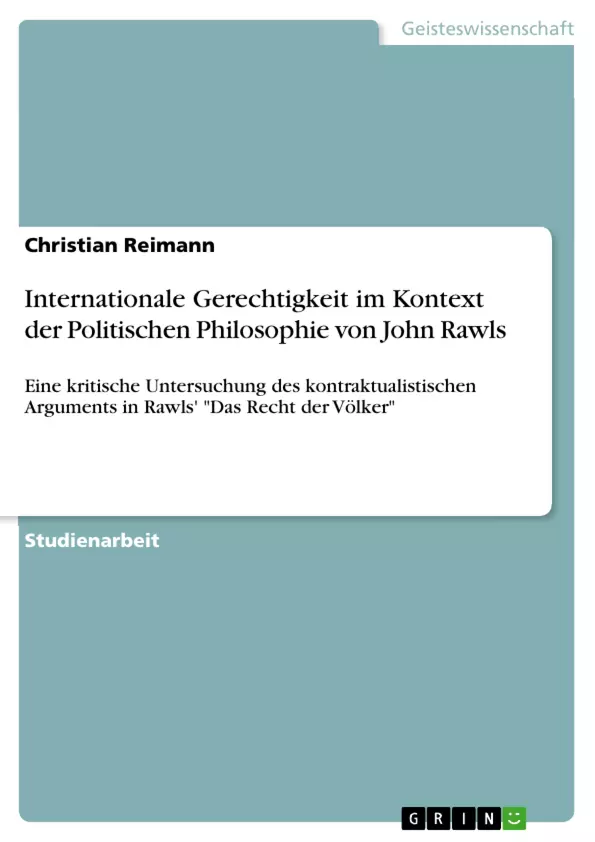Mit dem Anspruch, den moralisch kontraintuitiven Implikationen des utilitaristischen Durchschnittsnutzenprinzips entgegenzuwirken, konzipiert Rawls eine Theorie, in der die moralischen Urteile des Common Sense den Bezugspunkt zur Beurteilung von Gerechtigkeitsvorstellungen bilden (vgl. Düwell/Hübenthal/Werner 2006, S. 179). Im Ergebnis stehen zwei normative Prinzipien der Gerechtigkeit, die nach Rawls die Grundstruktur einer liberalen, d. h. konstitutionellen demokratischen Gesellschaft regulieren sollen: das Prinzip der Gleichverteilung gesellschaftlicher Grundgüter sowie das so genannte Differenzprinzip.
Zur Plausibilisierung dieser beiden Gerechtigkeitsprinzipien rekurriert Rawls in modifizierender Form auf das klassische Gedankenexperiment des Gesellschaftsvertrags: So kommen die Verteilungsgrundsätze durch ein hypothetisches (nicht faktisches) Vertragsverfahren zustande, bei welchem sich freie, vernünftige und rationale Individuen unter den fairen Bedingungen eines ursprünglichen Zustands der Gleichheit, dem so genannten Urzustand, einstimmig auf sie einigen. Auf diese Weise fungiert die Urzustandsidee für Rawls als epistemisch-heuristisches Mittel, um zu allgemein zustimmungsfähigen sowie universal gültigen Prinzipien intranationaler Gerechtigkeit zu gelangen.
Analog geht Rawls nun auch in seinem dritten Hauptwerk Das Recht der Völker (1999, deutsch: 2002) vor, wo er die Konzeption des einzelgesellschaftlichen Urzustandes auf „eine Gesellschaft von Völkern“ ausweitet (vgl. 2002, S. 1 f.) mit dem Ziel, die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit zu eruieren und damit ein „Recht der Völker“ zu entfalten, das „[…] die Grundstruktur der Beziehungen zwischen Völkern reguliert“ (ebd., S. 37). Dabei versucht Rawls, dem Kriterium einer „realistischen Utopie“ zu genügen, sofern er mit seinem Ansatz beansprucht, das, was man für gewöhnlich als die Grenzen des praktisch-politisch Möglichen ansieht, auszudehnen und in Einklang mit bestehenden politischen und sozialen Lebensbedingungen zu bringen (vgl. ebd., S. 13).
Entgegen Rawlsʼ Anspruch lässt sich in der einschlägigen Literatur jedoch der Vorwurf finden, die Rawls’sche Völkerrechtskonzeption sei weder hinreichend utopisch noch hinreichend realistisch (vgl. Bock 2008, S. 13). In der vorliegenden Arbeit geht es daher darum zu untersuchen, ob, und wenn ja, inwiefern Rawlsʼ vertragstheoretische Rechtfertigung der internationalen Gerechtigkeitsprinzipien der Idee einer realistischen Utopie widerspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rawls' kontraktualistisches Argument im Kontext internationaler Gerechtigkeit
- Die Akteure im internationalen Urzustand
- Die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit
- Rawls' Idee des internationalen Gesellschaftsvertrags — eine realistische Utopie?
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert John Rawls' Argumentation für internationale Gerechtigkeit, wie sie in seinem Werk "Das Recht der Völker" dargelegt wird. Sie befasst sich mit Rawls' kontraktualistischem Ansatz, der den Urzustand als Ausgangspunkt für die Ableitung von Prinzipien internationaler Gerechtigkeit nutzt.
- Der internationale Urzustand und seine Akteure (Völker vs. Staaten)
- Die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit nach Rawls
- Die Kritik an Rawls' Konzept der "realistischen Utopie"
- Die Rolle der Globalisierung in Rawls' Argumentation
- Die Debatte um ein globales Differenzprinzip versus die Unterstützungspflicht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung
Die Einleitung stellt John Rawls' Gerechtigkeitskonzeption und seine beiden Hauptwerke "Eine Theorie der Gerechtigkeit" und "Politischer Liberalismus" vor. Sie erläutert die beiden Gerechtigkeitsprinzipien der Gleichverteilung gesellschaftlicher Grundgüter und des Differenzprinzips, die Rawls als Grundlage für eine liberale Gesellschaft ansieht.
- Rawls' kontraktualistisches Argument im Kontext internationaler Gerechtigkeit
- Die Akteure im internationalen Urzustand
Dieses Unterkapitel beschreibt die Akteure im internationalen Urzustand nach Rawls. Rawls argumentiert, dass Völker im Gegensatz zu Staaten einen moralischen Charakter besitzen und daher geeigneter sind, über Prinzipien internationaler Gerechtigkeit zu entscheiden. Er unterscheidet zwischen liberalen und achtbaren Völkern, wobei liberale Völker durch eine konstitutionelle demokratische Regierung gekennzeichnet sind und achtbare Völker bestimmte Bedingungen des politischen Rechten und der Gerechtigkeit erfüllen.
- Die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit
Dieses Unterkapitel beleuchtet die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit, die Rawls im internationalen Urzustand ableitet. Er identifiziert acht Grundsätze, die für ihn die Grundcharta des Rechts der Völker bilden. Zu diesen Grundsätzen zählen unter anderem die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker, die Pflicht zur Vertragserfüllung, die Gleichheit der Völker und das Recht auf Selbstverteidigung. Rawls betont die Bedeutung der Reziprozität und der Achtung der Menschenrechte. Er stellt zudem drei kooperative Organisationen vor, die nach seiner Ansicht im Urzustand vereinbart werden könnten: eine Handelsorganisation, eine Zentralbank und eine Konföderation der Völker. Rawls lehnt jedoch die Möglichkeit einer Weltregierung ab, da diese seiner Meinung nach zu einem Despotismus oder einem fragilen Reich führen würde.
- Die Akteure im internationalen Urzustand
- Rawls' Idee des internationalen Gesellschaftsvertrags — eine realistische Utopie?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an Rawls' Konzept der "realistischen Utopie". Es werden verschiedene Einwände gegen seine Argumentation erhoben, die sich auf die Bestimmung der Akteure im internationalen Urzustand, die Praktikabilität seiner Konzeption und die Rolle der Globalisierung beziehen. Die Kritik wirft Rawls vor, seine Konzeption zu idealistisch und nicht ausreichend realistisch zu sein, da er die vielfältigen Herausforderungen der Globalisierung nicht hinreichend berücksichtigt. Zudem wird argumentiert, dass Rawls' Fokus auf die Stabilität von Gesellschaften statt auf das Wohlergehen von Kosmopoliten zu einer Vernachlässigung der globalen Gerechtigkeitsdimension führt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die internationale Gerechtigkeit, den Gerechtigkeitskontraktualismus, John Rawls, "Das Recht der Völker", den internationalen Urzustand, liberale und achtbare Völker, die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die Unterstützungspflicht, das globale Differenzprinzip, die Weltregierung, die Globalisierung und die "realistische Utopie".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht John Rawls unter einem „Recht der Völker“?
Es ist eine Konzeption internationaler Gerechtigkeit, die die Grundstruktur der Beziehungen zwischen Völkern durch allgemein zustimmungsfähige Prinzipien regulieren soll.
Was ist der „internationale Urzustand“?
Ein Gedankenexperiment, bei dem Vertreter von Völkern hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ faire Prinzipien für ihr Zusammenleben vereinbaren.
Warum unterscheidet Rawls zwischen Völkern und Staaten?
Für Rawls besitzen Völker einen moralischen Charakter und handeln nach dem Kriterium der Reziprozität, während Staaten oft rein machtorientiert agieren.
Was bedeutet der Begriff „realistische Utopie“ bei Rawls?
Es beschreibt den Anspruch, politisch-ideale Ziele zu verfolgen, die dennoch mit den realen Bedingungen und der menschlichen Natur vereinbar sind.
Warum lehnt Rawls ein globales Differenzprinzip ab?
Rawls befürwortet stattdessen eine „Unterstützungspflicht“ für belastete Gesellschaften, um deren Autonomie zu fördern, statt eine dauerhafte globale Umverteilung zu fordern.
Welche Rolle spielen die Menschenrechte im Völkerrecht von Rawls?
Menschenrechte sind für Rawls eine notwendige Bedingung für die Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Völker und begrenzen die interne Souveränität von Staaten.
- Quote paper
- Christian Reimann (Author), 2014, Internationale Gerechtigkeit im Kontext der Politischen Philosophie von John Rawls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275512