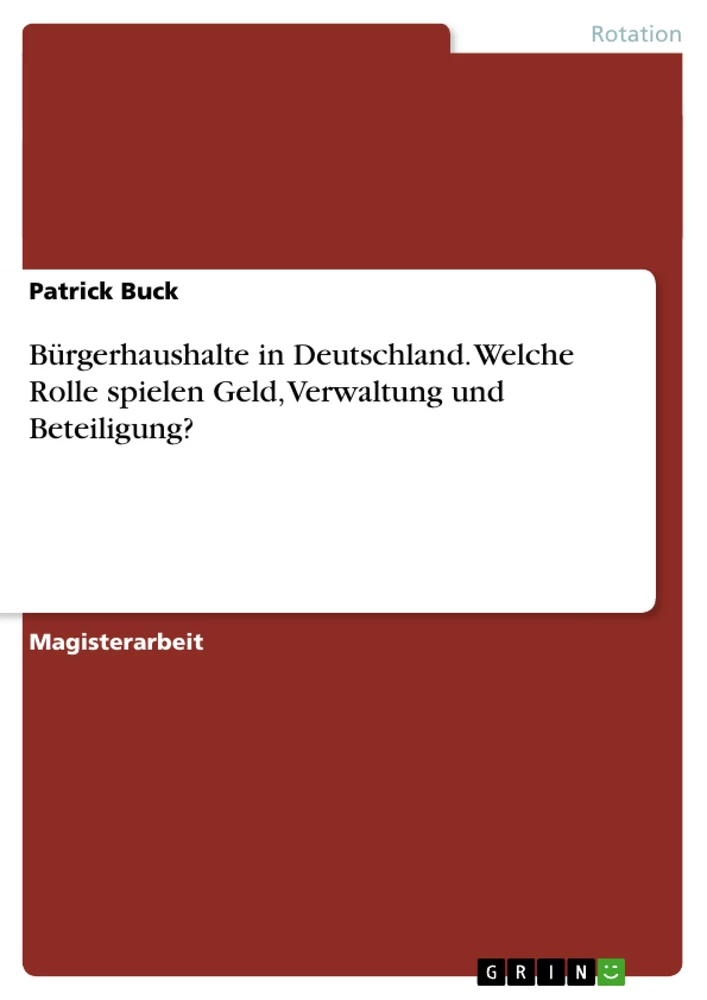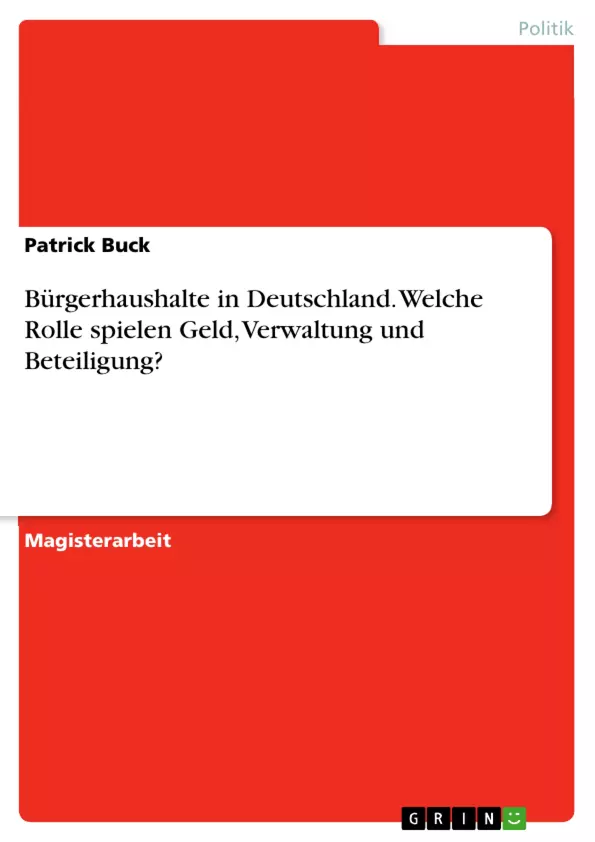Bürgerhaushalte haben sich im Bereich der Finanzierungsplanung einer Kommune mit Hilfe von partizipativen Instrumenten in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten einen Namen gemacht. Die Idee stammt aus Brasilien, doch sie findet sich heute in zahlreichen Variationen weltweit wieder. Allegretti bezeichnet sie unter dem Titelthema „Für Mutige – 18 Dinge, die die Welt verändern“ als „eine der erfolgreichsten demokratischen Erneuerungen der letzten 25 Jahre“ sowie als „Erfolgsgeschichte über alle fünf Kontinente hinweg“. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Lobeshymnen, vor allem aus den Reihen der daran Beteiligten, welche die Möglichkeit sehen, informierte und engagierte Bürger an politischen Prozessen und Entscheidungen zu beteiligen.
Entscheidend an Beteiligung ist natürlich, ob sie Ergebnisse nach sich zieht. Ansonsten ist der Prozess der Mitwirkung obsolet. Auch der Bürgerhaushalt, der Vorschläge für den Finanzplan der Kommunen sammelt, bringt Ergebnisse mit sich – aus Sicht der Bürger mal gute, mal schlechte. Wie viele der Ideen aus den Reihen der städtischen Anwohner tatsächlich umgesetzt werden, ist höchst verschieden. Letztendlich ist dies eine Entscheidung des Rates, denn die gewählten Repräsentanten behalten weiterhin die Hoheit über das Budget. Zu klären ist, von welchen Faktoren es abhängt, ob die Bürgervorschläge tatsächlich politische Zustimmung erhalten. Im Rahmen dieser Arbeit sollen Ansätze gefunden werden, welche Einflussfaktoren in Deutschland dafür in Frage kommen. Untersucht wird hierbei der Einfluss
a) der Finanzsituation einer Kommune,
b) der Anzahl der Teilnehmer an einem Bürgerhaushalt sowie
c) der Vorgaben der Verwaltung.
Im Blick sind dabei die Verfahren in den Kommunen Köln, Oldenburg, Potsdam, Münster und Trier.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Betrachtungen
- 2.1 Entwicklung der Bürgerbeteiligung
- 2.2 Theoretische Einordnung
- 2.3 Geschichte des Bürgerhaushalts
- 2.3.1 Typologie des Bürgerhaushalts
- 2.3.2 Methodologische Definition des Bürgerhaushalts
- 2.3.3 Der deutsche Weg
- 2.3.4 Ziele von Bürgerhaushalten
- 2.3.5 Kritik am Bürgerhaushalt
- 3. Welche Faktoren beeinflussen den Bürgerhaushalt?
- 3.1 Fragestellung
- 3.2 Entwicklung der Hypothesen
- 3.2.1 Hypothese 1: Einflussfaktor Kommunalfinanzen
- 3.2.2 Hypothese 2: Einflussfaktor Beteiligung
- 3.2.3 Hypothese 3: Einflussfaktor dominante Verwaltung
- 3.3 Auswahl der Bürgerhaushalte
- 3.4 Beschreibung der Bürgerhaushaltsverfahren
- 3.5 Datengewinnung
- 3.6 Datenauswertung
- 3.6.1 Überprüfung von Hypothese 1
- 3.6.2 Überprüfung von Hypothese 2
- 3.6.3 Überprüfung von Hypothese 3
- 3.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit untersucht die Einflussfaktoren für kommunale Bürgerhaushalte in Stadt- und Gemeindeparlamenten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Determinanten der politischen Zustimmung zu Bürgervorschlägen im Rahmen von Bürgerhaushalten zu analysieren.
- Entwicklung und theoretische Einordnung von Bürgerbeteiligungsprozessen
- Geschichte und Definition des Bürgerhaushalts
- Hypothesen zur Analyse von Einflussfaktoren auf die politische Zustimmung zu Bürgervorschlägen
- Empirische Untersuchung von Bürgerhaushalten in ausgewählten Städten
- Zusammenfassung und Ausblick auf die Bedeutung von Bürgerhaushalten für die kommunale Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema Bürgerhaushalte und stellt die Relevanz der Bürgerbeteiligung in kommunalen Entscheidungsprozessen dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Bürgerbeteiligung und Bürgerhaushalten. Die Entwicklung der Bürgerbeteiligung in Deutschland wird ebenso beleuchtet wie die theoretischen Konzepte, denen der Bürgerhaushalt unterliegt. Die Geschichte des Bürgerhaushalts wird dargestellt, ebenso wie seine Definition und die in Deutschland verbreitete Variante. Die Ziele und Kritikpunkte von Bürgerhaushalten werden ebenfalls in diesem Kapitel diskutiert.
Kapitel 3 beinhaltet die empirische Untersuchung. Drei Hypothesen werden formuliert, die die Verschuldung, die Teilnehmerzahlen und die Vorgaben der Verwaltung als Einflussfaktoren auf den Erfolg von Bürgerhaushalten betrachten. Die Untersuchung analysiert die Verfahren in den Städten Köln, Trier, Oldenburg, Potsdam und Münster, wobei quantifizierbare Daten aus den Rechenschaftsberichten herangezogen werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalt, kommunale Finanzen, politische Entscheidungsprozesse, Einflussfaktoren und empirische Analyse. Wichtige Konzepte sind die kooperative Demokratie, die Bürgerkommune und die Analyse von Einflussfaktoren auf die politische Zustimmung zu Bürgervorschlägen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Bürgerhaushalt?
Ein Bürgerhaushalt ist ein partizipatives Instrument, bei dem Bürger Vorschläge zur Finanzplanung ihrer Kommune einbringen und über die Verwendung öffentlicher Mittel mitdiskutieren können.
Woher stammt die Idee des Bürgerhaushalts?
Die Idee hat ihren Ursprung in Brasilien (Porto Alegre) und gilt heute weltweit als eine der erfolgreichsten demokratischen Erneuerungen der letzten Jahrzehnte.
Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung von Bürgervorschlägen?
Wesentliche Einflussfaktoren sind die Finanzsituation der Kommune, die Anzahl der beteiligten Bürger und die Vorgaben bzw. Offenheit der Verwaltung.
Behalten Politiker die Hoheit über das Budget?
Ja, in Deutschland behalten die gewählten Stadträte weiterhin die rechtliche Hoheit über das Budget; der Bürgerhaushalt hat in der Regel eine beratende Funktion.
Welche Städte in Deutschland nutzen Bürgerhaushalte?
Zu den Städten mit bekannten Verfahren gehören unter anderem Köln, Potsdam, Münster, Oldenburg und Trier.
- Arbeit zitieren
- Patrick Buck (Autor:in), 2014, Bürgerhaushalte in Deutschland. Welche Rolle spielen Geld, Verwaltung und Beteiligung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275610