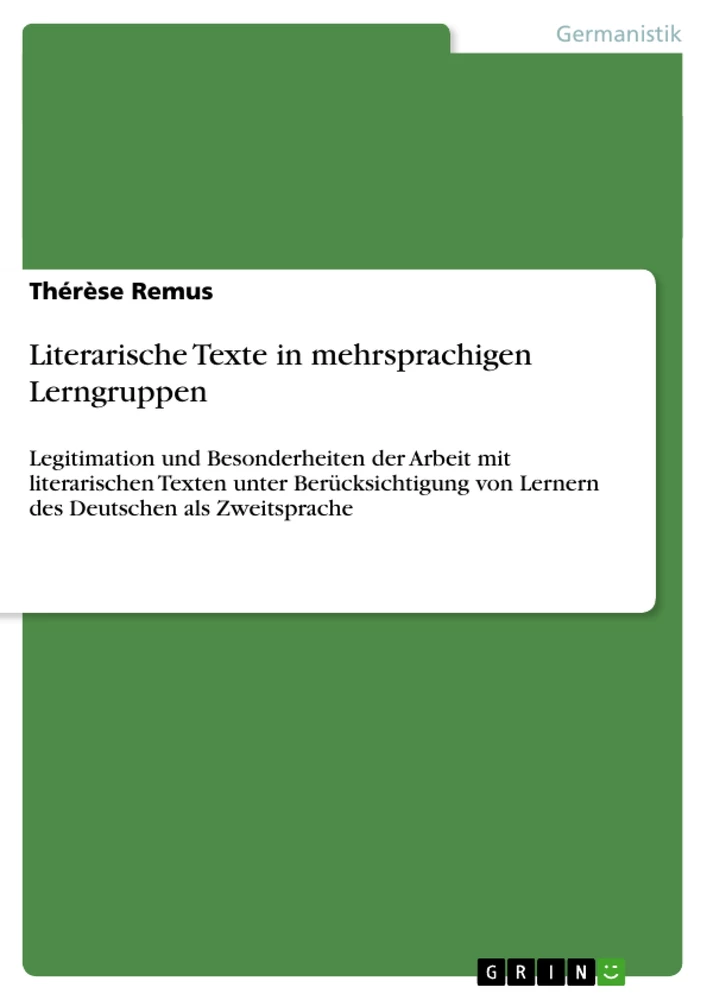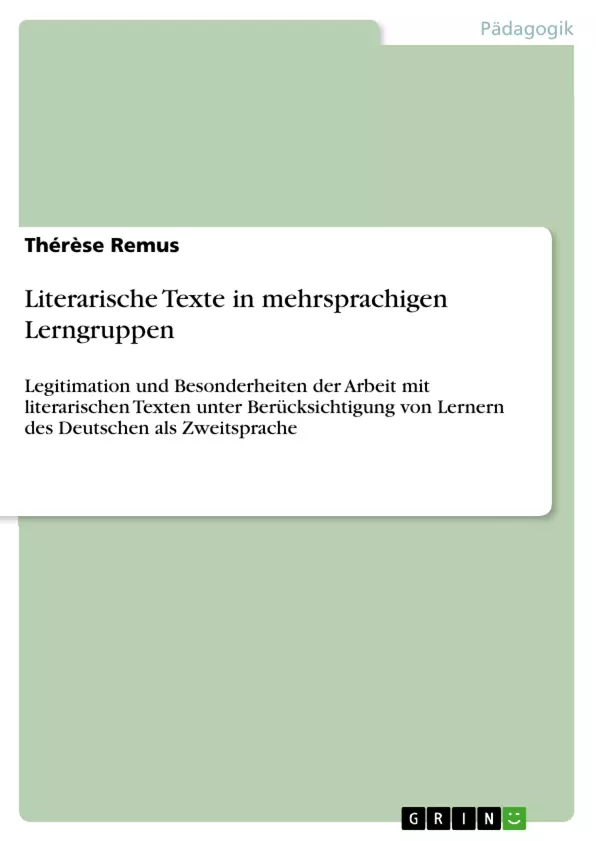Jeder Unterrichtsgegenstand muss sich mit Relevanz für den Lerner legitimieren lassen. So mögen Einwände gegen die Beschäftigung mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht u. a. darauf abzielen, dass die funktionale Dimension der Sprache im Sinne der Kommunikationskompetenz als übergeordnete Zielstellung beim Erlernen einer Fremdsprache für den Lerner relevanter sei als die ästhetische Spezifik literarischer Texte. Doch haben wir es mit Blick auf DaZ-Schüler mit einer besonderen Lernerschaft zu tun, deren Spracherwerbsprozess sich in vielerlei Hinsicht von dem der Fremdsprachenlerner unterscheidet. Da DaZ-Lerner i.d.R. eine deutsche Schul- und Arbeitslaufbahn durchlaufen, gehen die Anforderung an ihren Zweitspracherwerb über die des Fremdspracherwerbs hinaus, indem idealiter das Sprachniveau eines Muttersprachlers erreicht werden soll. Auch sind sie Teilnehmer des „normalen“ Deutschunterrichts und können sich den Anforderungen des Rahmenlehrplans nicht entziehen. Genau aus diesem Grund greift der Anspruch an eine (minimal) funktionale Sprachkompetenz, die ein (Sprach-)Handeln in alltäglichen Situationen ermöglicht, im Falle von DaZ-Lernern zu kurz. Sie verfügen in Form ihres „Ethnolekts“ bzw. ihrer „Interlanguage“ bereits über ein funktionales Sprachrepertoire des Deutschen, das sich „auf die bedeutungstragenden Elemente der Sprache konzentriert, Wörter aus der Herkunftssprache einbezieht und Funktionswörter […] weglässt.“ Allerdings zeigt sich, dass diese im alltäglichen mündlichen Sprachgebrauch durchaus funktionalen Kompetenzen keinesfalls für die schriftsprachlichen Anforderungen, die fachübergreifend und auch über die Schullaufbahn hinaus wirken, ausreichend sind.
Die Arbeit mit literarischen Texten kann hier ansetzen, da diese gerade durch ihre poetische Abgrenzung zur Funktionalität der Alltagssprache Raum und Anlass bieten, sich einer vertieften Beschäftigung mit den gefundenen sprachlichen Mitteln sowie der Reflexion über Sprache zu widmen. Literatur – als ästhetische Verarbeitung einer Sicht auf die Welt – bietet die Chance, das Sprachbewusstsein der Schüler zu entwickeln und zu fördern, da andere Aspekte als die funktionale Dimension der Sprache in den Vordergrund der Spracharbeit rücken.
Inhaltsverzeichnis
- Warum Literatur?
- Didaktische Konsequenzen
- Literatur
- Warum Literatur?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Legitimation und den Besonderheiten der Arbeit mit literarischen Texten im Deutschunterricht für Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie analysiert die Relevanz literarischen Lernens für DaZ-Schüler im Vergleich zu Schülern, die Deutsch als Fremdsprache (DaF) lernen. Die Arbeit beleuchtet die didaktischen Konsequenzen, die sich aus der Arbeit mit literarischen Texten im DaZ-Unterricht ergeben, und stellt die Notwendigkeit einer integrativen Sprachdidaktik heraus.
- Die Relevanz von Literatur im DaZ-Unterricht
- Die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs im Vergleich zum Fremdspracherwerb
- Die didaktischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Arbeit mit literarischen Texten im DaZ-Unterricht
- Die Bedeutung der Sprachsensibilität und Vorentlastung im Umgang mit literarischen Texten
- Die Notwendigkeit einer integrativen Sprachdidaktik, die Inhalte des Literatur- und Sachunterrichts in die Sprachförderung einbezieht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Frage, warum Literatur im Deutschunterricht relevant ist, insbesondere für DaZ-Schüler. Es werden Argumente gegen die Beschäftigung mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht aufgezeigt und die besonderen Herausforderungen des Zweitspracherwerbs im Vergleich zum Fremdspracherwerb beleuchtet. Die Arbeit mit literarischen Texten bietet DaZ-Schülern die Möglichkeit, ihr Sprachbewusstsein zu entwickeln, ihre Sprachkompetenz zu erweitern und die emotionale und affektive Komponente des Lernprozesses zu fördern. Die Arbeit mit literarischen Texten kann zudem als motivierendes Gegengewicht zum alltäglichen Sprachgebrauch dienen und die Schüler dazu anregen, ihre eigenen Standpunkte zu reflektieren. Darüber hinaus bietet die Offenheit literarischer Texte Anlass für interkulturelles Lernen und die Aktivierung des Wortschatzes.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den didaktischen Konsequenzen, die sich aus der Arbeit mit literarischen Texten im DaZ-Unterricht ergeben. Es wird betont, dass die Planung der Arbeit mit literarischen Texten eine besondere Sensibilität für die Fähigkeiten und Bedürfnisse der DaZ-Lerner erfordert. Die Arbeit mit literarischen Texten sollte jedoch nicht zu einer sinnentleerten Instrumentalisierung der Literatur für Zwecke der Spracharbeit führen. Es ist wichtig, die Spezifik des Zweitspracherwerbs zu berücksichtigen und mit einer systematischen Sprachvermittlung, die auch die Arbeit mit literarischen Texten umfasst, den unsystematischen Spracherwerb der Schüler in der alltäglichen Kommunikation zu ergänzen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Deutsch als Zweitsprache (DaZ), literarische Texte, Sprachvermittlung, didaktische Konsequenzen, integrative Sprachdidaktik, Sprachbewusstsein, Sprachkompetenz, Vorentlastung, interkulturelles Lernen und Wortschatzarbeit. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz von Literatur im DaZ-Unterricht und die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs im Vergleich zum Fremdspracherwerb. Sie zeigt die Herausforderungen und Möglichkeiten der Arbeit mit literarischen Texten im DaZ-Unterricht auf und betont die Notwendigkeit einer integrativen Sprachdidaktik, die Inhalte des Literatur- und Sachunterrichts in die Sprachförderung einbezieht.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Literatur im DaZ-Unterricht wichtig?
Literatur bietet DaZ-Schülern (Deutsch als Zweitsprache) Anlass zur Reflexion über Sprache, fördert das Sprachbewusstsein jenseits der Alltagssprache und ermöglicht interkulturelles Lernen.
Was unterscheidet DaZ-Lerner von Fremdsprachenlernern (DaF)?
DaZ-Lerner leben in Deutschland und müssen das Sprachniveau von Muttersprachlern anstreben, um in Schule und Beruf erfolgreich zu sein, während DaF-Lerner oft nur eine funktionale Kommunikationskompetenz benötigen.
Was ist eine „Interlanguage“ bei DaZ-Schülern?
Es handelt sich um ein funktionales Sprachrepertoire, das sich auf bedeutungstragende Elemente konzentriert, oft aber Lücken bei Funktionswörtern oder grammatikalischen Feinheiten aufweist.
Welche didaktischen Konsequenzen hat die Arbeit mit Literatur?
Lehrkräfte müssen Texte sorgfältig auswählen, Vorentlastungen (Wortschatzarbeit) anbieten und darauf achten, dass die Literatur nicht rein für grammatikalische Übungen instrumentalisiert wird.
Was bedeutet integrative Sprachdidaktik?
Dabei werden fachliche Inhalte (z.B. aus dem Sachunterricht) und ästhetische Inhalte (Literatur) direkt mit der systematischen Sprachförderung verknüpft.
- Quote paper
- Thérèse Remus (Author), 2013, Literarische Texte in mehrsprachigen Lerngruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275635