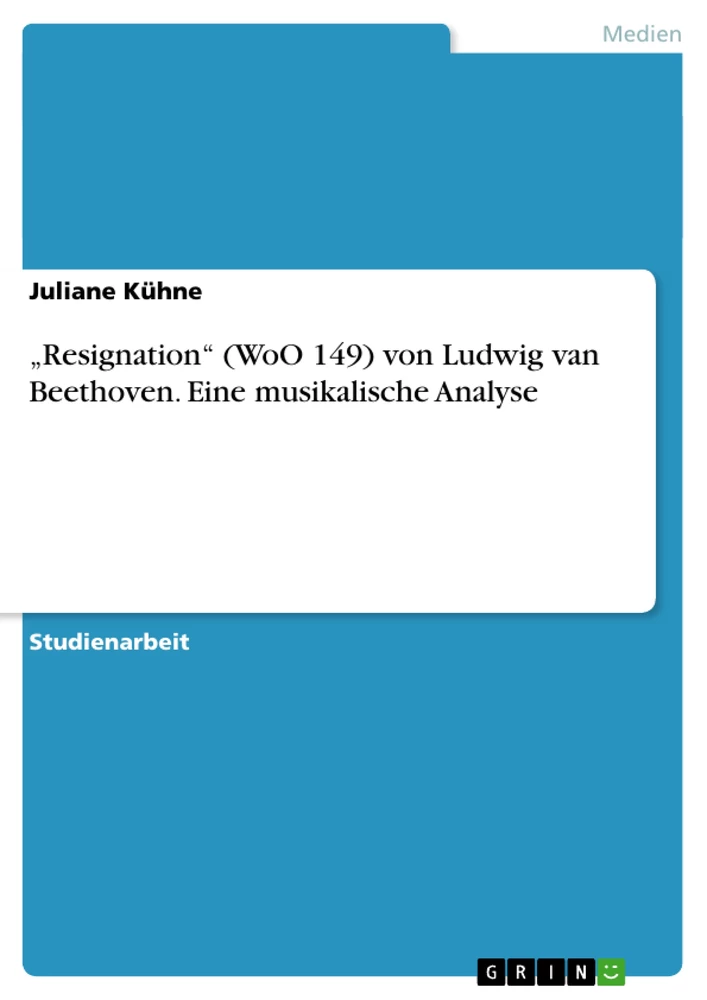Die im Seminar untersuchte musikalische Epoche ist mir – wahrscheinlich auch durch mein Blockflötenstudium bedingt – nicht ganz so vertraut wie die Barockzeit oder die Musik des 20.
Jahrhunderts. Innerhalb dieser Epoche schien mir bisher immer Schubert näher zu liegen als Beethoven, da ich noch lebhafte Erinnerungen an die Behandlung der Winterreise während meiner
Abiturzeit habe und mir damals die über Hans Zenders Interpretation vermittelte Idee der „historischen Ohren“ eine Art Offenbarung war. Von Beethoven als Liederkomponisten wusste ich nur, dass oft gesagt wird, er verstünde es weniger gut, gesanglich-sängerisch zu komponieren. Von diesem Beethovenlied wurde ich durch den Titel sofort angesprochen. Es ist auch der Titel eines Bildes von Francisco de Goya, das bei mir zu Hause hängt. Was mich an dem Motiv so
fasziniert, ist die Ambivalenz, die es ausstrahlt: Da ist zwar einerseits der unverkennbar niederzwingende Gestus der Resignation, andererseits verströmt es aber auch eine große innere Ruhe, die völlig frei von Schmerz zu sein scheint. Ich war neugierig, ob ich etwas davon auch in Beethovens Lied finden würde oder ob er „Resignation“ ganz anders interpretiert.
Bei der Analyse habe ich versucht, erst einmal meine eigenen Eindrücke zu Papier zu bringen, bevor ich mich mit der vorhandenen Literatur zu diesem Stück beschäftigt habe. Einige Dinge, die mir auffällig erschienen, müssen für Menschen, die sich schon länger mit Beethoven beschäftigen, nicht zwingend auffallend sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erste Annäherung
- Das Gedicht von Paul Graf von Haugwitz
- Musikalische Analyse – Die Vertonung Beethovens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Beethovens Vertonung des Gedichts „Resignation“ von Paul Graf von Haugwitz. Ziel ist es, Beethovens musikalische Interpretation des Themas Resignation zu untersuchen und im Kontext des Gedichts und der historischen Epoche zu betrachten. Die Analyse berücksichtigt die eigene Wahrnehmung der Musik und bezieht vorhandene Literatur ein.
- Beethovens musikalische Umsetzung des Gedichts "Resignation"
- Der Begriff "Resignation" im historischen und philosophischen Kontext
- Vergleich zwischen musikalischer und literarischer Interpretation von Resignation
- Beethovens Kompositionsstil im Kontext seiner Lieder
- Die Rolle des Textes in Beethovens musikalischer Gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die anfängliche Vertrautheit der Autorin mit der musikalischen Epoche Beethovens und ihre Faszination für das Motiv der Resignation, sowohl im Gemälde Goyas als auch in der Aussicht auf eine musikalische Interpretation Beethovens. Sie skizziert ihren methodischen Ansatz, der von persönlichen Eindrücken ausgeht und sich dann mit bestehender Literatur auseinandersetzt.
Erste Annäherung: Dieses Kapitel beleuchtet die semantische Bedeutung des Wortes „Resignation“, abgeleitet vom lateinischen „re-signare“. Es werden verschiedene Aspekte der Resignation erörtert, von der Kapitulation bis zur weisen Bescheidung, sowie die historische Konnotation im Kontext der mittelalterlichen Mystik und ihre Verbindung mit dem Begriff „Gelassenheit“. Der aktive Aspekt der Resignation, das bewusste Nicht-Einlassen auf bestimmte Folgen, wird besonders hervorgehoben.
Das Gedicht von Paul Graf von Haugwitz: Dieser Abschnitt präsentiert biographische Informationen über Paul Graf von Haugwitz und beleuchtet dessen Kontext zur Entstehungszeit des Gedichts. Er beschreibt Beethovens Umgang mit zeitgenössischen Dichtern und die möglichen Wege, wie Beethoven mit dem Gedicht in Kontakt kam. Die Datierung des Gedichts und mögliche Verbindungen zu Beethovens Entstehungsprozess der Komposition werden diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zu "Beethovens Vertonung von Haugwitz' 'Resignation'"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Beethovens musikalische Interpretation des Gedichts "Resignation" von Paul Graf von Haugwitz. Sie untersucht Beethovens Umsetzung des Themas Resignation im musikalischen Kontext, betrachtet die historische Epoche und bezieht sowohl persönliche Eindrücke der Autorin als auch vorhandene Literatur ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Beethovens musikalische Umsetzung des Gedichts, den Begriff "Resignation" im historischen und philosophischen Kontext, einen Vergleich zwischen musikalischer und literarischer Interpretation von Resignation, Beethovens Kompositionsstil im Kontext seiner Lieder und die Rolle des Textes in Beethovens musikalischer Gestaltung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine erste Annäherung an das Thema Resignation, eine Analyse des Gedichts von Paul Graf von Haugwitz, eine musikalische Analyse von Beethovens Vertonung und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Autorin. Die erste Annäherung beleuchtet die semantische Bedeutung von "Resignation". Das Kapitel zum Gedicht beinhaltet biographische Informationen über Haugwitz und die Entstehungsgeschichte des Gedichts. Die musikalische Analyse fokussiert sich auf Beethovens Interpretation. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen (obwohl der Inhalt des Fazits hier nicht detailliert beschrieben ist).
Wie wird der Begriff "Resignation" betrachtet?
Der Begriff "Resignation" wird umfassend untersucht, von seiner lateinischen Herkunft ("re-signare") über verschiedene Aspekte wie Kapitulation und weise Bescheidung bis hin zu seiner historischen Konnotation im Kontext der mittelalterlichen Mystik und seiner Verbindung zu "Gelassenheit". Der aktive Aspekt der Resignation, das bewusste Nicht-Einlassen auf Folgen, wird besonders hervorgehoben.
Welche Informationen werden über Paul Graf von Haugwitz und sein Gedicht gegeben?
Die Arbeit bietet biographische Informationen über Paul Graf von Haugwitz und den Kontext zur Entstehungszeit seines Gedichts "Resignation". Sie diskutiert Beethovens Umgang mit zeitgenössischen Dichtern, mögliche Wege, wie Beethoven mit dem Gedicht in Kontakt kam, sowie die Datierung des Gedichts und mögliche Verbindungen zu Beethovens Entstehungsprozess der Komposition.
Welchen methodischen Ansatz verfolgt die Autorin?
Die Autorin kombiniert einen persönlichen Zugang zu dem Thema mit einer Auseinandersetzung mit bestehender Literatur. Sie beginnt mit ihren eigenen Eindrücken und Wahrnehmungen der Musik, bevor sie diese mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Analysen vergleicht und kontextualisiert.
- Citation du texte
- Juliane Kühne (Auteur), 2014, „Resignation“ (WoO 149) von Ludwig van Beethoven. Eine musikalische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275640