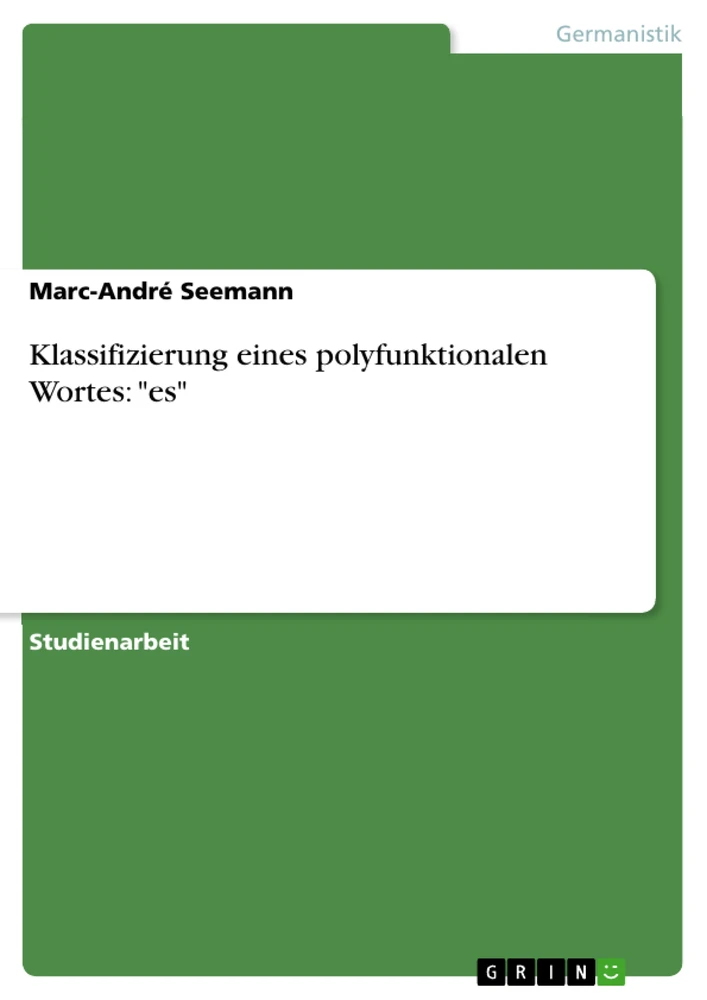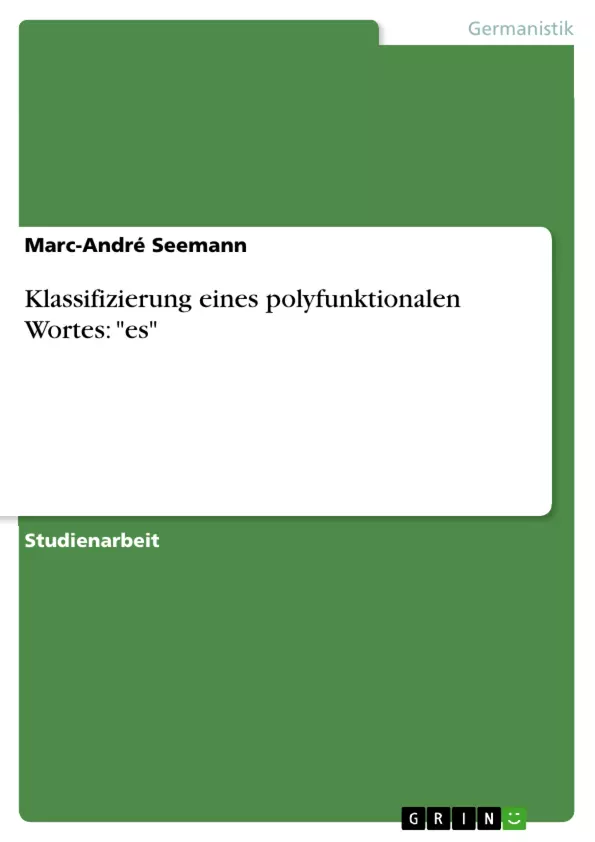Das polyfunktionale "es" ist eines der größten Sprachgeheimnisse der deutschen Grammatik. Schon früh gab es Linguisten, wie Brugmann (1917) und Paul (1917), die sich mit diesem Wort auseinandersetzten. Weitere Linguisten, wie Pütz (1975), der eine ganze Monographie dem Wort "es" widmet, Köhler (1976), Müller (1991), Zifonun (1995) und Eisenberg (1999), Suchsland (2000) und Sudhoff (2003), die spezielle Untersuchungen zu diesem Wort vornahmen, folgten. Da die Verwendungsweise von es so polyfunktional ist, sprich, es kommt als Pronomen, als Proform, als Korrelat, als formales Argument und als Positionales-es vor, werde ich mich mit der folgenden Frage beschäftigen: „Wie sind die einzelnen es-Typen systematisch voneinander abgegrenzt?“
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Typen von es
- 2.1 Pronomen-es
- 2.2 Proform-es
- 2.2.1 Nicht-Kopulakonstruktion
- 2.2.2 Kopulakonstruktionen
- 2.3 Korrelat-es
- 2.4 Quasi-Argument-es
- 2.5 Positionales-es
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die polyfunktionale Verwendung des Wortes "es" in der deutschen Sprache. Ziel ist es, die verschiedenen Typen von "es" systematisch voneinander abzugrenzen und zu kategorisieren.
- Klassifizierung der verschiedenen "es"-Typen
- Unterscheidung zwischen Pronomen-es, Proform-es, Korrelat-es, Quasi-Argument-es und Positionales-es
- Analyse der syntaktischen und semantischen Eigenschaften der einzelnen "es"-Typen
- Systematische Kategorisierung der verschiedenen Funktionen von "es"
- Behandlung der morpho-syntaktischen Merkmale von "es"
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der polyfunktionalen Verwendung des Wortes "es" in der deutschen Grammatik ein und benennt die Forschungsfrage: Wie sind die einzelnen "es"-Typen systematisch voneinander abgegrenzt? Sie erwähnt frühere linguistische Arbeiten zu diesem Thema und stellt die verschiedenen Funktionen von "es" (Pronomen, Proform, Korrelat, formales Argument, Positionales-es) vor. Die Einleitung betont den komplexen und vielschichtigen Charakter des Wortes "es" und begründet damit die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung.
2 Typen von es: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Typen von "es" und deren Unterscheidungsmerkmale. Es werden anhand von Beispielsätzen die unterschiedlichen Funktionen von "es" veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der systematischen Kategorisierung und Abgrenzung der einzelnen "es"-Typen, um einen klaren Rahmen für die spätere detaillierte Analyse zu schaffen. Die Beispiele sollen die Bandbreite der Verwendung von "es" aufzeigen und die Komplexität des Themas verdeutlichen.
2.1 Pronomen-es: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verwendung von "es" als Pronomen. Es werden die Merkmale des Pronomen-es, wie seine Kasus- und Phi-Merkmale sowie sein referentieller Charakter, ausführlich beschrieben und anhand von Beispielsätzen illustriert. Die Diskussion beleuchtet die Positionierung von "es" im Satz, sowohl im Nominativ als auch im Akkusativ, und die Besonderheiten seiner Verwendung mit Präpositionen. Der Abschnitt vergleicht die Eigenschaften des Pronomen-es mit anderen "es"-Typen und betont die eindeutige Abgrenzung zur Proform-es.
Schlüsselwörter
Polyfunktionalität, Pronomen, Proform, Korrelat, Quasi-Argument, Positionales-es, Deutsche Grammatik, Syntax, Morpho-Syntax, Phi-Merkmale, Referenz, Kasus, Determinansphrase (DP).
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Polyfunktionale Verwendung von "es" im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die vielseitigen Funktionen des Wortes "es" in der deutschen Sprache. Sie konzentriert sich auf die systematische Klassifizierung und Abgrenzung der verschiedenen "es"-Typen.
Welche "es"-Typen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Pronomen-es, Proform-es (inkl. Nicht-Kopula- und Kopulakonstruktionen), Korrelat-es, Quasi-Argument-es und Positionales-es. Jeder Typ wird detailliert analysiert und anhand von Beispielen illustriert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die systematische Kategorisierung der verschiedenen "es"-Funktionen. Die Arbeit soll die syntaktischen und semantischen Eigenschaften jedes Typs beleuchten und eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Typen schaffen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptkapitel ("Typen von es" mit Unterkapiteln zu den einzelnen "es"-Typen) und einem Fazit. Die Einleitung stellt das Thema vor und skizziert den Forschungsansatz. Das Hauptkapitel analysiert die verschiedenen "es"-Typen detailliert. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie werden die verschiedenen "es"-Typen unterschieden?
Die Unterscheidung erfolgt anhand syntaktischer und semantischer Kriterien. Betrachtet werden Merkmale wie Kasus, Phi-Merkmale, Referenz, Position im Satz und die Rolle von "es" im Satzbau (z.B. als formales Subjekt).
Welche morpho-syntaktischen Merkmale von "es" werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Kasusmerkmale von "es", seine Phi-Merkmale (Person, Numerus, Genus) und seine Rolle in verschiedenen syntaktischen Kontexten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polyfunktionalität, Pronomen, Proform, Korrelat, Quasi-Argument, Positionales-es, Deutsche Grammatik, Syntax, Morpho-Syntax, Phi-Merkmale, Referenz, Kasus, Determinansphrase (DP).
Welche Aspekte des Pronomen-es werden behandelt?
Der Abschnitt zum Pronomen-es beschreibt dessen Kasus- und Phi-Merkmale, seinen referentiellen Charakter, seine Position im Satz (Nominativ, Akkusativ) und seine Verwendung mit Präpositionen. Ein Vergleich mit anderen "es"-Typen wird ebenfalls durchgeführt.
Gibt es Beispiele in der Arbeit?
Ja, die Arbeit verwendet zahlreiche Beispielsätze, um die verschiedenen "es"-Typen zu illustrieren und ihre Funktionen zu verdeutlichen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist primär für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit deutscher Grammatik und Syntax beschäftigt. Sie eignet sich für Linguistikstudenten und -forscher.
- Quote paper
- Marc-André Seemann (Author), 2013, Klassifizierung eines polyfunktionalen Wortes: "es", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275649