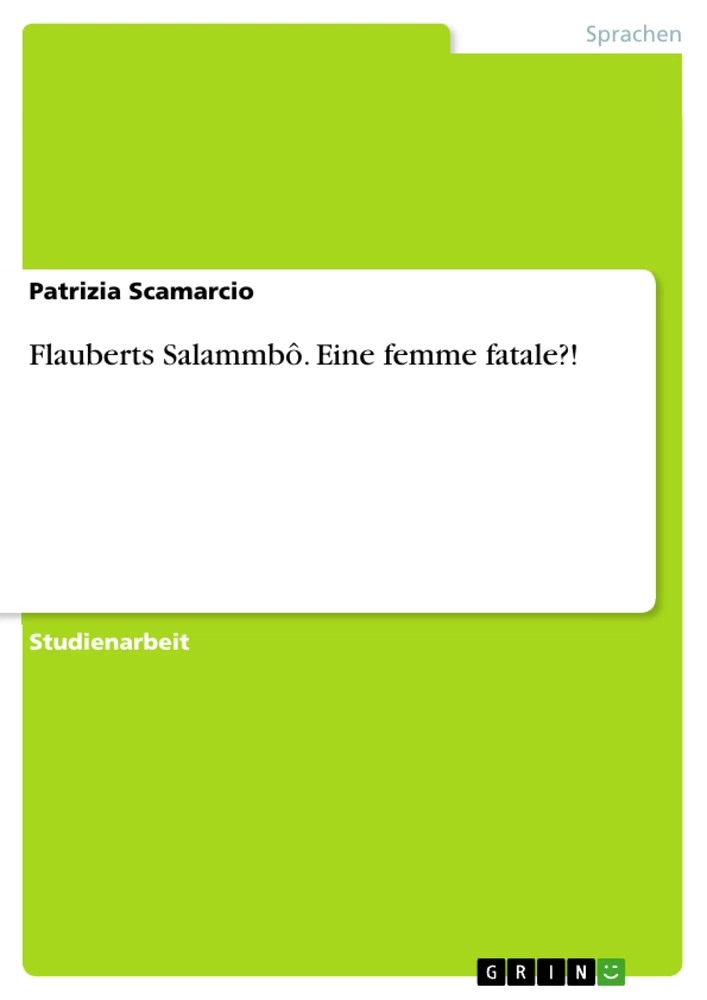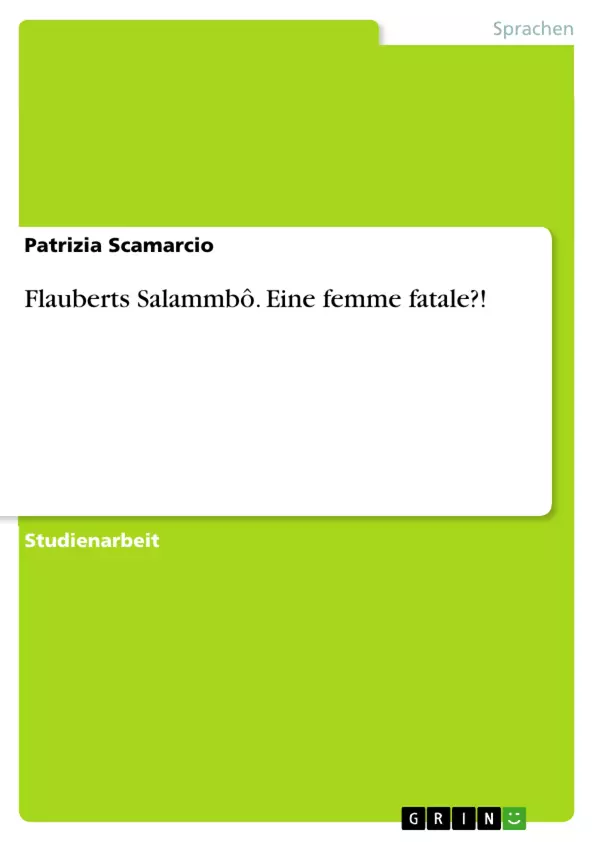Unter den verschiedenen Rollen, die eine Frau bei einer Liebesbeziehung spielen kann, hat die Literatur auch diejenige zu einem traditionsbildenden Schema ausgeformt, die der Frau eine unwiderstehliche Anziehungskraft und einen magisch-dämonischen Charakter zuschreibt, durch die sie den Mann nicht nur erotisch an sich bindet, sondern ihn auch von seinen höheren Interessen und Aufgaben ablenkt, seine Moral untergräbt und ihn meist ins Unglück stürzt.
Dieses eben beschriebene Bild des Weiblichen, das auch den Namen „dämonische Verführerin“ trägt oder in Anlehnung an John Keats Gedicht als „la belle dame sans merci“ bezeichnet wird, findet man seit jeher in der Literatur.
Auch Salammbô stürzt Mâtho ins Verderben. Sein Tod wird als ihr Werk betrachtet , was ihr in der Literatur eine Stilisierung zur femme fatale einbrachte.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, zu eruieren, ob Salammbô in der Tat eindeutig dem Typus der femme fatale zuzuordnen ist. Da ich es für das Grundverständnis als sinnvoll erachte, stelle ich meiner Arbeit ein Kapitel voran, in dem ich den heutzutage fast inflationär gebrauchten Terminus femme fatale zunächst definiere und die Grundzüge dieses Typus beschreibe. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt die Darstellung dieses Phänomens zu. Daher sollen Gründe aufgezeigt werden, die erklären, warum sich jenes Frauenbild eben gerade zu diesem Zeitpunkt durchsetzen konnte.
Im darauffolgenden Teil werden Salammbôs Erscheinung, ihre Wirkung sowie ihr Handeln untersucht, um festzustellen, was sie evtl. zur femme fatale machen könnte.
In der Schlussbetrachtung soll letztendlich, nach Klärung der theoretischen Grundlagen, ein Resümee gezogen werden, das die gewonnenen Erkenntnisse erneut aufgreift und in einen sinnvollen Zusammenhang bringt, um abschließend zu beurteilen, inwiefern Salammbô dem Klischee der femme fatale entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die femme fatale
- Definition des Terminus
- Vorbilder der femme fatale
- Das äußere Erscheinungsbild der femme fatale
- Charakteristika der femme fatale
- Gründe für die zunehmende Darstellung der femme fatale in der Literatur des 19. Jh.
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft vom 17. bis ins 19. Jh.
- Die sexuelle Doppelmoral im 19. Jh.
- Salammbô
- Ihre Erscheinung
- Ihre Wirkung
- Ihr Handeln
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Flauberts Salammbô dem Typus der femme fatale entspricht. Zunächst wird der Begriff „femme fatale“ definiert und seine historischen Vorbilder beleuchtet. Anschließend wird untersucht, inwiefern Salammbôs Erscheinung, Wirkung und Handeln zu dieser Typisierung beitragen.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „femme fatale“
- Analyse von Salammbôs Erscheinung und Ausstrahlung
- Untersuchung von Salammbôs Einfluss auf Mâtho und andere Figuren
- Die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert und der Einfluss gesellschaftlicher Normen
- Vergleich von Salammbô mit literarischen Vorbildern der femme fatale
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der femme fatale ein und beschreibt das Frauenbild in der Literatur, das einer unwiderstehlichen Anziehungskraft und einem dämonischen Charakter zugeschrieben wird. Die Arbeit hat zum Ziel, zu klären, ob Salammbô diesem Typus zuzuordnen ist. Dafür wird der Begriff zunächst definiert und die Gründe für die zunehmende Darstellung der femme fatale im 19. Jahrhundert untersucht. Die Analyse von Salammbôs Erscheinung, Wirkung und Handeln soll die Zuordnung zu diesem Typus belegen oder widerlegen.
Die femme fatale: Dieses Kapitel definiert den Begriff „femme fatale“ als schicksalhafte, verderbenbringende Frau. Es wird auf die doppelte Bedeutung von „fatal“ eingegangen: verhängnisvoll und im ursprünglichen Sinne als göttliches Schicksal. Die Hilflosigkeit der Männer gegenüber der dominanten Frau wird thematisiert, wobei der Vergleich mit der Motte und der Flamme verwendet wird. Weiterhin werden verschiedene literarische und mythologische Vorbilder der femme fatale vorgestellt, von Gorgo und Medusa bis hin zu Figuren aus der Bibel und der Renaissance.
Salammbô: Dieses Kapitel analysiert Salammbôs Erscheinung, ihre Wirkung auf ihre Umgebung und ihr Handeln. Es wird untersucht, wie diese Aspekte zu ihrer möglichen Einordnung als femme fatale beitragen. Durch eine detaillierte Betrachtung ihrer Persönlichkeit und ihrer Interaktionen mit anderen Charakteren soll geklärt werden, ob sie die Merkmale einer femme fatale aufweist. Hier werden die im vorherigen Kapitel beschriebenen Merkmale auf Salammbô angewendet, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Schlüsselwörter
Femme fatale, Gustave Flaubert, Salammbô, Mâtho, 19. Jahrhundert, sexuelle Doppelmoral, literarische Figuren, Frauenrolle, Mythos, Verführerin, Verhängnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Salammbô" als Beispiel der Femme Fatale
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht, ob Gustave Flauberts Romanfigur Salammbô dem Typus der Femme Fatale entspricht. Die Analyse konzentriert sich auf Salammbôs Erscheinung, Wirkung und Handeln im Kontext des 19. Jahrhunderts und vergleicht sie mit literarischen Vorbildern.
Welche Aspekte von Salammbô werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert Salammbôs Aussehen, ihren Einfluss auf andere Figuren (insbesondere Mâtho), ihr Verhalten und ihre Handlungen. Es wird untersucht, inwiefern diese Aspekte zu ihrer möglichen Klassifizierung als Femme Fatale beitragen.
Wie wird der Begriff "Femme Fatale" definiert?
Der Begriff "Femme Fatale" wird als schicksalhafte, verderbenbringende Frau definiert, wobei die doppelte Bedeutung von "fatal" (verhängnisvoll und göttliches Schicksal) berücksichtigt wird. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und seine literarischen und mythologischen Vorbilder.
Welche Rolle spielt der gesellschaftliche Kontext des 19. Jahrhunderts?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert und den Einfluss der damaligen gesellschaftlichen Normen und der sexuellen Doppelmoral auf die Darstellung und Interpretation der Femme Fatale. Dieser Kontext wird zur Einordnung von Salammbô herangezogen.
Welche literarischen Vorbilder der Femme Fatale werden betrachtet?
Die Arbeit nennt und vergleicht verschiedene literarische und mythologische Vorbilder der Femme Fatale, von Gorgo und Medusa bis hin zu Figuren aus der Bibel und der Renaissance. Diese dienen als Vergleichsgrundlage für die Analyse von Salammbô.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und den Vorbildern der Femme Fatale, ein Kapitel zur Analyse von Salammbô und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Forschungsfrage.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Femme fatale, Gustave Flaubert, Salammbô, Mâtho, 19. Jahrhundert, sexuelle Doppelmoral, literarische Figuren, Frauenrolle, Mythos, Verführerin, Verhängnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Forschungsfrage zu beantworten, ob Salammbô als Femme Fatale eingeordnet werden kann. Dies geschieht durch eine systematische Analyse der Romanfigur im Kontext ihrer Zeit und im Vergleich zu etablierten literarischen Vorbildern.
- Arbeit zitieren
- Patrizia Scamarcio (Autor:in), 2013, Flauberts Salammbô. Eine femme fatale?!, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275704