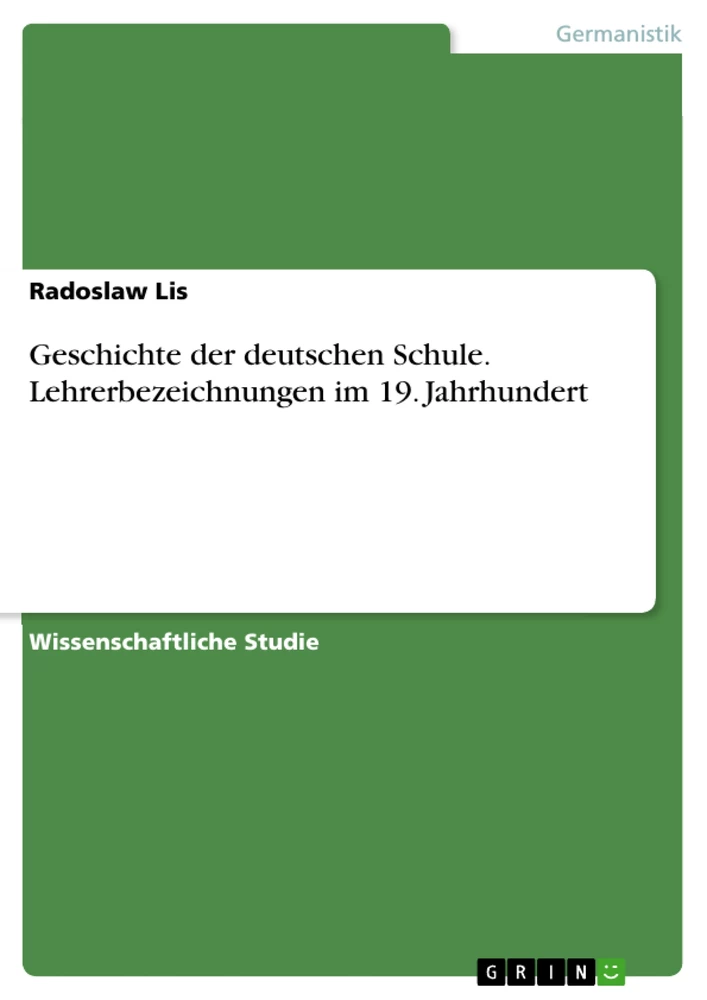Im 19. Jahrhundert ergibt sich immer wieder der Bedarf, die in Verbindung mit den zahlreichen Schulanstalten stehenden Beamten und Fachleute entsprechend zu bezeichnen. Wie auch früher holt man die nötigen Benennungen für die entsprechenden schulischen Vorgänge und Erscheinungen vorwiegend nicht nur aus dem Latein (da die lateinische Sprache immer noch die deutsche Schulterminologie in hohem Maße beeinflusst), sondern auch von der Kirchenterminologie, die an vielen Stellen in den Schulordnungen zu finden ist, auch wenn die jeweiligen Schulanstalten nicht mehr der Kirche unterstehen.
Die vorliegende Arbeit ist eine linguistische Abhandlung mit starken Bezügen zur Kulturgeschichte, vor allem zur Bildungsgeschichte. Gerechtfertigt aber dadurch, dass dies, wenn die Geschichte der Sprache nachgezeichnet werden soll, vor dem Hintergrund der allgemeinen historischen, politischen, schul- und sozialgeschichtlichen Entwicklung erfolgen muss. Denn die Sprachgeschichte eines Volkes, richtig verstanden und betrieben, darf keinen bloß antiquarischen oder musealen Charakter tragen – sie muss vielmehr wie in einem Brennspiegel seine geistige, soziale und politische Geschichte erkennen lassen.
In Preußen wurde, ähnlich wie in den anderen deutschen Staaten, die allgemeine Schulpflicht im Verlauf des 18. Jahrhunderts wiederholt proklamiert, jedoch erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts konnte sie durchgesetzt werden. Während zu Beginn kaum mehr als die Hälfte der Jugendlichen eine Schule besuchten, taten dies gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu alle Jugendlichen. Innerhalb dieses Prozesses der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht entwickelten sich auch zahlreiche neue Wortschatzstrukturen in Bezug auf die einzelnen Unterrichtsfächer – infolge der durchgeführten Schulreformen und eingeführten reformatorischen Bildungsideen und Lehrprogrammen ergab sich der Bedarf, für die modernen Lehrinhalte entsprechende Bezeichnungen zu finden.
Das Thema und der Inhalt dieser Arbeit nehmen in der Reihe bisher erschienenen sprachgeschichtlicher Schriften eine Sonderstellung ein. Während der überwiegende Teil der veröffentlichten Arbeiten zum deutschen Schulwesen sich mit der Geschichte der pädagogischen Gedanken und Zielvorstellungen auseinandersetzt, wird in dieser Arbeit die Schulterminologie in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Lehrerbezeichnungen im 19. Jahrhundert
- Der Begriff Lehrer
- Der Begriff Religionslehrer
- Synonyme Bezeichnungen für Gesanglehrer und Musiklehrer
- Rang und Funktionen der Pädagogen
- Hilfslehrer, Hülfslehrer, Hülfelehrer, Gehülfe
- Probelehrer
- Oberlehrer
- Elementarlehrer
- Hauptlehrer
- Privatlehrer
- Hauslehrer
- Klassenlehrer
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von Lehrerbezeichnungen im 19. Jahrhundert in Deutschland. Sie analysiert die verschiedenen Bezeichnungen, die für Lehrer an unterschiedlichen Schulformen und in verschiedenen Funktionen verwendet wurden, und untersucht die sprachlichen und gesellschaftlichen Hintergründe dieser Entwicklung.
- Die Bedeutung des Begriffs „Lehrer“ und seine Entwicklung im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der Kirchenterminologie und des Lateinischen in der Bildung von Lehrerbezeichnungen
- Die Unterscheidung von Lehrern nach Schulformen und Fachbereichen
- Die hierarchische Struktur der Lehrerberufe und die verschiedenen Rangstufen
- Die Bedeutung von Lehrerbezeichnungen für die Organisation und die gesellschaftliche Wahrnehmung des Schulwesens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Lehrer“ im 19. Jahrhundert. Es wird gezeigt, dass der Begriff „Lehrer“ im 18. Jahrhundert an Bedeutung gewann und im 19. Jahrhundert zum Standardbegriff für alle berufsmäßig unterrichtenden Personen wurde. Das Kapitel analysiert auch die Entstehung von Komposita wie „Gymnasiallehrer“, „Mittelschullehrer“ und „Volksschullehrer“, die auf die verschiedenen Schulformen des 19. Jahrhunderts zurückzuführen sind.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Religionslehrer“ und seinen Synonymen. Es werden verschiedene Bezeichnungen wie „Pfarrer“, „Theologe“, „Seelsorger“, „Predigtamts-Candidat“ und „Rabbiner“ vorgestellt und ihre Bedeutung im Kontext des Schulwesens des 19. Jahrhunderts erläutert.
Das dritte Kapitel untersucht die Bezeichnungen für Gesanglehrer und Musiklehrer. Es wird gezeigt, dass der Begriff „Musikdirektor“ zwar vereinzelt belegt ist, aber das lateinische Wort „Kantor“ im 19. Jahrhundert die dominierende Bezeichnung für Musiklehrer war. Das Kapitel beleuchtet auch die Herkunft des Begriffs „Kantor“ aus der Kirchenterminologie.
Das vierte Kapitel analysiert die verschiedenen Rangstufen und Funktionen von Lehrern im 19. Jahrhundert. Es werden Bezeichnungen wie „Hilfslehrer“, „Probelehrer“, „Oberlehrer“, „Elementarlehrer“, „Hauptlehrer“, „Privatlehrer“ und „Hauslehrer“ vorgestellt und ihre Bedeutung im Kontext der Schulorganisation und der Lehrerkarriere erläutert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Klassenlehrer“. Es wird gezeigt, dass der Begriff „Klassenlehrer“ im 19. Jahrhundert aufkam und die Bedeutung des Lehrers als Verantwortlichen für die pädagogische Betreuung und die organisatorische Leitung einer Klasse unterstreicht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Lehrerbezeichnungen im 19. Jahrhundert, die Entwicklung des Schulwesens, die Kirchenterminologie, die lateinische Sprache, die verschiedenen Schulformen, die Rangstufen der Lehrerberufe, die Organisation des Unterrichts und die gesellschaftliche Wahrnehmung des Schulwesens.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Begriff "Lehrer" im 19. Jahrhundert?
Der Begriff wurde im 19. Jahrhundert zum Standard für alle unterrichtenden Personen und löste zunehmend ältere, oft kirchlich geprägte Bezeichnungen ab.
Welchen Einfluss hatte die Kirche auf die Lehrerbezeichnungen?
Viele Begriffe stammten aus der Kirchenterminologie, wie etwa "Kantor" für Musiklehrer oder Bezeichnungen für Religionslehrer, die oft Geistliche waren.
Was war ein "Oberlehrer" im 19. Jahrhundert?
Es war eine Rangbezeichnung für Lehrer an höheren Schulen (Gymnasien), die eine akademische Ausbildung und eine entsprechende Prüfung absolviert hatten.
Was unterschied einen "Hauslehrer" von einem "Elementarlehrer"?
Hauslehrer unterrichteten Kinder privat in deren Elternhaus, während Elementarlehrer an öffentlichen Volksschulen für die Grundbildung zuständig waren.
Wann wurde die allgemeine Schulpflicht in Preußen durchgesetzt?
Obwohl sie im 18. Jahrhundert proklamiert wurde, gelang die faktische Durchsetzung für fast alle Jugendlichen erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts.
- Citation du texte
- Radoslaw Lis (Auteur), 2013, Geschichte der deutschen Schule. Lehrerbezeichnungen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275732