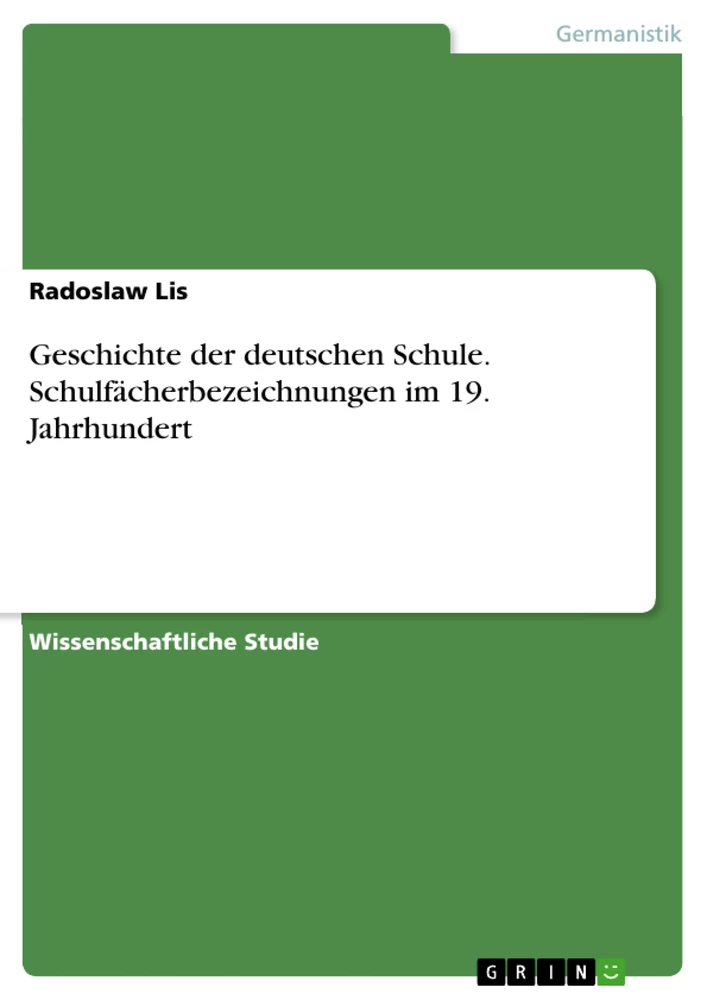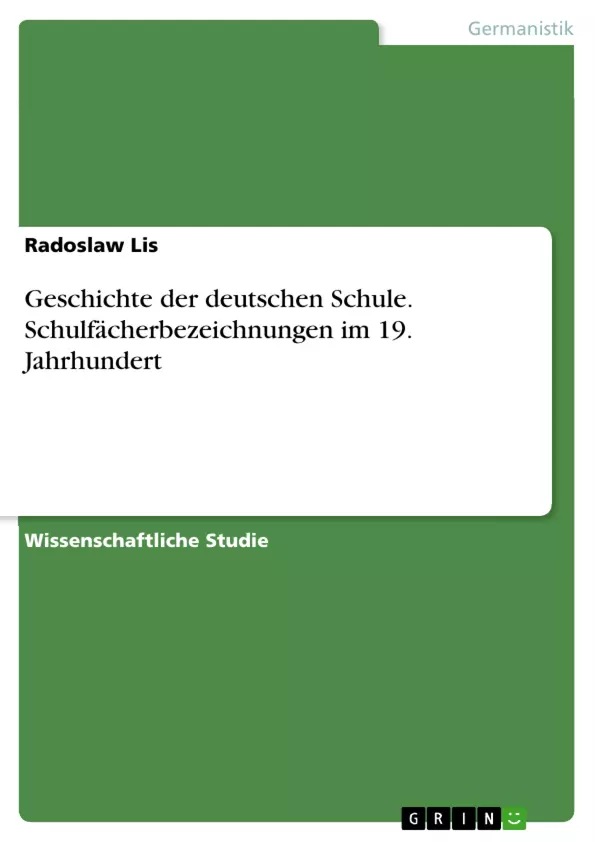Das Thema und der Inhalt dieser Arbeit nehmen in der Reihe bisher erschienenen sprachgeschichtlicher Schriften eine Sonderstellung ein. Während der überwiegende Teil der veröffentlichten Arbeiten zum deutschen Schulwesen sich mit der Geschichte der pädagogischen Gedanken und Zielvorstellungen auseinandersetzt, wird in dieser Arbeit die Schulterminologie in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt.
Die Sprachentwicklung wurde am Unterrichtsgeschehen an den verschiedenen Typen des niederen und höheren deutschen Schulwesens dargestellt, wodurch ein lebendiges Bild der die Schule begleitenden Sprachereignisse nachgezeichnet werden konnte, das die Veranschaulichung der Entwicklung und Veränderung des Schulwortschatzes ermöglichte.
Die vorgelegte Arbeit ist solch einem sprachlichen Phänomen nachgegangen und hat die historischen Wurzeln der für die deutschen Staaten im 19. Jahrhundert neuen Realität, die bis in die Gegenwart zu beobachten ist, bloßgelegt, von ihrem ursprünglichen Selbstverständnis her untersucht und in ihrer Entwicklung verfolgt.
Die Ergebnisse der Untersuchungen dürften in aller Deutlichkeit gezeigt haben, dass die Schulterminologie wandelbar ist, dass die tragenden Kräfte einer jeden Zeit den entsprechenden Schulwortschatz entwickeln müssen. Ebenso selbstverständlich sollte es aber auch sein, dass neu zu schaffende Schultermini nur Ausprägungen bestimmter geistiger Prinzipien und Haltungen sein können.
Die vorliegende Arbeit ist eine linguistische Abhandlung mit starken Bezügen zur Kulturgeschichte, vor allem zur Bildungsgeschichte. Gerechtfertigt aber dadurch, dass dies, wenn die Geschichte der Sprache nachgezeichnet werden soll, vor dem Hintergrund der allgemeinen historischen, politischen, schul- und sozialgeschichtlichen Entwicklung erfolgen muss. Denn die Sprachgeschichte eines Volkes, richtig verstanden und betrieben, darf keinen bloß antiquarischen oder musealen Charakter tragen – sie muss vielmehr wie in einem Brennspiegel seine geistige, soziale und politische Geschichte erkennen lassen.
- Quote paper
- Radoslaw Lis (Author), 2013, Geschichte der deutschen Schule. Schulfächerbezeichnungen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275735