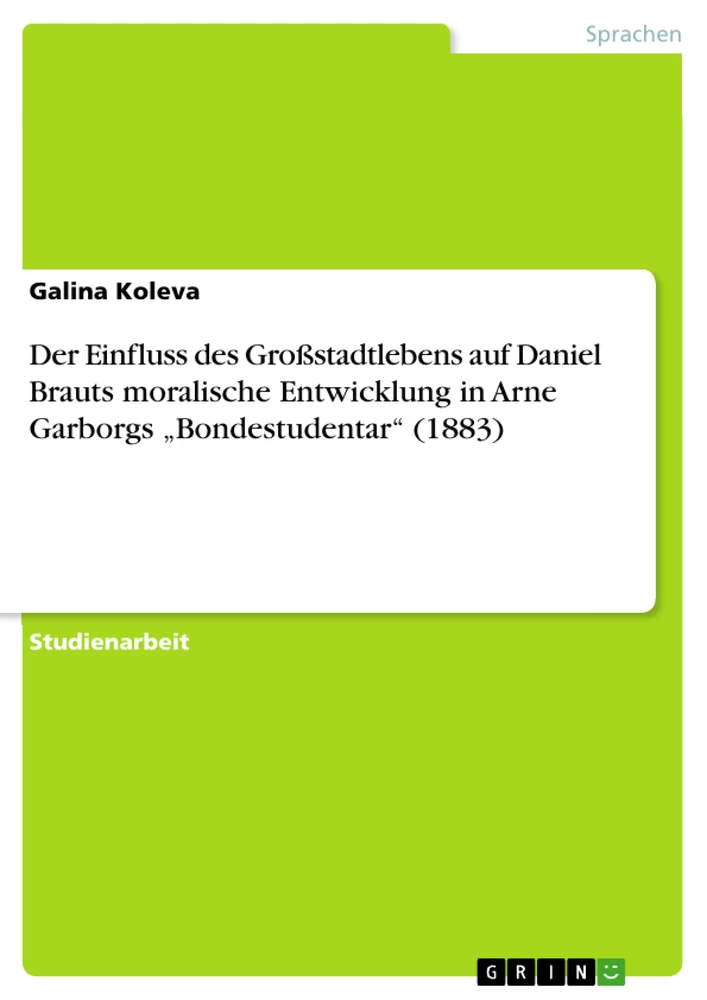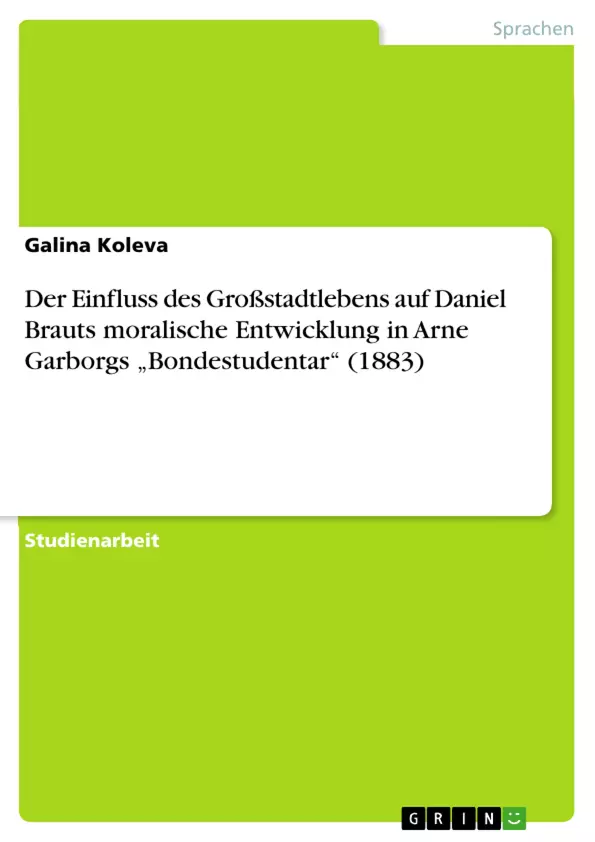In seinem Roman vom Jahre 1883 ”Bondestudentar” schildert der berühmte norwegische Schriftsteller Arne Garborg das Studentenleben der Bauernstudenten – Jungen, die extra aus dem Dorf in die Großstadt ziehen, um ein Studium oder Weiterbildung zu erlangen. Der tiefe Gegensatz zwischen Dorf und Stadt zu dieser Zeit bildete eine riesige Kluft vor denjenigen aus der Dorfgemeinde, die eine weitere Bildung wollten. Die sprachliche Barriere für die starke Dialekte sprechenden Dorfjungen und die hohen Preise einer Universitätsbildung waren schwer zu überwindende Hindernisse, die im Bildungswege standen.
Der Roman behandelt eine neue, bis jetzt in der norwegischen Literatur nicht angesprochene Thematik – ein junger Mann aus einem bäuerlichen Milieu und mit einer bäuerlichen Erziehung und Kultur wird mit einem städtischen Milieu und städtischer Kultur konfrontiert; aber nicht nur in dieser Hinsicht ist „Bondestudentar“ innovativ und neu – der Roman ist einer der ersten, auf nynorsk verfassten bedeutenden Werke in Norwegen. Seine Erscheinung übt einen starken Einfluss aus auf die Etablierung auf der norwegischen literarischen Szene der auf die Dialekte basierten Sprache (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Romaninhalt
- Inhaltsangabe
- Romanstruktur
- Der Großstadteinfluss
- Begriffserklärung
- Das Großstadtleben
- Städtische Räumlichkeiten
- Die Stadtmenschen
- Die Hungernot
- Soziale Mischung
- Innerliche Veränderung
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die moralische Entwicklung des Protagonisten Daniel Braut im Roman „Bondestudentar“ von Arne Garborg. Sie untersucht, inwiefern das Großstadtleben und die damit verbundenen sozialen und kulturellen Einflüsse Daniels Charakter prägen und zu einer Veränderung seiner moralischen Werte führen. Die Arbeit beleuchtet die Gegensätze zwischen Dorf und Stadt, die Armut und die Herausforderungen des Studentenlebens, die Daniels Entwicklung beeinflussen.
- Der Einfluss des Großstadtlebens auf die moralische Entwicklung des Protagonisten
- Die Gegensätze zwischen Dorf und Stadt
- Die Armut und ihre Auswirkungen auf Daniels Charakter
- Die Herausforderungen des Studentenlebens in der Großstadt
- Die Rolle der sozialen und kulturellen Einflüsse auf Daniels Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Roman „Bondestudentar“ von Arne Garborg vor. Sie beschreibt den historischen Kontext des Romans und die Bedeutung des Themas „Großstadtleben“ in der norwegischen Literatur. Die Einleitung stellt außerdem die zentrale These der Arbeit vor, die besagt, dass das Großstadtleben einen entscheidenden Einfluss auf die moralische Entwicklung des Protagonisten Daniel Braut hat.
Das Kapitel „Romaninhalt“ bietet eine Zusammenfassung der Handlung des Romans. Es beschreibt die wichtigsten Figuren und die zentralen Ereignisse der Geschichte. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Daniels Entwicklung und den Herausforderungen, denen er im Großstadtleben begegnet. Das Kapitel beleuchtet auch die verschiedenen sozialen und kulturellen Einflüsse, die auf Daniel wirken.
Das Kapitel „Der Großstadteinfluss“ analysiert die Auswirkungen des Großstadtlebens auf Daniels Charakter. Es untersucht die verschiedenen Aspekte des städtischen Lebens, die Daniels moralische Entwicklung beeinflussen, wie z. B. die Armut, die soziale Mischung und die innerliche Veränderung. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle der städtischen Räumlichkeiten und die Bedeutung der Begegnungen mit den Stadtmenschen für Daniels Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Roman „Bondestudentar“, Arne Garborg, Daniel Braut, Großstadtleben, moralische Entwicklung, Studentenleben, Dorf und Stadt, Armut, soziale Einflüsse, kulturelle Einflüsse, Charakterentwicklung, Naturalismus, Bildungsroman.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Arne Garborgs Roman „Bondestudentar“?
Der Roman schildert das Leben von Bauernstudenten, die vom Dorf in die Großstadt ziehen, um Bildung zu erlangen, und dabei mit kulturellen Gegensätzen konfrontiert werden.
Wie verändert das Großstadtleben den Protagonisten Daniel Braut?
Die Arbeit analysiert, wie soziale Einflüsse, Armut und das städtische Milieu Daniels moralische Werte und seinen Charakter prägen.
Welche Barrieren gab es für Dorfjungen an der Universität?
Neben hohen Kosten stellten vor allem sprachliche Barrieren durch starke Dialekte ein erhebliches Hindernis dar.
Was ist das Besondere an der Sprache des Romans?
„Bondestudentar“ ist eines der ersten bedeutenden Werke, das auf Nynorsk verfasst wurde, einer auf Dialekten basierenden norwegischen Schriftsprache.
Welche literarische Strömung wird dem Werk zugeordnet?
Der Roman weist Merkmale des Naturalismus und des Bildungsromans auf.
- Quote paper
- Galina Koleva (Author), 2011, Der Einfluss des Großstadtlebens auf Daniel Brauts moralische Entwicklung in Arne Garborgs „Bondestudentar“ (1883), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275776