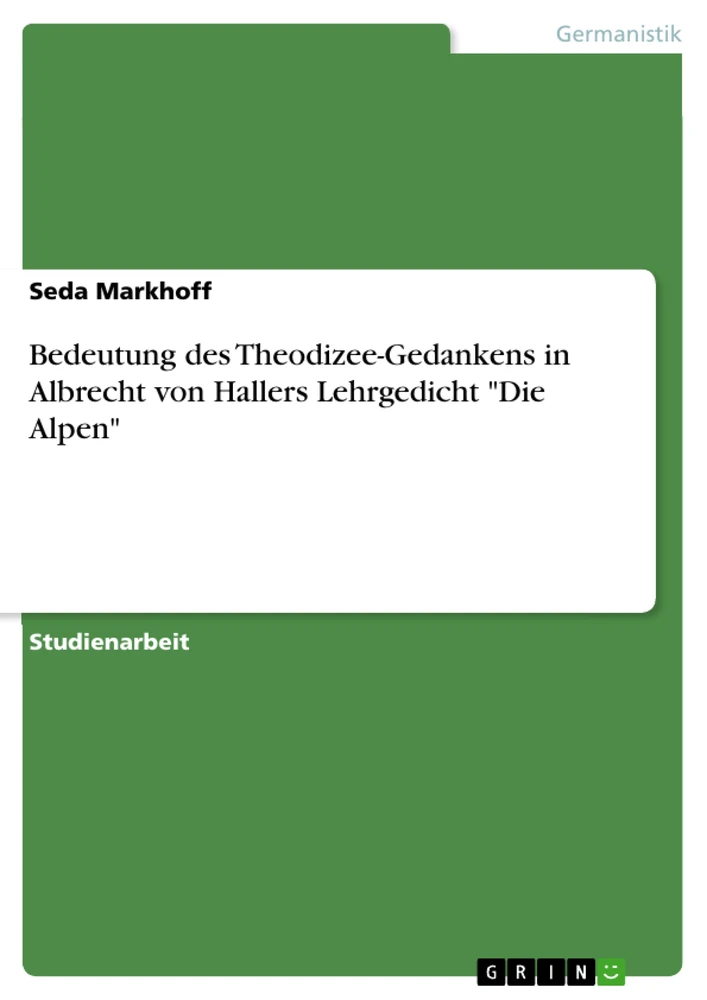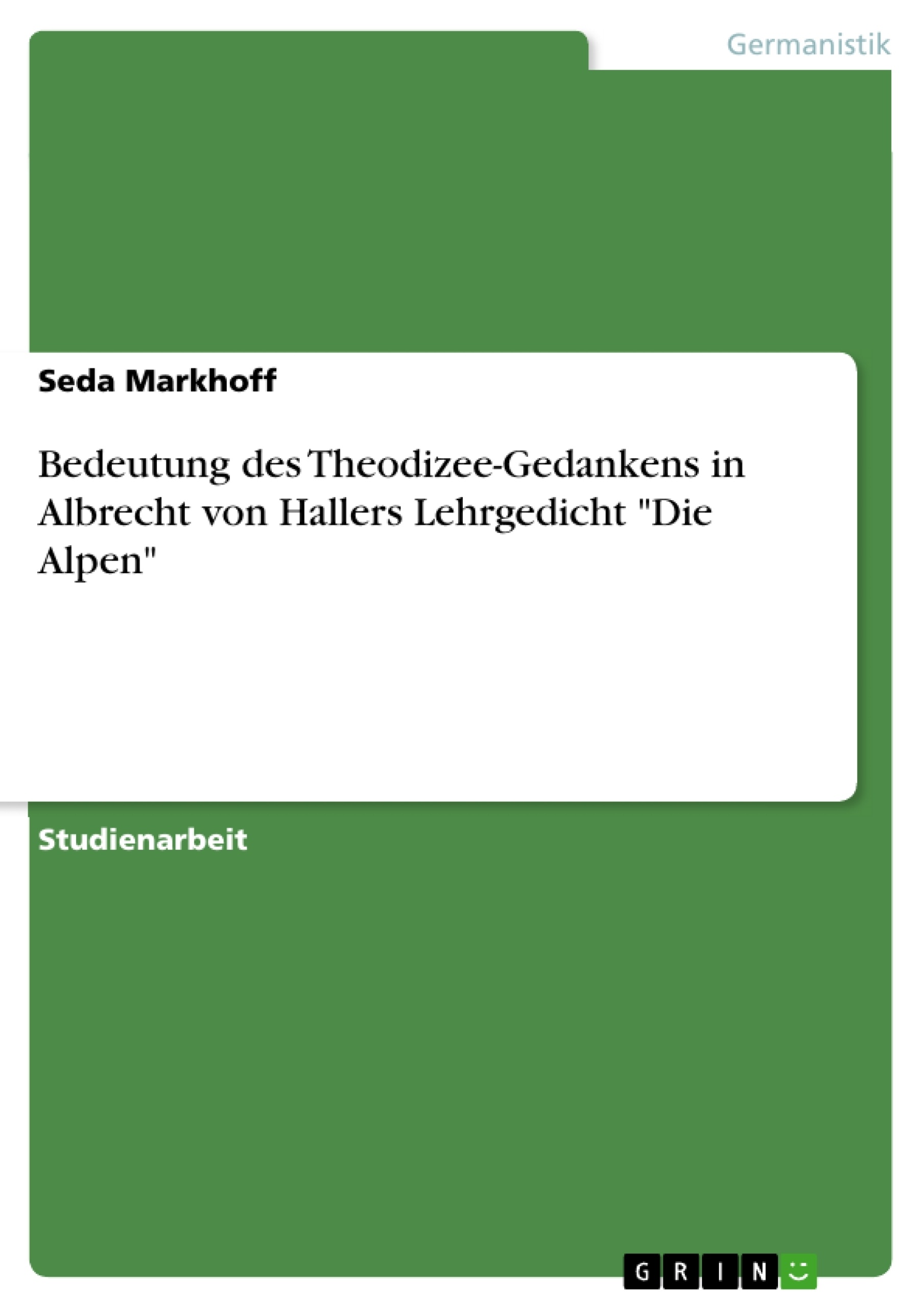Die Alpen sind das höchste Gebirge Europas. Heute machen die Längs- und Quertäler sie zu einem der wegsamsten Gebirge der Erde. Wichtige Straßen führen über die Pässe und wirken als Magnet für den Fremdenverkehr.
1732 veröffentlichte der Berner Verlag Niklaus Emanuel Haller den schmalen Gedichtband "der Versuch Schweizerischer Gedichten" [sic!]. Dieser enthielt u.a. das Gedicht Die Alpen. Zu dieser Zeit waren die Alpen noch längst nicht so bequem zu passieren wie heute, wirkten auf den Betrachter mit ihren schroffen Gebirgsmassiven und tiefen Abgründen eher bedrohlich als anziehend und wurden „von den in den Süden Reisenden stets nur als zu überwindendes Schrecknis empfunden“ .
Albrecht von Haller, im 18. Jahrhundert von Goethe als „der unsterbliche Haller“ betitelt und neben Rousseau, Voltaire und Lambert als berühmtester Gelehrter des philosophischen Jahrhunderts gepriesen , war der Verfasser dieses Gedichtbandes, welchen er bis zu seinem Tod 1777 noch weitere elf Mal überarbeiten sollte. Besonders große sprachliche Veränderungen erfuhr der Band zwischen der zweiten und dritten Auflage, in der bis zu 470 Änderungen pro Ausgabe notiert wurden. Die Vermeidung von Helvetismen und die Annäherung an die Hochsprache waren dabei die Hauptanliegen des Verfassers. Spätere Überarbeitungen waren eher stilistischer, metrischer und inhaltlicher Natur.
Geschuldet wird die lebenslange Arbeit an diesem Gedichtband zum einen dem angeborenen Perfektionismus und Arbeitseifer Albrecht von Hallers und zum anderen der Kritik aus Leipzig. Anlass für diese Kritik waren die Eigentümlichkeiten seiner Dichtersprache, die er fortwährend einzugrenzen versuchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Lyrik als Lehrdichtung
- Der Theodizee-Gedanke
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Theodizee-Gedankens in Albrecht von Hallers Lehrgedicht "Die Alpen". Sie analysiert, wie Haller die Lehre von der Gutheit Gottes und der Freiheit des Menschen als Ursache des Bösen in seiner Dichtung umsetzt und welche Bedeutung diese Thematik für das Werk hat.
- Die Bedeutung von Lehrdichtung in der Frühaufklärung
- Die Rolle des Theodizee-Gedankens in Hallers Werk
- Die Darstellung der natürlichen Welt im Kontrast zur menschlichen Gesellschaft
- Die literarische Form und ihre Funktion
- Die Entwicklung des Gedichtes "Die Alpen" über mehrere Auflagen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt das Lehrgedicht "Die Alpen" in den Kontext seiner Entstehung und präsentiert wichtige Informationen über die Alpenregion im 18. Jahrhundert sowie die literarische Entwicklung von Albrecht von Hallers Werk.
- Lyrik als Lehrdichtung: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle der Lyrik als Lehrdichtung in der Frühaufklärung und untersucht Hallers Verständnis von Poesie und seine Motivation für das Schreiben des Gedichtes.
- Der Theodizee-Gedanke: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung des Theodizee-Gedankens in Hallers Werk. Es fokussiert sich auf die Darstellung von zwei konträren Lebensbereichen: der natürlichen Welt und der menschlichen Gesellschaft, und zeigt, wie diese Gegensätze das Problem des Bösen im Lichte des Theodizee-Gedankens beleuchten.
Schlüsselwörter
Lehrdichtung, Theodizee, Albrecht von Haller, "Die Alpen", Natur, Gesellschaft, Gutheit Gottes, Freiheit des Menschen, moralisches Übel, Philosophie, Spätbarock, Alexandriner, Kreuzreime, Paarreime.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Hallers Gedicht "Die Alpen"?
Es ist ein Lehrgedicht, das die unberührte Natur und die tugendhaften Bergbewohner der korrupten Stadtgesellschaft gegenüberstellt.
Was bedeutet "Theodizee" in diesem Kontext?
Theodizee ist die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt; Haller nutzt die Naturordnung, um die Gutheit der Schöpfung zu demonstrieren.
Warum überarbeitete Haller das Werk so oft?
Haller war Perfektionist und wollte Helvetismen vermeiden, um sich der deutschen Hochsprache anzunähern und Kritik aus Leipzig zu entgehen.
Wie wurden die Alpen im 18. Jahrhundert wahrgenommen?
Vor Hallers Werk wurden sie oft als bedrohliches Schrecknis empfunden; Haller trug wesentlich zu ihrer literarischen Aufwertung bei.
Welche moralische Botschaft vermittelt Haller?
Er lobt die Einfachheit und Freiheit der Alpenhirten als Vorbild für eine moralisch integre Lebensweise.
- Arbeit zitieren
- Seda Markhoff (Autor:in), 2008, Bedeutung des Theodizee-Gedankens in Albrecht von Hallers Lehrgedicht "Die Alpen", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275817