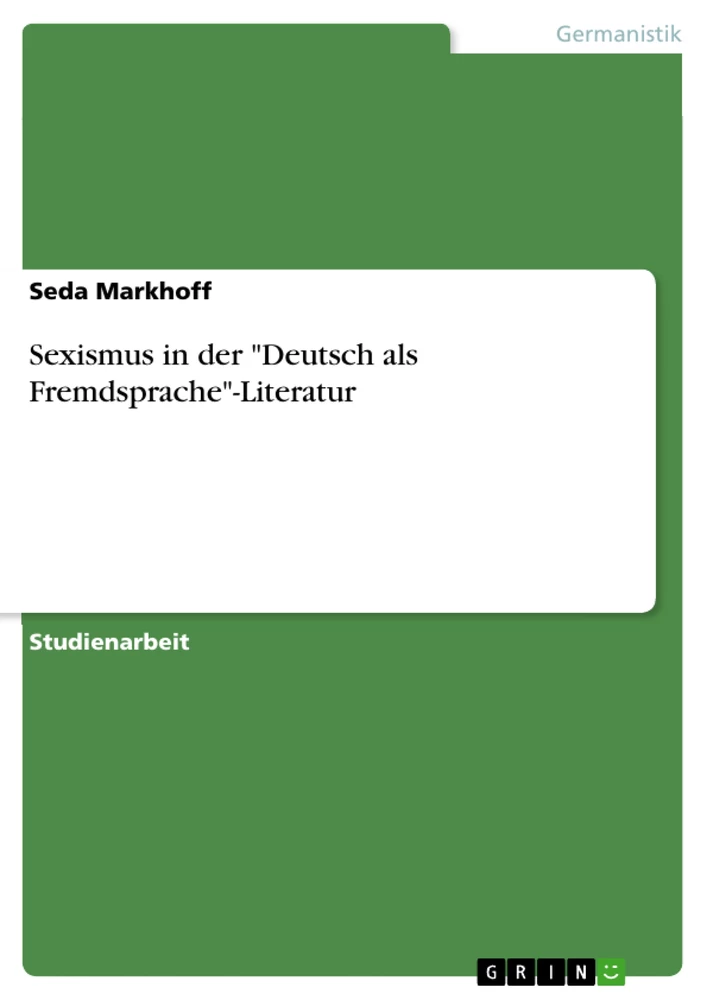Das Herabwürdigen, Verschweigen, Minderbewerten weiblicher Leistungen, die Darstellung von Frauen als Sexobjekte oder von Männern abhängige Personen, das Denken in Geschlechtsstereotypen und das Setzen alles Männlichen als Norm sind nur einige Aspekte von Sexismus. Sowohl Männer als auch Frauen werden dabei in der Entfaltung ihrer individuellen Fähigkeiten und Interessen durch anachronistische Vorstellungen von geschlechtsangemessenen Rollen eingeschränkt. Unter sexistischen Unterrichtsinhalten kann man im Folgeschluss geringere Identifikationsinhalte für Schülerinnen und eine nicht sachgemäße Widerspiegelung des weiblichen Alltags in puncto gesellschaftlicher Leistung und Lebenserfahrung erwarten. Durch Erziehungs- und Lernsituationen wird die althergebrachte Geschlechterhierarchie durch Frauendiskriminierung bestätigt. Diese Hausarbeit befasst sich mit der Fragestellung inwieweit Sexismus in der "Deutsch als Fremdsprachenliteratur" überhaupt Bestand hat. Dabei werden diesbezügliche Kritiken aus deutsch- und fremdsprachigem Raum aufgegriffen und mit der aktuellen DaF Literatur, für die repräsentativ das „Ja genau!“ von dem Verlagshaus Cornelsen und den Ergebnissen der Analyse des Fernsehsprachkurses „Alles Gute“ aus dem Jahre 1994 verglichen.4 Um die Arbeit ordnungsgemäß in einen situativen Kontext einzubetten, wird unter „2.1. Deutschland ein Einwanderungsland“ noch einmal die Geschichte der Migration nach Deutschland beleuchtet und einige aktuelle Fakten und Zahlen genannt. Im Rahmen von „2.2. Geschlechterproblematik im Unterricht“ wird eine ausländische Studie von David Caroll und Johanna Kollwitz und ein Teil ihrer Ergebnisse zur Gewährleistung der Sensibilisierung auf das Thema vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich der Vorstellung der o.g. Lehrwerke und ihrem formalen Aufbau und geht in folgenden Unterpunkten auf einzelne Kriterien zur näheren Analyse, Bewertung und Vergleich über.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Deutschland – ein Einwanderungsland
- Geschlechterproblematik im Unterricht.
- Sexismus in deutschsprachigen Unterrichtsmaterialien
- Unterrepräsentation von Frauen.
- Unterordnung und Abhängigkeit.
- Stereotypisierung
- Sexistischer Sprachgebrauch.
- Nachlässigkeit und Ungenauigkeit
- Degradierung, Isolierung, Oberflächlichkeit.
- Fazit
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Vorkommen von Sexismus in Deutsch als Fremdsprachenliteratur. Dabei wird auf Kritik aus dem deutsch- und fremdsprachigen Raum eingegangen und die aktuelle DaF-Literatur mit Beispielen aus dem Lehrwerk „Ja genau!“ und der Analyse des Fernsehsprachkurses „Alles Gute“ verglichen. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Migration nach Deutschland und stellt aktuelle Fakten und Zahlen vor. Sie stellt auch eine ausländische Studie zur Sensibilisierung für Geschlechterproblematik im Unterricht vor.
- Sexismus in der Deutsch als Fremdsprachenliteratur
- Kritik an sexistischen Inhalten in DaF-Lehrwerken
- Migration nach Deutschland und ihre Auswirkungen auf den Spracherwerb
- Geschlechterproblematik im Unterricht
- Analyse von DaF-Lehrwerken hinsichtlich sexistischer Inhalte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Sexismus in der DaF-Literatur dar und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte der Migration nach Deutschland und präsentiert aktuelle Zahlen und Fakten. Es wird auch eine ausländische Studie zum Thema Geschlechterproblematik im Unterricht vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse von DaF-Lehrwerken und geht auf die Unterrepräsentation von Frauen, Unterordnung und Abhängigkeit, Stereotypisierung, sexistischen Sprachgebrauch, Nachlässigkeit und Ungenauigkeit sowie Degradierung, Isolierung und Oberflächlichkeit ein.
Schlüsselwörter
Sexismus, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Lehrwerke, Unterrichtsmaterialien, Geschlechterproblematik, Migration, Integration, Repräsentation, Stereotypisierung, Sprachgebrauch.
Häufig gestellte Fragen
Wie äußert sich Sexismus in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache (DaF)?
Sexismus zeigt sich durch Unterrepräsentation von Frauen, die Darstellung von Abhängigkeitsverhältnissen, Stereotypisierung und sexistischen Sprachgebrauch.
Werden Frauen in DaF-Lehrwerken unterrepräsentiert?
Analysen zeigen oft, dass männliche Figuren häufiger vorkommen und in vielfältigeren Rollen dargestellt werden als weibliche Figuren.
Welche Rolle spielen Geschlechterstereotype im Sprachunterricht?
Stereotype schränken die Identifikationsmöglichkeiten für Lernende ein und spiegeln oft nicht die tatsächliche gesellschaftliche Realität und Leistung von Frauen wider.
Was wurde am Fernsehsprachkurs „Alles Gute“ kritisiert?
Kritikpunkte waren veraltete Rollenbilder und eine sexistische Darstellung, die in der Arbeit als Vergleichsmaßstab für moderne Lehrwerke dient.
Warum ist Geschlechtersensibilität in Unterrichtsmaterialien wichtig?
Damit Lernende eine sachgemäße Widerspiegelung des Alltags erfahren und nicht durch anachronistische Rollenbilder in ihrer individuellen Entfaltung eingeschränkt werden.
Wie hängen Migration und Geschlechterproblematik im Unterricht zusammen?
In einem Einwanderungsland wie Deutschland ist es wichtig, dass Sprachkurse ein modernes, gleichberechtigtes Gesellschaftsbild vermitteln, um die Integration zu fördern.
- Quote paper
- Seda Markhoff (Author), 2010, Sexismus in der "Deutsch als Fremdsprache"-Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275822