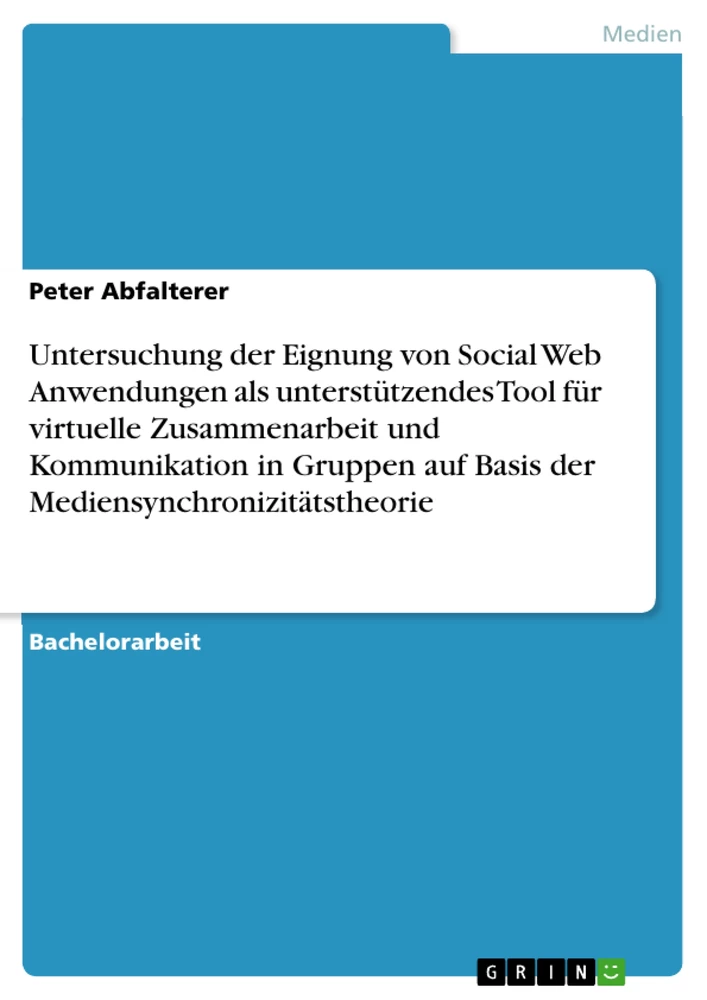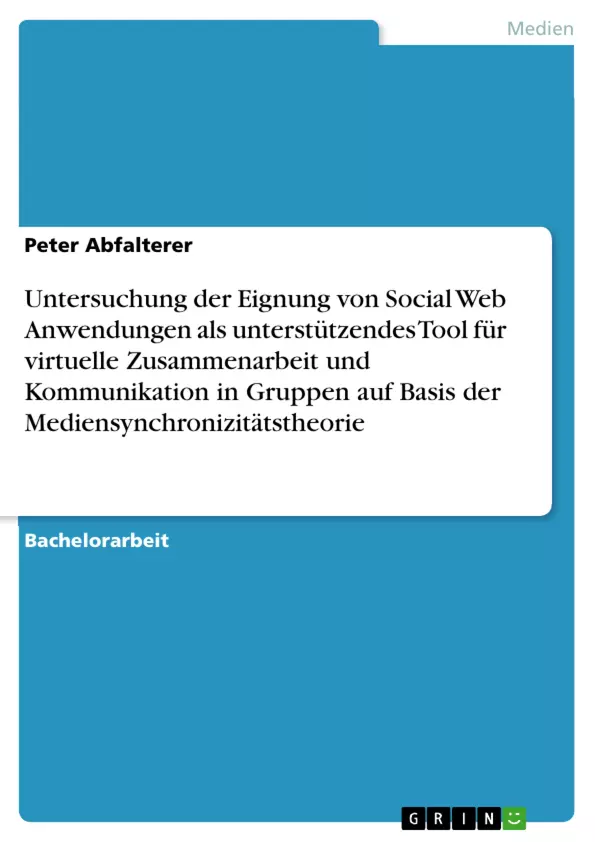Social Web ist in der heutigen Zeit in aller Munde. Eine Vielzahl von Anwendungen versucht die Menschheit in Alltag und Beruf in den verschiedensten Situationen zu unterstützen.
Besonders in der Arbeitswelt werden viele dieser Social Web Anwendungen eingesetzt, um die Kommunikation und Zusammenarbeit unter Mitarbeitern sowohl intern als auch extern
zu erleichtern. In einer Fülle aus zu bewältigenden Problemstellungen und Aufgaben ist es für Unternehmen meist nicht einfach, die geeignete Anwendung auszuwählen, um das
Potential dieser optimal auszuschöpfen. Außerdem ist es oft schwierig, sich durch den Begriffsdschungel des „Web 2.0“ zu kämpfen und die sehr große Menge an Angeboten
überblicken und voneinander abgrenzen zu können.
Die Frage, welche diese Arbeit zu beantworten versucht, ist jene nach der Eignung von Social Web Anwendungen für die Unterstützung der virtuellen Kommunikation und Kooperation. Ziel der Untersuchung ist es, anhand eines Kriterienkataloges Handlungsempfehlungen für Unternehmen abzuleiten, welche Anwendungen für bestimmte Aufgabentypen am besten einzusetzen sind.
Um die zuvor genannte Frage beantworten zu können und Handlungsempfehlungen geben zu können, ist die vorliegende Arbeit wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 beschäftigt sich mit den theoretischen Hintergründen, welche für die Untersuchung notwendig sind. Im Bereich der computervermittelten Kommunikation wird auf die Medienreichhaltigkeitstheorie und die
darauf aufbauende und neuere Mediensynchronizitätstheorie eingegangen. Letztere bildet mit fünf genannten Mediencharakteristika die Basis für die Kriterien im Kriterienkatalog. Des
Weiteren beschäftigt sich dieser Abschnitt mit der Definition, Kategorisierung und Verortung von Social Web Anwendungen und einem Klassifikationsschema für Aufgaben.
In Abschnitt 3 werden die bereits erwähnten Mediencharakteristika operationalisiert und daraus die Kriterien für den Kriterienkatalog erstellt. Im darauf folgenden Abschnitt 4 werden
die Ergebnisse anhand einer vordefinierten Skala im Kriterienkatalog für die drei ausgewählten Anwendungen „MediaWiki“, „LinkedIn“ und „Yammer“ dargestellt.
Abschnitt 5 reflektiert die im Abschnitt zuvor ermittelten Ergebnisse mittels eines Vergleichs und Fazits. Aufgrund dieser Ausführungen werden im Anschluss in Abschnitt 6 zentrale
Erkenntnisse in Form von Handlungsempfehlungen herausgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Theorien der computervermittelten Kommunikation
- 2.1.1. Medienreichhaltigkeitstheorie
- 2.1.2. Mediensynchronizitätstheorie
- 2.2. Das Social Web und seine Anwendungen
- 2.2.1. Begriffsklärung und -abgrenzung
- 2.2.2. Einteilung von Social Web Anwendungen
- 2.2.3. Verortung von Social Web Anwendungen
- 2.2.4. Ausgewählte Social Web Anwendungen
- 2.3. Aufgaben
- 2.3.1. Klassifikation von Aufgaben nach McGrath
- 2.1. Theorien der computervermittelten Kommunikation
- 3. Kriterienkatalog
- 3.1. Unmittelbarkeit des Feedbacks (A)
- 3.1.1. Benachrichtigung über neue Botschaften (A.1)
- 3.1.2. Form des Feedbacks (A.2)
- 3.1.3. Nachrichtenverlauf (A.3)
- 3.1.4. Sichtbarkeit der rezipierten Botschaft (A.4)
- 3.2. Symbolvarietät (B)
- 3.2.1. Text (B.1)
- 3.2.2. Bilder (B.2)
- 3.2.3. Ton (B.3)
- 3.2.4. Bewegtbilder (B.4)
- 3.2.5. Simulationen (B.5)
- 3.3. Parallelität (C)
- 3.3.1. 1:1-Kommunikation (C.1)
- 3.3.2. 1:n-Kommunikation (C.2)
- 3.3.3. m:n-Kommunikation (C.3)
- 3.4. Überarbeitbarkeit (D)
- 3.4.1. Speicherung von Entwürfen (D.1)
- 3.4.2. Funktionalität des Editors (D.2)
- 3.4.3. Überarbeitbarkeit vor dem Senden (D.3)
- 3.4.4. Überarbeitbarkeit während dem Senden (D.4)
- 3.4.5. Überarbeitbarkeit nach dem Senden (D.5)
- 3.4.6. Überarbeitungsverlauf (D.6)
- 3.5. Wiederverwendbarkeit (E)
- 3.5.1. Kopier-Funktion (E.1)
- 3.5.2. Weitergabe / Teilen (E.2)
- 3.5.3. Explizite Downloadmöglichkeit (E.3)
- 3.6. Übersicht
- 3.1. Unmittelbarkeit des Feedbacks (A)
- 4. Ergebnisse
- 4.1. MediaWiki
- 4.2. LinkedIn
- 4.3. Yammer
- 4.4. Gegenüberstellung
- 5. Vergleich und Fazit
- 6. Handlungsempfehlung für Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Social Web Anwendungen als unterstützende Werkzeuge für virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation in Gruppen. Dabei wird die Mediensynchronizitätstheorie als Grundlage für die Analyse und Bewertung der Anwendungen herangezogen. Die Arbeit zielt darauf ab, Kriterien für die Auswahl geeigneter Social Web Anwendungen zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für Unternehmen zu geben.
- Die Eignung von Social Web Anwendungen für virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation
- Die Anwendung der Mediensynchronizitätstheorie zur Bewertung von Social Web Anwendungen
- Die Entwicklung von Kriterien zur Auswahl geeigneter Social Web Anwendungen
- Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Nutzung von Social Web Anwendungen
- Die Analyse verschiedener Social Web Anwendungen im Hinblick auf ihre Eignung für unterschiedliche Aufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der virtuellen Zusammenarbeit und Kommunikation ein und stellt die Relevanz von Social Web Anwendungen in diesem Kontext dar. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es werden die Medienreichhaltigkeitstheorie und die Mediensynchronizitätstheorie vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse von Social Web Anwendungen dienen. Außerdem wird der Begriff des Social Webs erläutert und eine Klassifikation von Social Web Anwendungen vorgenommen. Kapitel 3 präsentiert einen Kriterienkatalog, der auf Basis der Mediensynchronizitätstheorie entwickelt wurde und zur Bewertung von Social Web Anwendungen dient. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Analyse von drei ausgewählten Social Web Anwendungen (MediaWiki, LinkedIn, Yammer) dargestellt. Kapitel 5 beinhaltet einen Vergleich der analysierten Anwendungen und ein Fazit. Abschließend werden in Kapitel 6 Handlungsempfehlungen für Unternehmen gegeben, die Social Web Anwendungen für die virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation einsetzen möchten.
Schlüsselwörter
Virtuelle Zusammenarbeit, Kommunikation, Social Web, Social Web Anwendungen, Mediensynchronizitätstheorie, Kriterienkatalog, Handlungsempfehlungen, MediaWiki, LinkedIn, Yammer.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Mediensynchronizitätstheorie?
Diese Theorie analysiert Medien anhand von fünf Charakteristika (Feedback, Symbolvarietät, Parallelität, Überarbeitbarkeit, Wiederverwendbarkeit), um deren Eignung für bestimmte Aufgaben zu bestimmen.
Welche Social Web Anwendungen wurden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Eignung von MediaWiki, LinkedIn und Yammer für die virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen.
Wie unterscheiden sich die Anwendungen in der Feedback-Unmittelbarkeit?
Anwendungen wie Yammer bieten eine höhere Unmittelbarkeit für schnellen Austausch, während MediaWiki eher auf asynchrone, langfristige Dokumentation ausgelegt ist.
Welche Anwendung eignet sich am besten für Wissensmanagement?
Aufgrund der hohen Überarbeitbarkeit und Wiederverwendbarkeit ist MediaWiki besonders gut für die strukturierte Speicherung von Gruppenwissen geeignet.
Was sind Handlungsempfehlungen für Unternehmen bei der Tool-Auswahl?
Unternehmen sollten Tools basierend auf dem Aufgabentyp wählen: für Brainstorming synchrone Medien, für komplexe Problemlösungen Medien mit hoher Überarbeitbarkeit.
- Quote paper
- Peter Abfalterer (Author), 2014, Untersuchung der Eignung von Social Web Anwendungen als unterstützendes Tool für virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation in Gruppen auf Basis der Mediensynchronizitätstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275854