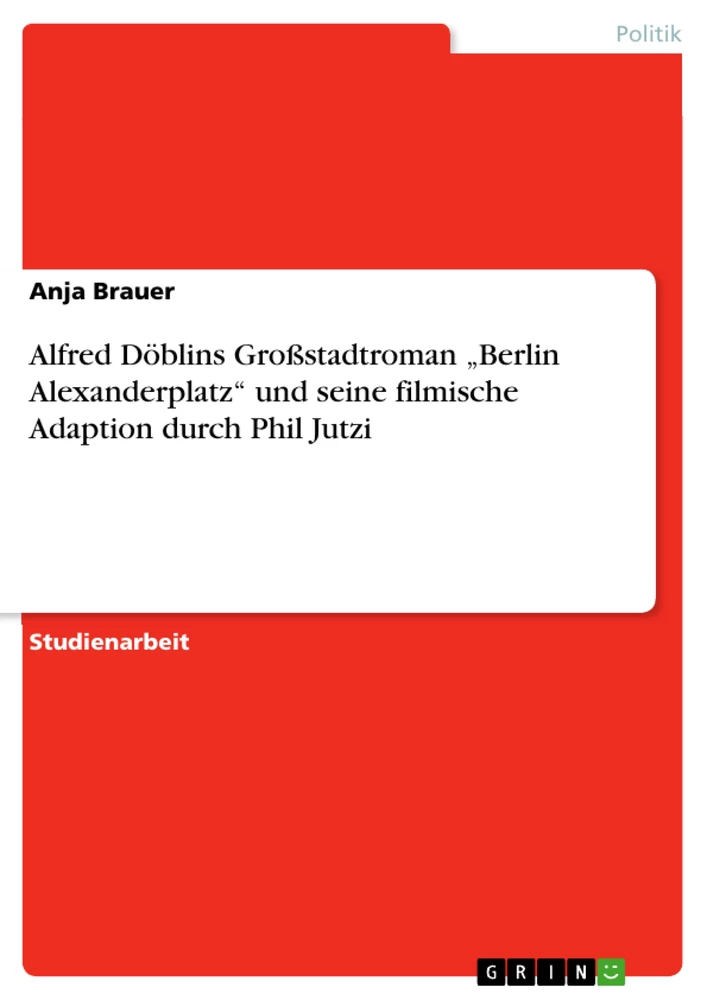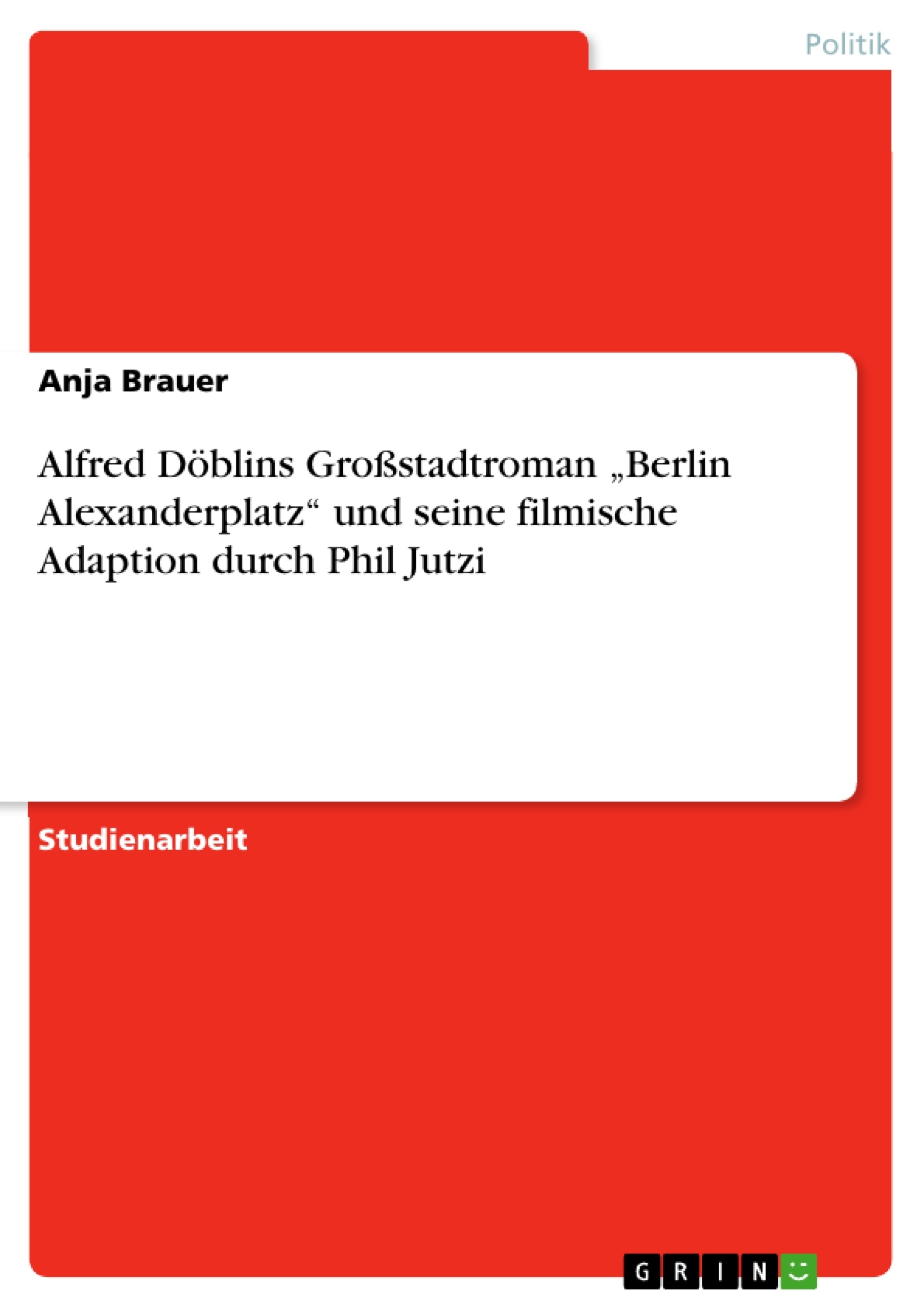Der Mythos Großstadt beschäftigt Literatur und Film seit Anbeginn ihres Entstehens, teilweise als Ort für schwärmerische Faszination, teilweise als Ort tödlichen Grauens. Während das „alte“ Medium Literatur schon vor dem Wachsen der Städte zu Großstädten bis hin zu weltumspannenden Metropolen existiert, entsteht das „neue“ Medium Film erst mit ihnen, als massenkompatibles Unterhaltungsmedium für Jedermann. Das bewegte Bild des Films bietet die Möglichkeit, die Dynamik eines sich ständig im Veränderungsprozess befindenden Großstadtlebens wiederzuspiegeln.
Auf der Suche nach neuen Mitteln, um die Totalität der Großstadt in der Literatur einfangen zu können, entdecken einige Literaten der Moderne die technischen Möglichkeiten des Films auch für die literarische Umsetzung des Großstadtthemas zu nutzen. Bis heute gilt Alfred Döblins 1929 veröffentlichter Roman „Berlin Alexanderplatz“ als herausragendes Beispiel für den Versuch, die diffuse Großstadterfahrung in einem literarischen Werk abzubilden, bei gleichzeitiger Verwendung einer so genannten filmischen Schreibweise.
Im Jahr 1931 entscheidet sich Döblin darüber hinaus an einer Verfilmung seines Romanstoffes durch Phil Jutzi mitzuarbeiten. Da sein Roman die Filmform vorzeichnet, ist es umso interessanter, ob es im Film zur einer identischen Abbildung des literarischen Werkes kommt oder ob unabhängig von den intermedialen Zügen des Ursprungwerkes etwas Neues im Film entsteht. Ein Roman wie Döblins „Berlin Alexanderplatz“, indem vom Film adaptierte Verfahrensweisen im Mittelpunkt stehen, bietet sich als Untersuchungsobjekt für die Möglichkeit der Rückkopplung auf das Ursprungsmedium an.
Unter diesem Gesichtspunkt wird sich in dieser Hausarbeit darauf konzentriert, inwieweit die Umsetzung des Großstadtmotivs aus Döblins Roman sich in Jutzis Verfilmung wieder findet. Dabei wird keine „originalgetreue“ Adaption des literarischen Werkes erwartet, sondern vielmehr berücksichtigt, dass beide Medien unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und Stilmittel für ihre Darstellung bieten. Es wird hierbei davon ausgegangen das zwischen den in ihrer Art unterschiedlichen Medien eine Differenz in diesem Punkt besteht. Es ist zu vermuten, dass die Darstellung einer Großstadt im Film mit seiner Möglichkeit zur optischen und akustischen Umsetzung divergiert mit der schriftlichen Darstellungsform des Romans.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Großstadt und Montage
- In der Literatur der Moderne
- Im Film
- Döblins Großstadt- und Montageroman „Berlin Alexanderplatz“
- Döblin und die Großstadt
- Döblin, das Kino und die „filmische Schreibweise“
- Die Verfilmung „Berlin Alexanderplatz“
- Döblins Drehbuch und Arbeit für den Film
- Divergierende Beurteilung der filmischen Umsetzung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Umsetzung des Großstadtmotivs aus Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ in Phil Jutzis Verfilmung. Sie analysiert, inwiefern die filmische Adaption die literarische Vorlage widerspiegelt und welche Besonderheiten der beiden Medien in Bezug auf die Darstellung der Großstadt zum Tragen kommen.
- Die Rolle der Großstadt als Schauplatz und Protagonist
- Die Verwendung von Montagetechniken in Literatur und Film
- Die filmische Schreibweise in Döblins Roman
- Die Interaktion zwischen Literatur und Film
- Die medienspezifische Darstellung der Großstadt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Großstadt und Montage in Literatur und Film ein und stellt den Fokus auf Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und seine Verfilmung. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung der Großstadt und der Montagetechniken in der Literatur der Moderne und im Film. Kapitel 3 analysiert Döblins Verhältnis zur Großstadt und zum Film sowie seine „filmische Schreibweise“ im Roman. Kapitel 4 befasst sich mit der Verfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ und untersucht Döblins Rolle bei der Adaption sowie die divergierenden Beurteilungen der filmischen Umsetzung. Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Großstadt, Montage, Film, Literatur, Alfred Döblin, „Berlin Alexanderplatz“, Phil Jutzi, filmische Schreibweise, Intermedialität, medienspezifische Darstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was macht Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" literarisch so besonders?
Der Roman gilt als herausragendes Beispiel für die Verwendung einer "filmischen Schreibweise" und Montagetechniken, um die Totalität der Großstadterfahrung abzubilden.
Was versteht man unter "filmischer Schreibweise" in der Literatur?
Es bezeichnet literarische Techniken wie schnelle Schnitte, die Montage von Alltagsgeräuschen, Schlagzeilen und simultanen Ereignissen, die an die Ästhetik des Films angelehnt sind.
Wie unterscheidet sich Phil Jutzis Verfilmung (1931) vom Roman?
Während der Roman die Komplexität der Großstadt durch Sprache montiert, nutzt der Film optische und akustische Mittel, wobei er sich stärker auf die Handlung als auf die experimentelle Struktur konzentriert.
Welche Rolle spielte Döblin bei der Verfilmung von 1931?
Alfred Döblin arbeitete aktiv am Drehbuch mit und versuchte, seinen Romanstoff für das Medium Film anzupassen.
Warum ist das "Großstadtmotiv" zentral für beide Werke?
Die Großstadt Berlin ist nicht nur Schauplatz, sondern agiert fast wie ein eigener Protagonist, der das Schicksal der Figuren (insbesondere Franz Biberkopfs) maßgeblich beeinflusst.
Was ist die "Montage" in diesem Kontext?
Sowohl im Roman als auch im Film werden verschiedene, oft unzusammenhängende Bruchstücke der Realität (Werbung, Lieder, Nachrichten) zu einem neuen Gesamtbild der Stadt zusammengefügt.
- Quote paper
- Anja Brauer (Author), 2014, Alfred Döblins Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“ und seine filmische Adaption durch Phil Jutzi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275866