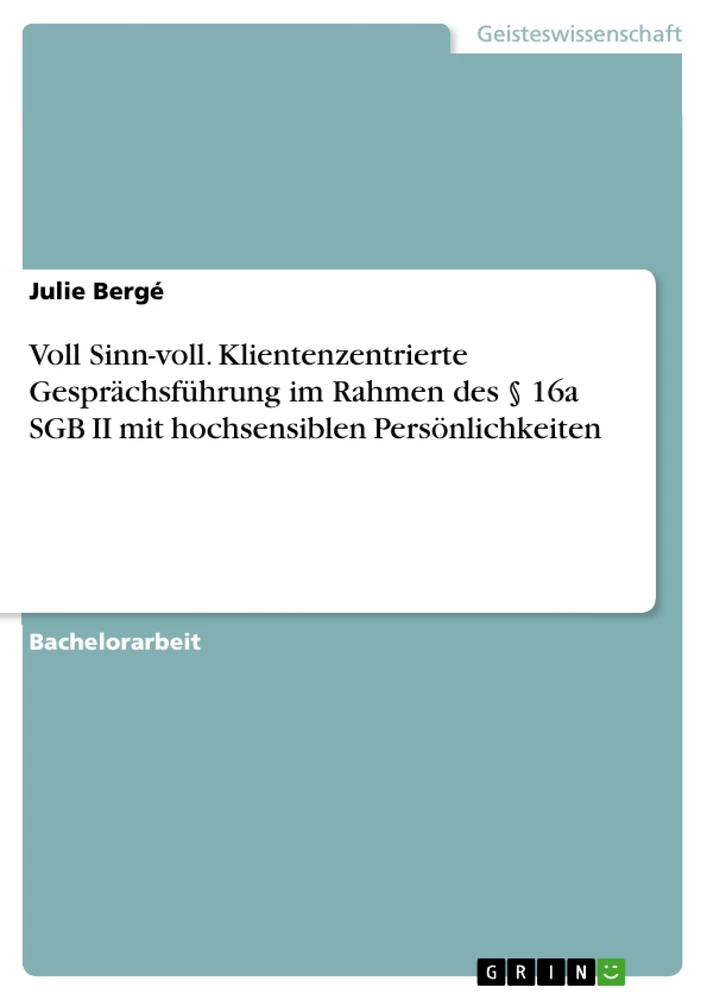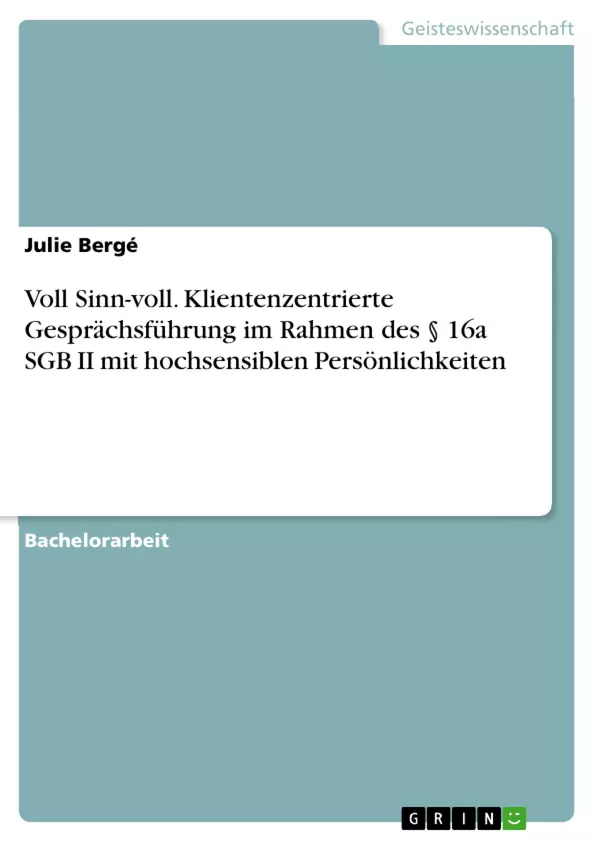“Although this trait is found in 20% of the population, the actual occurance is probably closer to 50% of patients in most practices.” Dieses Zitat stammt von Elaine Aron (2010), einer amerikanischen Psychotherapeutin, die 1997 den Begriff der „highly sensitive person“ prägte. „The trait“- das Merkmal von dem sie also spricht ist- zu Deutsch- die Hochsensibilität. Dem Zitat sind gleich zwei Kernaspekte der Hochsensibilität(HS) zu entnehmen: Zum Einen wird deutlich, wie gering der Anteil der hochsensiblen Menschen(HSM) in der Bevölkerung mit 20% ist, zum Anderen jedoch verrät das Zitat auch die hohe Relevanz für alle beraterischen Kontexte, wenn die Mehrheit der Klienten hochsensibel ist.
Sowohl dieses Thema, als auch diese Erkenntnis, waren mir bis vor einigen Monaten noch völlig unbekannt, bis ich mich zufällig in ein Werk von E. Aron über Hochsensible einlas und sowohl Parallelen zu mir selbst, als auch zu einer Klientin feststellte, die ich während meiner Praxisphase im Landratsamt Böblingen im Rahmen der psychosozialen Beratung des §16 a SGB II betreute. Fasziniert über das Phänomen der Hochsensibilität und damit einhergehenden speziellen Eigenarten der Klientin, beschloss ich, dies zum Thema meiner Bachelorthesis zu machen. Dabei beschäftigte mich insbesondere die Frage, wie ein Klient, der hochsensibel ist, am besten beraten werden könnte, wie die Beratungsbeziehung gestaltet sein sollte, welche Methoden verwendet werden sollten usw. Auf der Suche nach geeigneten Beratungsmethoden stieß ich auf die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers. Sie erschien mir auf den ersten Blick als eine geeignete Methode, um hochsensible Klienten beraten zu können. Genau unter diesem Aspekt soll diese Thesis als eine Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung „Wie kann die psychosoziale Beratung konzipiert sein und inwieweit ist die klientenzentrierte Beratung ein passender Ansatz, um hochsensible Personen beraten zu können?“ fungieren.
Die zwei theoretischen Themenschwerpunkte aus „Hochsensibilität“ und „klientenzentrierter Gesprächsführung“ werden zunächst gesondert behandelt, um dann während der Beschreibung des dritten Schwerpunkts, der Praxis der psychosozialen Beratung, zusammenzufließen.
Der Titel dieser Thesis „Voll Sinn-voll“ spielt bereits auf ein grundlegendes Merkmal der Hochsensiblen an. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Hintergrundwissen zum Phänomen Hochsensibilität
- 2.1) Zur Etymologie: sensibel, sensitiv, empfindsam? Eine Begriffsklärung
- 2.2) Neurobiologie und Forschungsstand
- 2.2.1) Die fünf (bzw. sechs) Sinne bei Hochsensiblen
- 2.2.2) Das vegetative Nervensystem: Hormone und Neurotransmitter
- 2.2.3) Von Denkern und Handlern. Abgrenzung der Hochsensibilität zu ADS/ADHS
- 2.3) Arten/Ausprägungen von Hochsensibilität
- 2.4) Zwischen Genie und Wahnsinn
- 2.4.1) Charakteristika und Verhalten der HSP und die Grenzen zum Pathologischen
- 2.4.2) Vom goldenen Mittelweg: Umweltbedingungen und Lernaufgaben für HSP
- 3.) Die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach C. Rogers
- 3.1) Menschenbild und Persönlichkeitstheorie
- 3.2) von der Inkongruenz zur „fully functioning person“
- 3.3) Die Beratungsbeziehung und die drei Grundhaltungen
- 3.3.1) Empathie
- 3.3.2) bedingungslose Wertschätzung/Akzeptanz
- 3.3.3) Kongruenz
- 3.4) Methoden und Techniken
- 4.) Relevanz für die Soziale Arbeit - Klientenzentrierte Einzelfallhilfe für HSP im psychosozialen Kontext des §16a SGB II
- 4.1) Psychosoziale Beratung nach § 16a SGB II - Definition und Inhalt
- 4.2) Fallschilderung anhand einer hochsensiblen Klientin
- a) Klärungsphase: Erstgespräch und Rahmenbedingungen
- b) Kennenlernphase
- → Frau M.- hochsensibel?
- c) Arbeitsphase
- 4.3) Klientenzentrierte Gesprächsführung- geeigneter Ansatz für die hochsensible Persönlichkeit?
- 4.3.1) Erweiterungen der KZG durch Methoden und Techniken
- d) Abschluss-/Transferphase
- 4.4) Anwendbarkeit der klientenzentrierten Gesprächsführung und den erweiterten Methoden in der psychosozialen Beratung als eine Form der sozialen Einzelfallhilfe
- 5.) Integration der KZG und der erweiterten Techniken in den Handlungsrahmen der Psychosozialen Beratung
- 5.1) Elaine Arons vier Schritte im Umgang mit Hochsensibilität
- 5.2) Erläuterung zur Handreichung „Beratungsprozess im Großen“
- → siehe dazu separate Handreichung
- 5.3) Erläuterung zur Handreichung „Beratungsprozess im Einzelnen“
- → siehe dazu separate Handreichung
- 6.) Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der psychosozialen Beratung von hochsensiblen Klienten im Rahmen des §16a SGB II. Im Fokus steht die Frage, wie die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers als ein passender Ansatz für die Beratung dieser Personengruppe eingesetzt werden kann.
- Das Phänomen der Hochsensibilität wird anhand der Definition, neurobiologischen Grundlagen und verschiedenen Ausprägungen beleuchtet.
- Die klientenzentrierte Gesprächsführung nach C. Rogers wird in Bezug auf ihre Grundhaltungen und Methoden vorgestellt.
- Die Anwendbarkeit der klientenzentrierten Gesprächsführung in der psychosozialen Beratung für hochsensible Klienten wird anhand eines Fallbeispiels und spezifischer Techniken diskutiert.
- Es werden Modifikationen und Erweiterungen des Handlungsrahmens der psychosozialen Beratung für hochsensible Klienten vorgeschlagen.
- Die Arbeit zielt darauf ab, einen Beitrag zur Verbesserung der Beratungspraxis für hochsensible Personen im Kontext der psychosozialen Arbeit zu leisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Motivation, sich mit der psychosozialen Beratung von hochsensiblen Klienten zu beschäftigen. Kapitel 2 liefert Hintergrundwissen zum Phänomen der Hochsensibilität, indem es die Definition, neurobiologische Grundlagen, verschiedene Ausprägungen und die Abgrenzung zu anderen Phänomenen beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der klientenzentrierten Gesprächsführung nach C. Rogers und stellt deren Menschenbild, Grundhaltungen und Methoden vor. In Kapitel 4 wird die Relevanz der klientenzentrierten Gesprächsführung für die Soziale Arbeit und deren Anwendbarkeit in der psychosozialen Beratung für hochsensible Klienten anhand eines Fallbeispiels und spezifischer Techniken diskutiert.
Kapitel 5 integriert die klientenzentrierte Gesprächsführung und die erweiterten Techniken in den Handlungsrahmen der Psychosozialen Beratung. Die Arbeit endet mit einem Resümee und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven.
Schlüsselwörter
Hochsensibilität, Klientenzentrierte Gesprächsführung, Carl Rogers, Psychosoziale Beratung, §16a SGB II, Einzelfallhilfe, Methoden, Techniken, Empathie, Bedingungslose Wertschätzung, Kongruenz, Fallbeispiel, Handreichung, Handlungsrahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet eine hochsensible Persönlichkeit (HSP) aus?
Hochsensibilität betrifft etwa 20% der Bevölkerung. HSP nehmen Reize intensiver wahr, verarbeiten Informationen tiefer und reagieren oft empfindsamer auf äußere Einflüsse und Emotionen anderer.
Warum ist die klientenzentrierte Gesprächsführung für HSP geeignet?
Der Ansatz von Carl Rogers setzt auf Empathie, bedingungslose Wertschätzung und Kongruenz. Diese wertschätzende Haltung kommt dem Bedürfnis hochsensibler Menschen nach einem sicheren und verstehenden Beratungsklima sehr entgegen.
Welche Rolle spielt § 16a SGB II in diesem Kontext?
Dieser Paragraf regelt die psychosoziale Betreuung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Für hochsensible Arbeitslose ist eine spezifische Beratung wichtig, um Überforderung zu vermeiden und individuelle Stärken zu nutzen.
Wie unterscheidet sich Hochsensibilität von ADS/ADHS?
Während ADS/ADHS oft mit Impulsivität und Konzentrationsstörungen einhergeht, zeichnen sich HSP eher durch eine gründliche Informationsverarbeitung und eine schnelle sensorische Überreizung aus, ohne zwingend hyperaktiv zu sein.
Wer prägte den Begriff "Highly Sensitive Person"?
Der Begriff wurde 1997 von der amerikanischen Psychotherapeutin Elaine Aron geprägt, die maßgeblich zur Erforschung dieses Persönlichkeitsmerkmals beigetragen hat.
- Arbeit zitieren
- Julie Bergé (Autor:in), 2014, Voll Sinn-voll. Klientenzentrierte Gesprächsführung im Rahmen des § 16a SGB II mit hochsensiblen Persönlichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275883