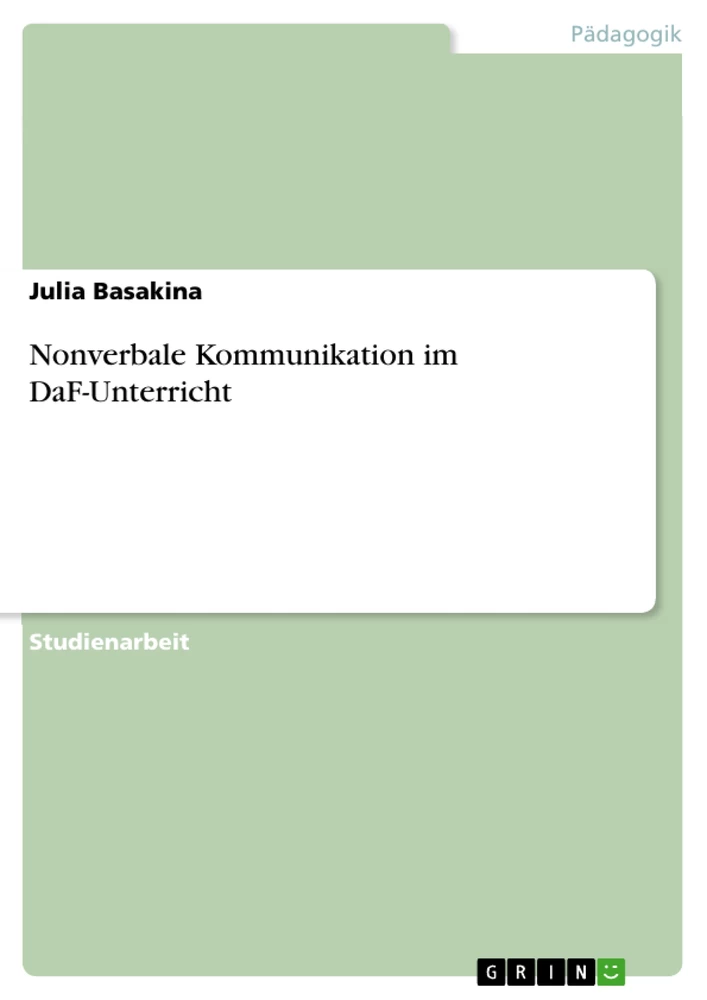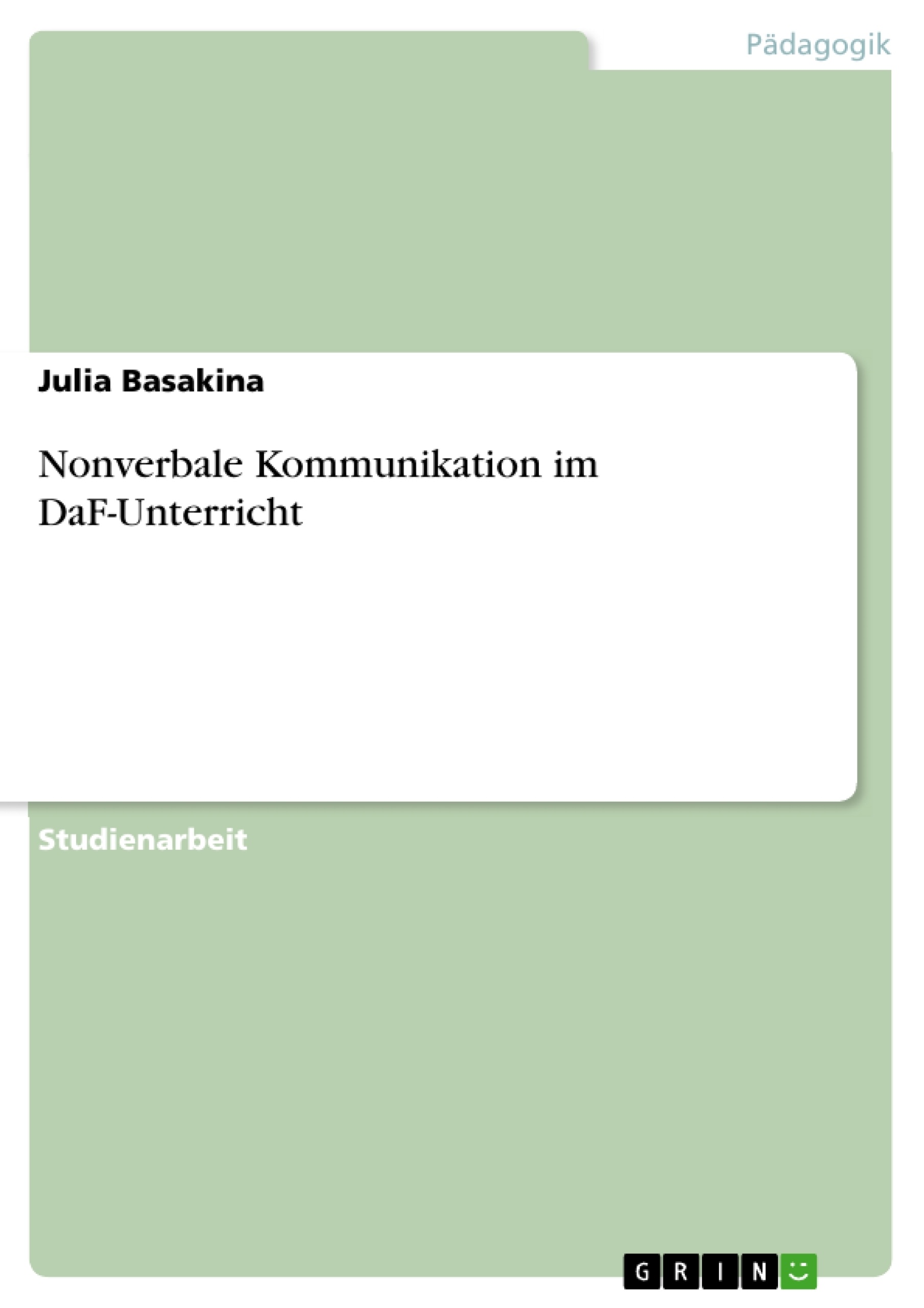In folgender Arbeit werde ich den Schwerpunkt auf interkulturelle Handlungssituation „Deutsch als Fremdsprache - Unterricht“ mit Bezug auf Problematik der nichtverbalen Kommunikation festlegen.
Durch nonverbale Kommunikation werden im Klassenraum täglich viele hunderte Kontextualisierungshinweise vermittelt. Sowohl Lehrer als auch Lerner verwenden Körpersprache als Hilfsmittel entweder bewusst oder unbewusst. Im Fremdsprachenunterricht kann es passieren, dass die Sprachlerner auf die Gesichtsausdrücke, Gestik und Körperhaltung des muttersprachlichen Lehrers anders reagieren, als von dem erwartet wird. Oder andersrum: der muttersprachliche Lehrer ist durch Körpersprache und nonverbales Verhalten der Lerner verwirrt. Vor allem, wenn es sich um nonverbale Kommunikation bei Menschen aus räumlich und kulturell sehr entfernten Kulturkreisen handelt (z.B. Vertreter der deutschen und asiatischen Kultur). Solche Situationen führen oft zu Missverständnissen, einem gegenseitigen Unwohlsein, und vielleicht sogar zu einer ablehnenden Position seitens der Sprachlerner gegenüber der Kultur der Zielsprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nonverbale Kommunikation und verschiedene parasprachliche Äußerungen
- Ist Körpersprache kulturspezifisch oder universell?
- Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht
- Techniken, Methoden und Unterrichtstrategien
- Verhalten von Lehrkraft
- Medien-Hilfsmitteln
- DaF-Lehrwerke
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Elektronische Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung nonverbaler Kommunikation im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Ziel ist es, die Rolle der Körpersprache in interkulturellen Lernsituationen zu analysieren und deren Einfluss auf die Verständigung zwischen Lehrkraft und Lernenden zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Aspekte der nonverbalen Kommunikation, wie Gestik, Mimik und Proxemik, sowie deren kulturspezifische Interpretationen betrachtet.
- Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation im DaF-Unterricht
- Die kulturspezifische Interpretation nonverbaler Signale
- Die Rolle der Körpersprache in der Interaktion zwischen Lehrkraft und Lernenden
- Die Herausforderungen der nonverbalen Kommunikation in interkulturellen Lernsituationen
- Methoden und Strategien zur Bewältigung von Missverständnissen im DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der nonverbalen Kommunikation im DaF-Unterricht ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext interkultureller Begegnungen. Es wird betont, dass nonverbale Signale eine wichtige Rolle bei der Verständigung spielen und dass Missverständnisse aufgrund kultureller Unterschiede auftreten können.
Das zweite Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der nonverbalen Kommunikation, wie Gestik, Mimik, Proxemik und Prosodie. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen dieser Signale in verschiedenen Kulturen beleuchtet und die Bedeutung der kulturspezifischen Wahrnehmung für die Interaktion hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Anwendung nonverbaler Kommunikation im DaF-Unterricht. Es werden verschiedene Techniken, Methoden und Unterrichtstrategien vorgestellt, die die Lehrkraft einsetzen kann, um die nonverbale Kommunikation im Unterricht zu fördern und Missverständnisse zu vermeiden. Dabei wird auch die Bedeutung der eigenen Körpersprache der Lehrkraft und die Verwendung von Medien-Hilfsmitteln im Unterricht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen nonverbale Kommunikation, Deutsch als Fremdsprache (DaF), interkulturelle Kommunikation, Körpersprache, Gestik, Mimik, Proxemik, kulturspezifische Interpretation, DaF-Unterricht, Lehrkraft, Lernende, Missverständnisse, Interaktion, Verständigung, Methoden, Strategien.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht so wichtig?
Nonverbale Signale vermitteln täglich hunderte Kontexthinweise und unterstützen sowohl Lehrer als auch Lerner dabei, Verständigungshürden in einer neuen Sprache zu überwinden.
Können nonverbale Signale zu Missverständnissen führen?
Ja, besonders in interkulturellen Situationen (z. B. zwischen deutschen Lehrern und asiatischen Lernern) können Gestik und Mimik völlig unterschiedlich interpretiert werden.
Ist Körpersprache universell oder kulturspezifisch?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, dass viele parasprachliche Äußerungen stark von kulturellen Normen geprägt sind.
Welche Rolle spielt die Proxemik im Klassenzimmer?
Proxemik bezeichnet das Raumverhalten; unterschiedliche kulturelle Vorstellungen von Nähe und Distanz können im Unterricht zu Unwohlsein führen.
Wie können DaF-Lehrkräfte ihre nonverbale Kompetenz verbessern?
Durch den bewussten Einsatz von Techniken, Methoden und Medien-Hilfsmitteln sowie die Reflexion des eigenen Verhaltens können Missverständnisse minimiert werden.
Was wird in Bezug auf DaF-Lehrwerke kritisiert?
Die Arbeit beleuchtet, inwieweit aktuelle Lehrwerke nonverbale Kommunikation thematisieren und ob sie ausreichend auf interkulturelle Unterschiede vorbereiten.
- Quote paper
- Julia Basakina (Author), 2013, Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275902