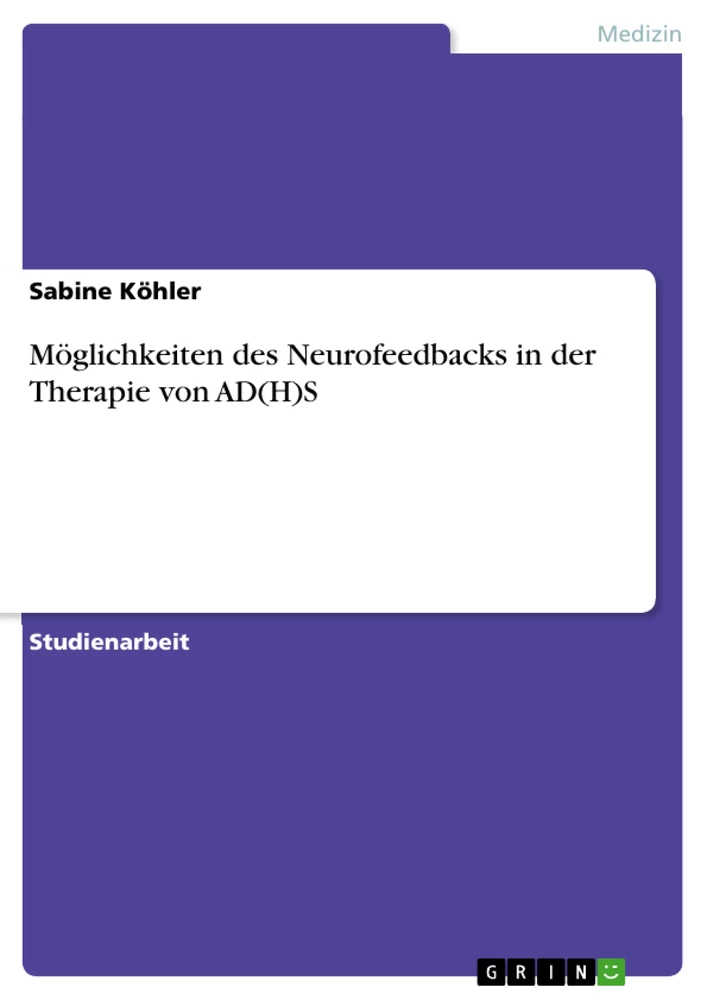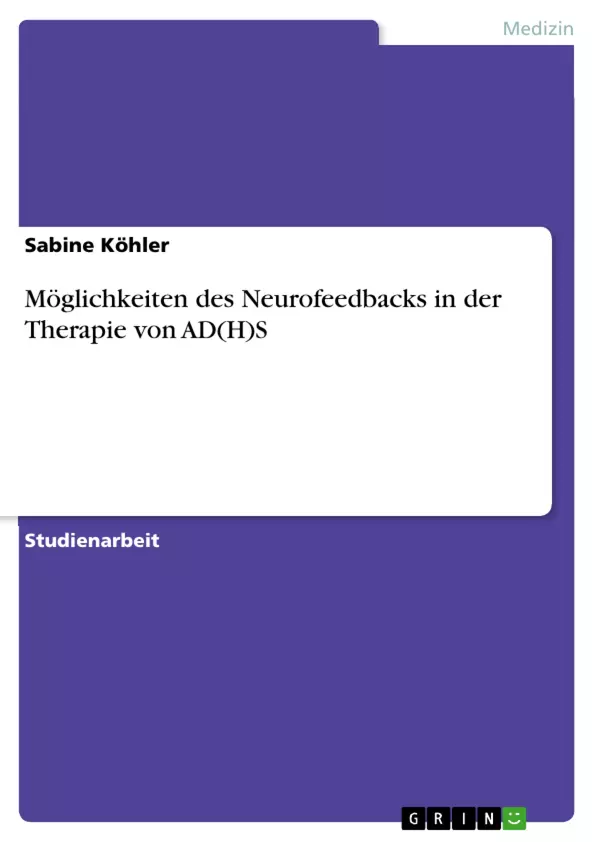Neurofeedback, auch EEG-Biofeedback genannt, bezeichnet die visuelle oder akustische Rückmeldung bestimmter Signale des Körpers, genauer der Hirnstromaktivität, die der Mensch unter normalen Bedingungen nicht wahrnehmen kann. Durch die Bewusstmachung der im Körper ablaufenden Prozesse soll es möglich werden, auf die eigenen cerebralen Erregungszustände Einfluss zu nehmen und diese dauerhaft zu verändern. Verschiedenen Krankheitssymptomen, die mit einer Störung der Regulation cortikaler und subcortikaler Strukturen einhergehen, soll auf diese Weise begegnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Ziele und Funktionsweise des Neurofeedback
- Einsatzbereiche des Neurofeedback
- Ein kurzer historischer Abriss
- Neurophysiologische Parameter der Gehirnaktivität
- Die Frequenzbänder der Grundaktivität im Spontan-EEG
- Ereigniskorrelierte Potentiale
- Neurofeedback in der Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität
- Die Leitsymptome einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
- Besonderheiten der Hirnstromaktivität bei Aufmerksamkeitsstörungen
- Empirische Studien und Behandlungseffekte
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Theoriearbeit befasst sich mit dem Neurofeedback als Therapiemethode für AD(H)S. Ziel ist es, die Funktionsweise des Neurofeedbacks zu erläutern, seine Einsatzbereiche aufzuzeigen und die empirischen Befunde zur Wirksamkeit bei AD(H)S zu beleuchten.
- Funktionsweise des Neurofeedbacks
- Einsatzbereiche des Neurofeedbacks
- Neurophysiologische Grundlagen von AD(H)S
- Empirische Befunde zur Wirksamkeit des Neurofeedbacks bei AD(H)S
- Potenzial und Herausforderungen des Neurofeedbacks in der AD(H)S-Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Funktionsweise des Neurofeedbacks. Es wird erklärt, wie die Hirnstromaktivität gemessen und visualisiert wird, und wie der Patient durch die Rückmeldung lernen kann, seine Gehirnaktivität zu beeinflussen. Das zweite Kapitel beleuchtet die vielfältigen Einsatzbereiche des Neurofeedbacks, von der Behandlung von Epilepsie und emotionalen Störungen bis hin zur Steigerung der mentalen Leistungsfähigkeit im Spitzensport. Das dritte Kapitel gibt einen kurzen historischen Abriss der Entwicklung des Neurofeedbacks, beginnend mit den Vorarbeiten von Thorndike, Pawlow und Berger bis hin zu den wegweisenden Arbeiten von Barry Stermann und Joel Lubar. Das vierte Kapitel befasst sich mit den neurophysiologischen Parametern der Gehirnaktivität, insbesondere mit den Frequenzbändern der Grundaktivität im Spontan-EEG und den ereigniskorrelierten Potentialen. Das fünfte Kapitel widmet sich dem Einsatz des Neurofeedbacks in der Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität. Es werden die Leitsymptome einer AD(H)S-Störung, die Besonderheiten der Hirnstromaktivität bei Aufmerksamkeitsstörungen und die Ergebnisse empirischer Studien zur Wirksamkeit des Neurofeedbacks bei AD(H)S beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Neurofeedback, EEG-Biofeedback, AD(H)S, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Hirnstromaktivität, Selbstregulation, Therapie, Behandlung, empirische Studien, Wirksamkeit, Einsatzbereiche, Geschichte, Neurophysiologie, Frequenzbänder, Potentiale, Leitsymptome, Behandlungseffekte.
Häufig gestellte Fragen
Was genau versteht man unter Neurofeedback?
Neurofeedback, auch EEG-Biofeedback genannt, ist eine Methode zur visuellen oder akustischen Rückmeldung der Hirnstromaktivität, um die Selbstregulation des Gehirns zu trainieren.
Wie kann Neurofeedback bei der Behandlung von AD(H)S helfen?
Durch die Bewusstmachung zerebraler Erregungszustände lernen Patienten, ihre Aufmerksamkeit und Impulsivität besser zu steuern und ihre Gehirnaktivität dauerhaft positiv zu verändern.
Welche neurophysiologischen Parameter werden beim Neurofeedback gemessen?
Es werden primär die Frequenzbänder der Grundaktivität im Spontan-EEG sowie ereigniskorrelierte Potentiale analysiert.
In welchen anderen Bereichen außer AD(H)S wird Neurofeedback eingesetzt?
Die Methode findet Anwendung bei Epilepsie, emotionalen Störungen und zur Steigerung der mentalen Leistungsfähigkeit im Spitzensport.
Gibt es wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit von Neurofeedback?
Ja, die Arbeit beleuchtet verschiedene empirische Studien und Behandlungseffekte, die die positiven Auswirkungen auf die Leitsymptome von AD(H)S zeigen.
- Quote paper
- Diplom-Psychologin, Integrative Lerntherapie (M.A.) Sabine Köhler (Author), 2010, Möglichkeiten des Neurofeedbacks in der Therapie von AD(H)S, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275992