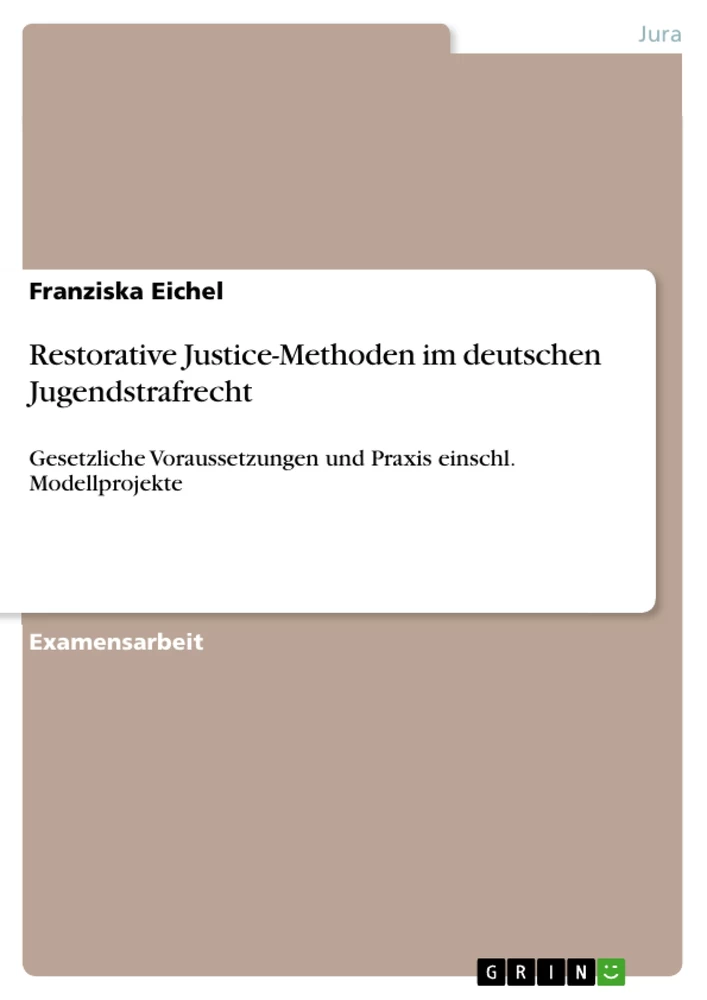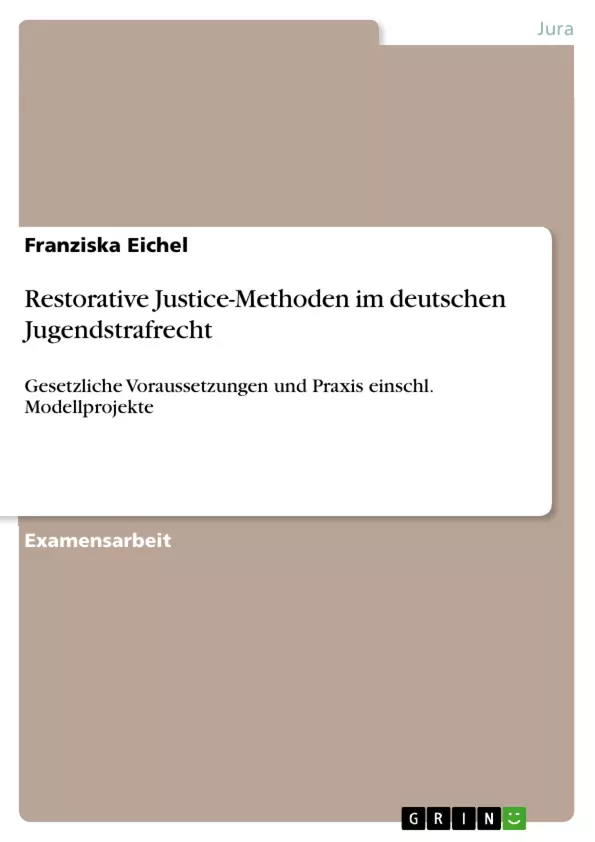Entgegen der Ansicht von „Deutschlands härtestem Jugendrichter“ Andreas Müller, der sich für schnellere und vor allem härtere Sanktionen gegen junge Täter einsetzt, hat kriminologischen Studien zufolge die freiheitsentziehende Jugendstrafe kaum eine abschreckende Wirkung für Jugendliche , da sie wenig mit dem verursachten Unrecht und Schaden konfrontiert werden. Im Rahmen dieser allgegenwärtigen Diskussion wird eines besonders deutlich: die deutsche Strafjustiz und das allgemeine öffentliche Interesse drehen sich noch primär um die Fragen, gegen welches Gesetz verstoßen wurde, welche Sanktion dafür verhängt werden sollte und wer der Täter ist. Das Opfer der Straftat wird im Strafverfahren häufig an den Rand gedrängt, eine Zeugenaussage wird aufgenommen, eine Neben- oder Privatklage ist jedoch nur in bestimmten Fällen zulässig. Grundsätzlich kann das Opfer deshalb im Strafverfahren keine Wiedergutmachung des erlittenen Schadens erhalten, da nur der Staat Träger des Strafanspruchs ist. Um den Schaden dennoch ersetzt zu bekommen, kann zwar der zeit- und kostenaufwändige Weg eines Zivilverfahrens beschritten werden, jedoch bleiben für das Opfer auch danach oft ungelöste Fragen sowie die Angst, dass der Täter aus der Haft entlassen wird und die Tat wiederholen könnte. Aus diesen Gründen haben andere Formen der Tataufarbeitung und Wiedergutmachung in Form von Restorative Justice (RJ) - Methoden in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen. Besonders im deutschen Jugendstrafrecht spielen diese eine wichtige Rolle, da sie auch der Erziehung der Jugendlichen und der Rückfallprävention gem. § 2 Abs. 1 S. 2 JGG dienen und ebenso für das Opfer viele Vorteile und Möglichkeiten gegenüber einem herkömmlichen Strafverfahren zu bieten haben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Restorative Justice - Methoden
- I. Begriffsbestimmung
- II. Methoden des Restorative Justice im deutschen Jugendstrafrecht
- 1) Der Täter-Opfer-Ausgleich
- a) Einführung
- b) Gesetzliche Voraussetzungen
- aa) Einstellung im Vorverfahren nach § 45 Abs. 2 S. 2 JGG
- (1) Anregung des TOA
- (2) Bemühen um einen TOA
- (3) Gesicherter Tatverdacht
- (4) Rechtsfolge
- bb) Einstellung im Vorverfahren nach § 45 Abs. 3 JGG
- cc) Einstellung im Hauptverfahren, § 47 Abs. 2, 3 JGG
- dd) Bewährungsauflage, § 23 Abs. 1 JGG
- ee) Aussetzung zur Bewährung, § 88 Abs. 6 S. 1 JGG
- ff) Resümee
- c) TOA in der Praxis
- aa) Durchführung
- (1) Ablauf eines TOA
- (2) Mediationsvarianten
- (3) Ergebnis eines TOA
- bb) Vorteile des Täter-Opfer-Ausgleichs
- (1) Für das Opfer
- (2) Für den Täter
- cc) Kritik
- dd) Erfolg
- ee) Resümee
- 2) Schülergremien (SG)
- a) Grundlagen
- b) Gesetzliche Voraussetzungen
- c) Praktische Durchführung
- d) Bewertung
- e) Zusammenfassung
- 3) Anti-Gewalt-Training (AGT)
- 4) Schulmediation (SchM)
- C. Modellprojekte
- I) TOA in der JVA Oslebshausen
- II) Tatausgleich für Kinder
- III) Modellprojekt Elmshorn – Gemeinschaftskonferenzen (GMK)
- IV) Friedenszirkel (FZ)
- V. Resümee
- D. Ausblick
- ANLAGEN
- Anlage 1 - Mind-Map Restorative Justice
- Anlage 2 - Fallaufkommen von TOA in Deutschland
- Anlage 3 - Alter der Täter
- Anlage 4 - Deliktsstruktur von TOA-Fällen im Jahr 2012
- Anlage 5 - Anregung eines TOA in verschiedenen Verfahrensstadien
- Anlage 6 - Diversion bzw. Verurteilung im Jahr 2012
- Anlage 7 - Anregung eines TOA
- Anlage 8 - Einstellung bzw. Verurteilung im Jahr 2012
- II,ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- III,LITERATURVERZEICHNIS
- Begriffsbestimmung und Methoden des Restorative Justice
- Täter-Opfer-Ausgleich als zentrale Methode im Jugendstrafrecht
- Analyse von Modellprojekten zur Umsetzung von Restorative Justice
- Bewertung der Wirksamkeit und der Herausforderungen von Restorative Justice
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Restorative Justice
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienabschlussarbeit befasst sich mit dem Thema Restorative Justice im deutschen Jugendstrafrecht. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden des Restorative Justice im Jugendstrafrecht zu analysieren und deren praktische Anwendung in Modellprojekten zu beleuchten. Dabei werden die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden sowie deren Auswirkungen auf die Opfer, Täter und das Strafrechtssystem untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Restorative Justice ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Jugendstrafrechts. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Kapitel B befasst sich mit den verschiedenen Methoden des Restorative Justice im deutschen Jugendstrafrecht. Es werden die rechtlichen Grundlagen und die praktische Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs, der Schülergremien, des Anti-Gewalt-Trainings und der Schulmediation erläutert. Dabei werden die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie die Erfolgsfaktoren der einzelnen Methoden beleuchtet.
Kapitel C analysiert verschiedene Modellprojekte zur Umsetzung von Restorative Justice in der Praxis. Es werden die Projekte TOA in der JVA Oslebshausen, Tatausgleich für Kinder, Modellprojekt Elmshorn – Gemeinschaftskonferenzen (GMK) und Friedenszirkel (FZ) vorgestellt. Die Analyse fokussiert auf die spezifischen Merkmale der Projekte, die Erfahrungen und die Ergebnisse der Umsetzung.
Der Ausblick fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die zukünftige Entwicklung des Restorative Justice im deutschen Jugendstrafrecht. Es werden mögliche Herausforderungen und Chancen für die Weiterentwicklung des Konzepts aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Restorative Justice, Jugendstrafrecht, Täter-Opfer-Ausgleich, Schülergremien, Anti-Gewalt-Training, Schulmediation, Modellprojekte, Wirksamkeit, Herausforderungen, Ausblick.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Restorative Justice (RJ) Methoden?
RJ-Methoden sind alternative Formen der Tataufarbeitung, die auf Wiedergutmachung und den Dialog zwischen Täter und Opfer setzen, statt nur auf Strafe.
Was ist der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)?
Der TOA ist die zentralste RJ-Methode in Deutschland, bei der Täter und Opfer unter Anleitung eines Mediators versuchen, den Konflikt außergerichtlich zu lösen.
Welche Vorteile bietet der TOA für das Opfer?
Opfer können Fragen stellen, Ängste abbauen und erhalten schneller eine materielle oder immaterielle Wiedergutmachung als im Zivilverfahren.
Wann kann ein Verfahren im Jugendstrafrecht eingestellt werden?
Nach § 45 oder § 47 JGG kann ein Verfahren eingestellt werden, wenn sich der Jugendliche ernsthaft um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemüht hat.
Was sind Schülergremien oder „Teen Courts“?
Es sind Gremien, in denen Gleichaltrige über Sanktionen für leichte Delikte entscheiden, um die soziale Akzeptanz und Einsicht des Täters zu erhöhen.
- Citation du texte
- Franziska Eichel (Auteur), 2014, Restorative Justice-Methoden im deutschen Jugendstrafrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276000