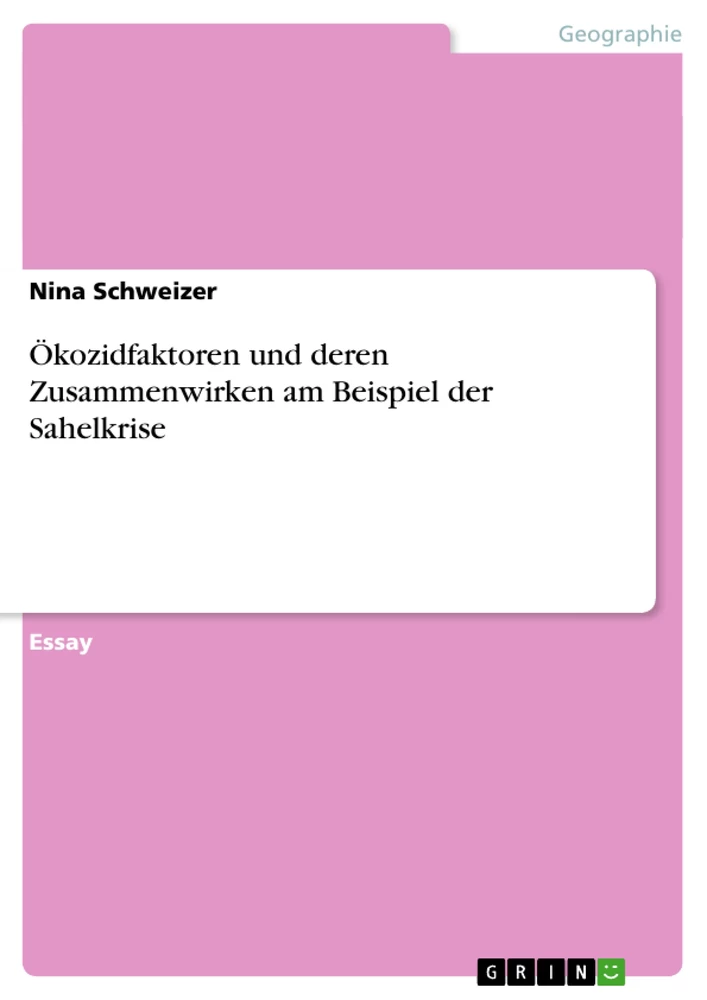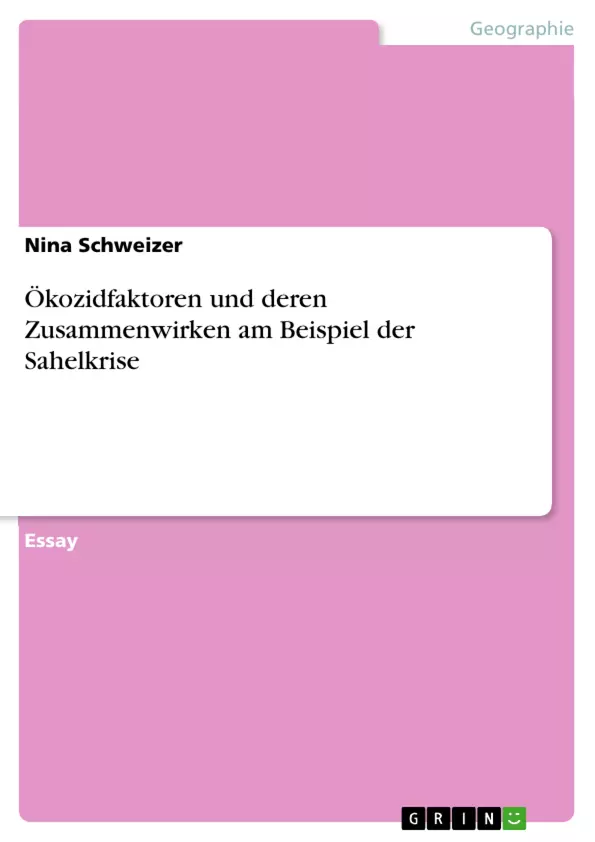Die Dürreperiode, die in den 70er Jahren die Sahelzone heimgesucht hat, löste eine lang andauernde Krise aus. Die daraus resultierende Desertifikation zwang viele Menschen ihre Lebensweise aufzugeben und in andere Regionen zu ziehen, vor allem in die Städte. Wie bei anderen Ökoziden, bewegten sich in diesem Fall Menschen aufgrund veränderter Umweltbedingungen von einem Gebiet weg. Inwiefern nun diese Veränderungen anthropogenen Ursprungs sind, soll im einem ersten Punkt anhand von verschiedenen Faktoren ermittelt werden, welche in einem zweiten Schritt den (untenstehenden) Ökozidfaktoren zugeordnet werden sollen.
Ökozidfaktoren:
1) Umweltschäden durch Umweltnutzung
2) Freundliche Handelspartner
3) Feindliche Nachbarn
4) Externe Veränderungen
5) Reaktion der Gesellschaft auf die Umweltveränderungen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Der Ursachenkomplex der Sahelkrise
- 2.1 Klimatische Bedingungen
- 2.2 Die Nutzung der Sahelzone
- 2.2.1 Traditionelle Nutzungssysteme
- 2.2.2 Nutzung der Sahelzone nach der Dürre der 70er
- 2.2.3 Cash Crops und Wirtschaftsbeziehungen
- 2.2.4 Energieversorgung
- 2.2.5 Entwicklungshilfe
- 2.2.6 Landflucht und Verstädterung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Ursachen der Sahelkrise, die in den 1970er Jahren durch eine Dürreperiode ausgelöst wurde. Ziel ist es, die verschiedenen Faktoren zu analysieren, die zur Desertifikation und den daraus resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Problemen beigetragen haben. Dabei wird untersucht, inwiefern diese Veränderungen anthropogenen Ursprungs sind.
- Klimatische Bedingungen und ihre Rolle in der Sahelkrise
- Traditionelle und moderne Nutzungssysteme der Sahelzone
- Die Auswirkungen von Cash Crops und Wirtschaftsbeziehungen auf die Umwelt
- Der Einfluss von Entwicklungshilfe und Landflucht auf die Sahelkrise
- Die Rolle der Desertifikation und ihre Folgen für die Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Sahelkrise und ihre Folgen vor. Sie beschreibt die Desertifikation, die zur Folge hatte, dass viele Menschen ihre Lebensweise aufgeben mussten und in andere Regionen zogen. Die Arbeit untersucht, inwiefern diese Veränderungen anthropogenen Ursprungs sind.
Das zweite Kapitel analysiert die Ursachen der Sahelkrise. Es werden die klimatischen Bedingungen, die Nutzung der Sahelzone, die Auswirkungen von Cash Crops und Wirtschaftsbeziehungen, der Einfluss von Entwicklungshilfe und Landflucht sowie die Rolle der Desertifikation untersucht.
Das Kapitel über die klimatischen Bedingungen beschreibt die jährlichen Niederschlagsmengen in der Sahelzone und ihre Variabilität. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verteilung der Niederschläge ein Problem darstellt und dass die Schwankungsperioden seit den 1950er Jahren dauerhafter geworden sind.
Das Kapitel über die Nutzung der Sahelzone untersucht die traditionellen Nutzungssysteme der Nomaden und sesshaften Bauern. Es wird gezeigt, dass die Kolonialisierung und die damit einhergehende Grenzziehung die sozialen Beziehungen erschwerte und die neu auferlegten Steuern die Bauern zur Cash Crop Produktion zwangen. Die Intensivierung des Ackerbaus und die Vergrösserung der Viehbestände führten zu einer Destabilisierung des Nutzungssystems.
Das Kapitel über die Nutzung der Sahelzone nach der Dürre der 1970er Jahre beschreibt die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die Nutzung der Sahelzone. Es wird gezeigt, dass die verkürzten Brachezeiten und der Mangel an technologischer Verbesserung im Ackerbau zu einer ökologischen Belastung führten. Die Bodendegradation hatte sinkende Erträge zur Folge und führte zu einer Ausdehnung der Kulturfläche auf ökologisch ungünstigere Regionen.
Das Kapitel über Cash Crops und Wirtschaftsbeziehungen untersucht die Auswirkungen der Umwandlung der traditionellen Bewirtschaftung auf die Cash Crop Produktion. Es wird gezeigt, dass die betroffenen Bauern die Kontrolle über ihr Land verloren und dass die Zunahme der Cash Crop Produktion zu einer verstärkten ökologischen Belastung führte.
Das Kapitel über die Energieversorgung beschreibt die Abholzung als weiteren Faktor, der zur Desertifikation beitrug. Die stark wachsenden Städte durch Landflucht und Bevölkerungszunahme hatten einen grossen Energiebedarf, der vor allem in den ländlichen Gebieten durch Holz gedeckt wurde.
Das Kapitel über die Entwicklungshilfe untersucht die Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf die Sahelkrise. Es wird gezeigt, dass die Nahrungsmittellieferungen zu einem starken Pull-Faktor wurden und neue Abhängigkeiten vom Ausland schufen. Die medizinische Modernisierung führte zu einer Verringerung der Sterbeziffer und damit zu einem weiteren Bevölkerungswachstum. Der Bau von modernen Tiefbrunnen führte zu einer Überweidung und Übernutzung der umliegenden Gebiete und förderte die Desertifikation.
Das Kapitel über Landflucht und Verstädterung beschreibt die Auswirkungen der Sahelkrise auf die Landflucht und die Verstädterung. Es wird gezeigt, dass die Landflucht zu einem Mangel an Arbeitskräften in ländlichen Regionen führte und dass die Bevölkerung in den Städten ständig zunahm. Die kontrollierten Grundnahrungspreise verstärkten die Landflucht und bremsten die Entwicklung der Landbevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sahelkrise, Desertifikation, anthropogene Einflüsse, klimatische Bedingungen, traditionelle Nutzungssysteme, Cash Crops, Wirtschaftsbeziehungen, Entwicklungshilfe, Landflucht, Verstädterung, Bodendegradation, Überweidung, Übernutzung, Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittelproduktion, ökologische Belastung, nachhaltige Bewirtschaftung, Vulnerabilität, Pull-Faktor, Terms of Trade, Agrarsysteme, Nomadismus, Sesshaftwerdung, Transhumanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen der Sahelkrise?
Die Krise wurde durch eine Kombination aus klimatischen Bedingungen (Dürre) und anthropogenen Faktoren wie Übernutzung und falscher Agrarpolitik ausgelöst.
Was versteht man unter Desertifikation im Sahel?
Es ist die fortschreitende Wüstenbildung durch Bodendegradation, verursacht durch menschliche Eingriffe und klimatische Schwankungen.
Welchen Einfluss hatten Cash Crops auf die Umwelt?
Der Anbau von Exportfrüchten (Cash Crops) verdrängte traditionelle Anbaumethoden, führte zur Übernutzung der Böden und destabilisierte die lokale Nahrungsmittelversorgung.
Wie wirkte sich die Entwicklungshilfe auf die Region aus?
Entwicklungshilfe schuf teils neue Abhängigkeiten und förderte durch den Bau von Tiefbrunnen eine punktuelle Überweidung, was die Desertifikation beschleunigte.
Warum kam es zu massiver Landflucht?
Die Zerstörung der Lebensgrundlagen auf dem Land zwang viele Menschen zur Abwanderung in die Städte, was dort zu unkontrollierter Verstädterung führte.
- Quote paper
- Nina Schweizer (Author), 2010, Ökozidfaktoren und deren Zusammenwirken am Beispiel der Sahelkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276022