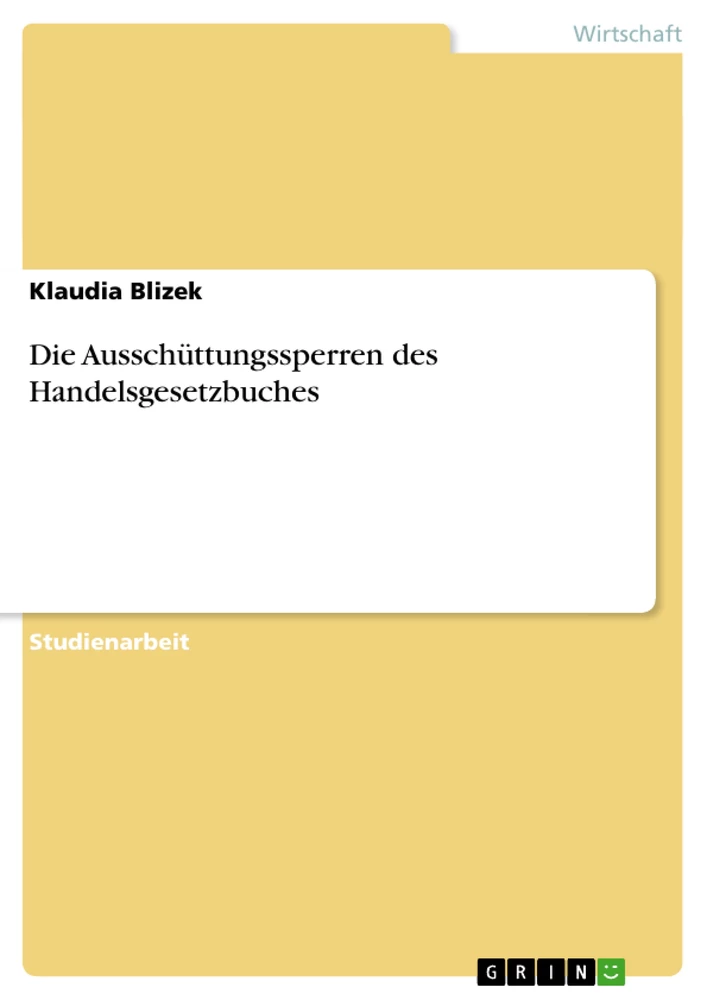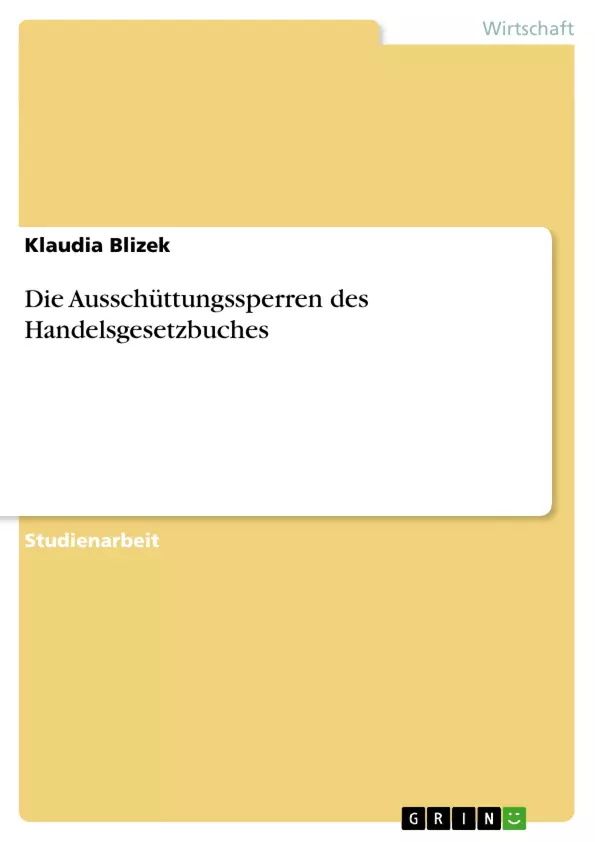Im Allgemeinen streben Unternehmen die Erzielung eines Gewinnes an. Das Instrument zur Feststellung des Gewinnes bildet der Jahresabschluß. Seine Funktionen lassen sich in betriebswirtschaftliche Funktionen, wie Erhaltungs- und Informationsfunktion sowie jene Funktionen, die das Rechtsverhältnis zwischen Unternehmen einerseits und Gesellschafter bzw. Fiskus andererseits bestimmen, einteilen. Zu den letztgenannten Aufgaben zählen vor allem die Steuerbemessungsfunktion und die Ausschüttungsbemessungsfunktion (vgl. Egger/Samer/Bertl 2002, S. 16). Bertl/Deutsch/Hirschler (vgl. 201, S. 222f.) sprechen der Bilanz eine Ausschüttungsregelungsfunktion zu, wobei sie in diesem Zusammenhang der Ausschüttungssperrfunktion besondere Beachtung zukommen lassen. Von besonderer Bedeutung ist die Gewinnausschüttung, insbesondere bei Unternehmen mit beschränkter Haftung auf die Kapitaleinlage. Im Sinne des Gläubigerschutzes soll die Erhaltung des haftenden Kapitals sichergestellt werden (Kapitalerhaltungsfunktion). Das Handelsgesetz kennt im einzelnen folgende Ausschüttungssperren: § 225 Abs. (5) sieht bei Bilanzierung eigener Anteile sowie bei Bilanzierung von Anteilen an herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen den Ausweis einer Rücklage in gleicher Höhe auf der Passivseite vor. § 226 Abs. (2) bestimmt, daß bei Aktivierung von Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes Gewinne nur ausgeschüttet werden dürfen, soweit die danach verbleibenden jederzeit auflösbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrages dem ausgewiesenen Betrag mindestens entsprechen. Gemäß § 235 darf der ausschüttbare Gewinn eines Geschäftsjahres um Zuschreibungen, Erträge aufgrund der Auflösung von Bewertungsreserven sowie Erträgen aufgrund der Auflösung von Kapitalrücklagen nicht vermehrt werden.
Ausschüttungssperren dienen in erster Linie dem Gläubigerschutz und sollen eine Ausschüttung von reinen Buchgewinnen verhindern. Durch die Ausschüttung von Buchgewinnen wird die Substanz des Unternehmens zu Lasten der Gläubiger angegriffen. Durch die gesetzlich normierten Ausschüttungssperren wird der Zielkonflikt zwischen der Informationsfunktion und der Ausschüttungsregelungsfunktion des Jahresabschlusses gemindert (vgl. Bertl/Fraberger, RWZ 2000, S. 274).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Allgemeine Funktion von Ausschüttungssperren
- 1.2 Sinn und Zweck einer Ausschüttungssperre
- 1.3 Problemstellung
- 2. Ausschüttungssperre gem. § 225 (5) HGB
- 2.1 Erwerb eigener Anteile
- 2.2 Bilanzierung eigener Anteile
- 2.2.1 Ausweis
- 2.2.2 Bewertung
- 2.3 Rücklage für eigene Anteile
- 2.3.1 Zweck der Rücklage
- 2.3.2 Bildung der Rücklage
- 2.3.2.1 Frei verfügbare Teile des Eigenkapitals reichen zur Bildung der Rücklage aus
- 2.3.2.2 Frei verfügbare Teile des Eigenkapitals reichen zur Bildung der Rücklage nicht aus
- 2.3.3 Auflösung der Rücklage
- 3. Ausschüttungssperre gem. § 226 (2) HGB
- 3.1 Auswirkungen des § 226 (2) auf Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung
- 3.1.1 Begriffe
- 3.1.1.1 Ingangsetzung und Erweiterung
- 3.1.1.2 Gebundene und ungebundene Rücklagen
- 3.1.2 Gesetzliche Regelungen und Voraussetzungen für die Aktivierung von Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung
- 3.1.3 Ausschüttungssperre
- 3.1.3.1 Zweck der Sperre
- 3.1.3.2 Ermittlung der Höhe der Ausschüttungsbeschränkung
- 3.1.3 Steuerliche Relevanz
- 3.2 Auswirkungen des § 226 (2) auf Latente Steuern
- 3.2.1 Begriffe
- 3.2.2 Ermittlung der latenten Steuern
- 3.2.3 Ausschüttungssperre
- 4. Ausschüttungssperre gem. § 235 HGB
- 4.1 Ausschüttungssperre gem. § 235 Z. 1 HGB
- 4.1.1 Begriffe
- 4.1.2 Ermittlung der Höhe der Sperre
- 4.2 Ausschüttungssperre gem. § 235 Z. 2 HGB
- 4.2.1 Begriffe
- 4.2.2 Ermittlung der Höhe der Sperre
- 4.3 Ausschüttungssperre gem. § 235 Z. 3 HGB
- 4.3.1 Kapitalrücklagen aus Umgründungen
- 4.3.2 Ausschüttungssperre infolge einer Umgründung
- 5. Zusammenfassung der Problemstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Ausschüttungssperren im Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere im Hinblick auf die seit dem GesRÄG 1996 geltenden, EU-konformen Regelungen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der einzelnen Sperren und deren Auswirkungen auf die Gewinnausschüttung von Unternehmen.
- Analyse der verschiedenen Ausschüttungssperren im HGB (§ 225 (5), § 226 (2), § 235).
- Erklärung der jeweiligen Zwecke und Funktionen der Sperren im Kontext des Gläubigerschutzes.
- Detaillierte Beschreibung der Berechnung der Ausschüttungsbeschränkungen.
- Untersuchung der Auswirkungen der Sperren auf die Bilanzierung und die Gewinnverwendung.
- Veranschaulichung der Problematik anhand von Beispielen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Ausschüttungssperren ein und erläutert die allgemeine Funktion und den Zweck dieser Vorschriften im Kontext der Bilanzierung und des Gläubigerschutzes. Es wird auf den Zielkonflikt zwischen Informationsfunktion und Ausschüttungsregelungsfunktion des Jahresabschlusses hingewiesen und die Problemstellung der Arbeit definiert, die darin besteht, einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Ausschüttungssperren im HGB zu geben.
2. Ausschüttungssperre gem. § 225 (5) HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bilanzierung eigener Anteile und Anteilen an herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen. Es erläutert die Regelungen zur Ausweisung und Bewertung dieser Anteile im Anlage- oder Umlaufvermögen und beschreibt detailliert die Bildung und Auflösung der Rücklage für eigene Anteile, die im Zusammenhang mit dieser Bilanzierung steht. Die geänderten Vorschriften seit dem EU-GesRÄG 1996 werden im Detail beleuchtet.
3. Ausschüttungssperre gem. § 226 (2) HGB: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von § 226 (2) HGB auf die Aktivierung von Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung eines Betriebs. Es definiert relevante Begriffe wie "gebundene" und "ungebundene" Rücklagen und untersucht die gesetzlichen Regelungen und Voraussetzungen für die Aktivierung dieser Aufwendungen. Die daraus resultierende Ausschüttungssperre und deren Zweck werden ausführlich diskutiert, ebenso wie die steuerliche Relevanz. Zusätzlich wird die Auswirkung auf latente Steuern behandelt, inklusive der Berechnung und der daraus folgenden Ausschüttungsbeschränkungen.
4. Ausschüttungssperre gem. § 235 HGB: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Ausschüttungssperren gemäß § 235 HGB. Es unterteilt die Regelung in drei Ziffern und analysiert jede einzeln. Für jede Ziffer werden die relevanten Begriffe erklärt und die Methode zur Ermittlung der Höhe der jeweiligen Sperre detailliert beschrieben. Ein besonderer Fokus liegt auf den Kapitalrücklagen aus Umgründungen und der daraus resultierenden Ausschüttungssperre.
Schlüsselwörter
Ausschüttungssperren, Handelsgesetzbuch (HGB), § 225 (5) HGB, § 226 (2) HGB, § 235 HGB, Bilanzierung, eigene Anteile, Rücklagen, Gläubigerschutz, Gewinnverwendung, EU-Richtlinien, GesRÄG 1996, latente Steuern, Kapitalrücklagen, Umgründungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ausschüttungssperren im HGB"
Was ist der Gegenstand des Dokuments "Ausschüttungssperren im HGB"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Ausschüttungssperren im Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere § 225 (5) HGB, § 226 (2) HGB und § 235 HGB. Es analysiert deren Zweck, Funktion, Berechnung der Ausschüttungsbeschränkungen und Auswirkungen auf die Bilanzierung und Gewinnverwendung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der einzelnen Sperren im Kontext des Gläubigerschutzes und der EU-konformen Regelungen seit dem GesRÄG 1996.
Welche Ausschüttungssperren werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt detailliert die Ausschüttungssperren gemäß § 225 (5) HGB (bezogen auf die Bilanzierung eigener Anteile), § 226 (2) HGB (bezogen auf Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung sowie latente Steuern) und § 235 HGB (mit Unterteilung in drei Ziffern, inkl. Kapitalrücklagen aus Umgründungen). Für jede Sperre werden die relevanten Begriffe definiert, die Berechnungsmethoden erläutert und die Auswirkungen auf die Gewinnverwendung beschrieben.
Welchen Zweck haben die Ausschüttungssperren im HGB?
Der Hauptzweck der Ausschüttungssperren liegt im Gläubigerschutz. Sie gewährleisten, dass das Eigenkapital des Unternehmens nicht durch Gewinnausschüttungen so weit reduziert wird, dass die Zahlungsfähigkeit gefährdet ist. Die einzelnen Sperren schützen vor unterschiedlichen Risiken, z.B. vor einer Gefährdung der Substanz durch den Erwerb eigener Anteile (§ 225 (5) HGB) oder vor einer übermäßigen Gewinnausschüttung, die die Finanzierung von notwendigen Investitionen beeinträchtigen könnte (§ 226 (2) HGB).
Wie werden die Ausschüttungsbeschränkungen berechnet?
Die Berechnung der Ausschüttungsbeschränkungen ist für jede der behandelten Paragrafen unterschiedlich und wird im Dokument detailliert beschrieben. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Höhe der Rücklagen, der Bewertung eigener Anteile, den Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung oder den latenten Steuern. Das Dokument liefert genaue Anleitungen zur Ermittlung der Höhe der jeweiligen Sperre.
Welche Auswirkungen haben die Ausschüttungssperren auf die Bilanzierung?
Die Ausschüttungssperren haben erhebliche Auswirkungen auf die Bilanzierung, insbesondere auf die Darstellung des Eigenkapitals und der Gewinnverwendung. Die Bildung von Rücklagen, die Ausweisung eigener Anteile und die Berücksichtigung latenter Steuern sind direkt von den jeweiligen Vorschriften beeinflusst. Das Dokument erklärt diese Zusammenhänge und die notwendigen Anpassungen in der Bilanz.
Welche Rolle spielen die EU-Richtlinien und das GesRÄG 1996?
Das GesRÄG 1996 (Gesetz zur Reform des Aktienrechts) hat die Vorschriften zu den Ausschüttungssperren an die EU-Richtlinien angepasst. Das Dokument berücksichtigt diese Änderungen und beleuchtet die Bedeutung der EU-Konformität der Regelungen im Kontext der Bilanzierung und des Gläubigerschutzes.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit Ausschüttungssperren wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ausschüttungssperren, Handelsgesetzbuch (HGB), § 225 (5) HGB, § 226 (2) HGB, § 235 HGB, Bilanzierung, eigene Anteile, Rücklagen (gebunden/ungebunden), Gläubigerschutz, Gewinnverwendung, EU-Richtlinien, GesRÄG 1996, latente Steuern, Kapitalrücklagen, Umgründungen. Das Dokument erklärt diese Begriffe im Detail.
- Quote paper
- Mag. Klaudia Blizek (Author), 2003, Die Ausschüttungssperren des Handelsgesetzbuches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27603