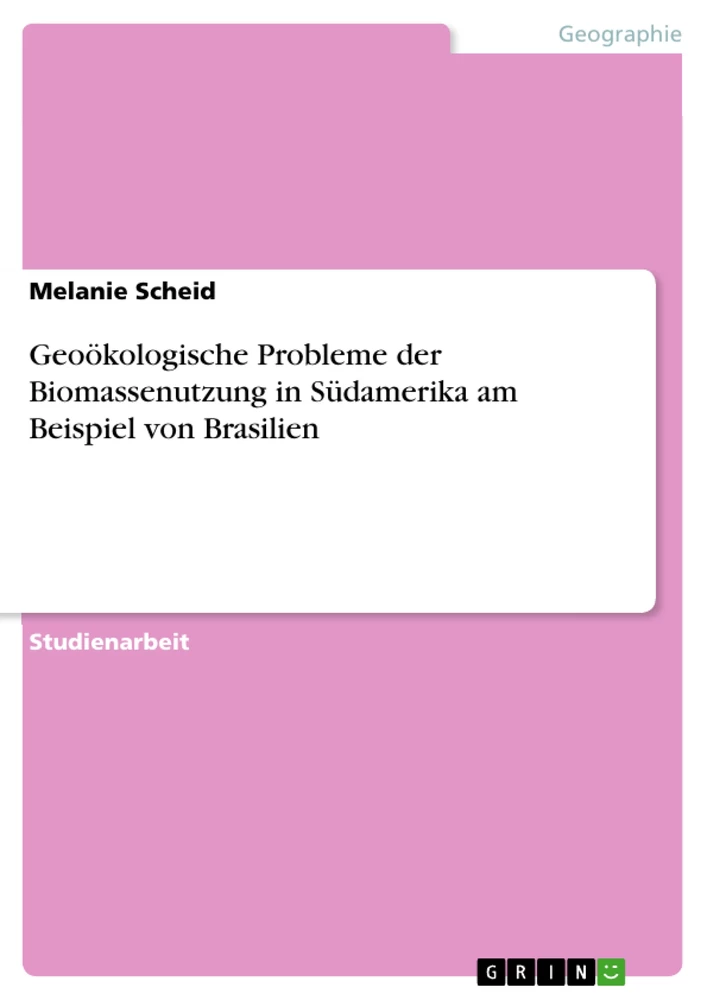„Die Zivilisation ist an einem Wendepunkt ihrer Energieversorgung […] angelangt“ (SCHEER 2004, S. 1), schreibt Herrmann Scheer (...) zu Klimawandel und erneuerbaren Energien. Fakt ist, dass angesichts des gestiegenen Energieverbrauchs konventionelle fossile Energiereserven bald aufgebraucht sein werden, Erdöl und Erdgas womöglich noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Es müssen also Alternativen gefunden werden, bevor sich die absteigende Kurve der fossilen Energiereserven und die steigende Kurve des Energiebedarfs kreuzen (vgl. ebd., S. 1).
Der Suche nach alternativen Energieträgern steht zudem das Kyoto-Protokoll gegenüber, das „eine Reduktion der klimaverändernden Treibhausgase um mindestens 60 Prozent im Jahr 2050“ (SCHEER, S. 3) vorschreibt. Die neuen Energieträger müssen also nicht nur ausreichend Energie liefern, sondern auch noch möglichst wenig (...) CO2 sowie weitere Treibhausgase produzieren.
Im Vordergrund steht auch die Nachhaltigkeit erneuerbarer Energien. Dies bedeutet nach den sog. drei Säulen der Nachhaltigkeit (oder auch Nachhaltigkeitsdreieck), dass ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt werden müssen (vgl. LEXIKON DER NACHHALTIGKEIT 2014, web.).
Die folgende Arbeit beschäftigt sich daher mit Nachhaltigkeitsproblemen, aber insbesondere mit den geoökologischen Problemen, der Biomassenutzung in Südamerika, am Beispiel des Anbaus und der Weiterverarbeitung von Zuckerrohr in Brasilien.
Hierbei wird zunächst der Begriff Biomasse definiert und ihre energetische Nutzung beschrieben. Es folgt eine Erläuterung der allgemeinen geoökologischen Probleme, die durch die Biomasse entstehen.
Anschließend wird am Fallbeispiel Brasilien auf die Probleme der Nutzung der Zuckerrohrpflanze als Energieträger eingegangen.
Dabei soll zunächst auf den Energiebedarf Brasiliens sowie die Eigenschaften von Zuckerrohr (...) eingegangen werden.
Daraus kann anschließend gefolgert werden, welche Voraussetzungen Brasilien für den Anbau dieser Pflanze bietet, hierbei wird einerseits näher auf das staatliche Proálcool-Programm der 1970er und 80er Jahre eingegangen und andererseits die heutige Bedeutung des Zuckerrohranbaus bzw. der Ethanolproduktion beleuchtet.
Welche geoökologischen Probleme aus der Nutzung von Biomasse aus Zuckerrohr entstanden sind bzw. noch entstehen, beschreibt das darauf folgende Kapitel.
Ein abschließendes Fazit soll die Rolle des Zuckerrohranbaus zur energetischen Nutzung sowie dessen Nachhaltigkeit bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biomasse
- Definition
- Energetische Nutzung der Biomasse
- Geoökologische Probleme der Biomassenutzung – allgemein
- Zuckerrohr als Energieträger
- Fallbeispiel Brasilien
- Energiebedarf Brasiliens
- Zuckerrohranbau in Brasilien
- Naturräumliche Grundlagen
- Entstehung des Proálcool-Programms
- Grünes Gold - Zuckerrohr als Wirtschaftsfaktor in der heutigen Zeit
- Geoökologische Probleme des Zuckerrohranbaus und der Nutzung von Bioethanol
- Flächenkonkurrenz Regenwald und Biomasseerzeugung
- Flächenkonkurrenz Nahrungsmittelanbau und Biomasseerzeugung
- Wassermangel
- Anbau von Monokulturen
- Mechanisierung
- Kontamination
- Freisetzung von CO2 aus Kohlenstoffsenken
- Verdrängung der Minifundien
- Verdrängung der indigenen Bevölkerung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Nachhaltigkeitsproblemen, insbesondere den geoökologischen Problemen, der Biomassenutzung in Südamerika, am Beispiel des Anbaus und der Weiterverarbeitung von Zuckerrohr in Brasilien. Ziel ist es, die Herausforderungen und Auswirkungen der Biomasseproduktion im Kontext der Energieversorgung und des Umweltschutzes zu beleuchten.
- Definition und energetische Nutzung von Biomasse
- Geoökologische Probleme der Biomassenutzung
- Energiebedarf Brasiliens und die Rolle des Zuckerrohranbaus
- Das Proálcool-Programm und die heutige Bedeutung des Zuckerrohranbaus
- Geoökologische Probleme des Zuckerrohranbaus und der Nutzung von Bioethanol
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und verdeutlicht die Bedeutung der Suche nach alternativen Energieträgern angesichts des Klimawandels und der begrenzten fossilen Ressourcen.
Kapitel 2 definiert den Begriff Biomasse und beschreibt ihre energetische Nutzung. Es werden auch die allgemeinen geoökologischen Probleme der Biomassenutzung beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Fallbeispiel Brasilien und untersucht den Energiebedarf des Landes sowie die Eigenschaften von Zuckerrohr als Energieträger. Es wird die Entstehung des Proálcool-Programms in den 1970er und 1980er Jahren sowie die heutige Bedeutung des Zuckerrohranbaus und der Ethanolproduktion beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt die geoökologischen Probleme, die aus der Nutzung von Biomasse aus Zuckerrohr entstanden sind und noch entstehen. Hierzu zählen Flächenkonkurrenz, Wassermangel, Anbau von Monokulturen, Mechanisierung, Kontamination, Freisetzung von CO2 aus Kohlenstoffsenken, Verdrängung der Minifundien und Verdrängung der indigenen Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Biomasse, Energieversorgung, Nachhaltigkeit, Zuckerrohr, Ethanolproduktion, Brasilien, Proálcool-Programm, geoökologische Probleme, Flächenkonkurrenz, Wassermangel, Monokulturen, CO2-Emissionen, indigene Bevölkerung.
- Quote paper
- Melanie Scheid (Author), 2014, Geoökologische Probleme der Biomassenutzung in Südamerika am Beispiel von Brasilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276084