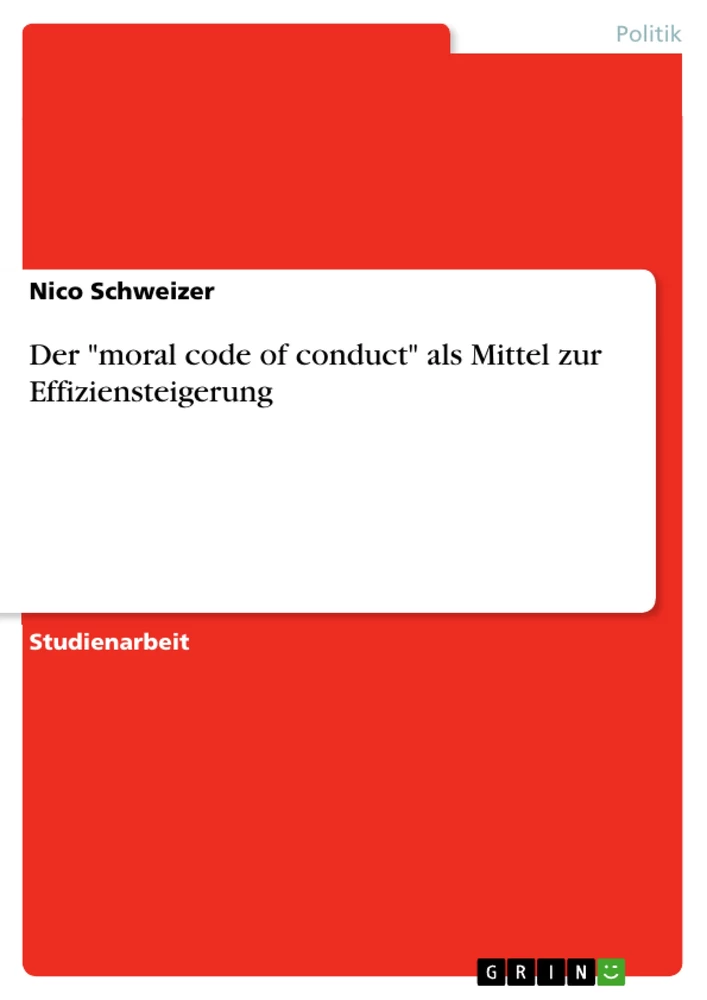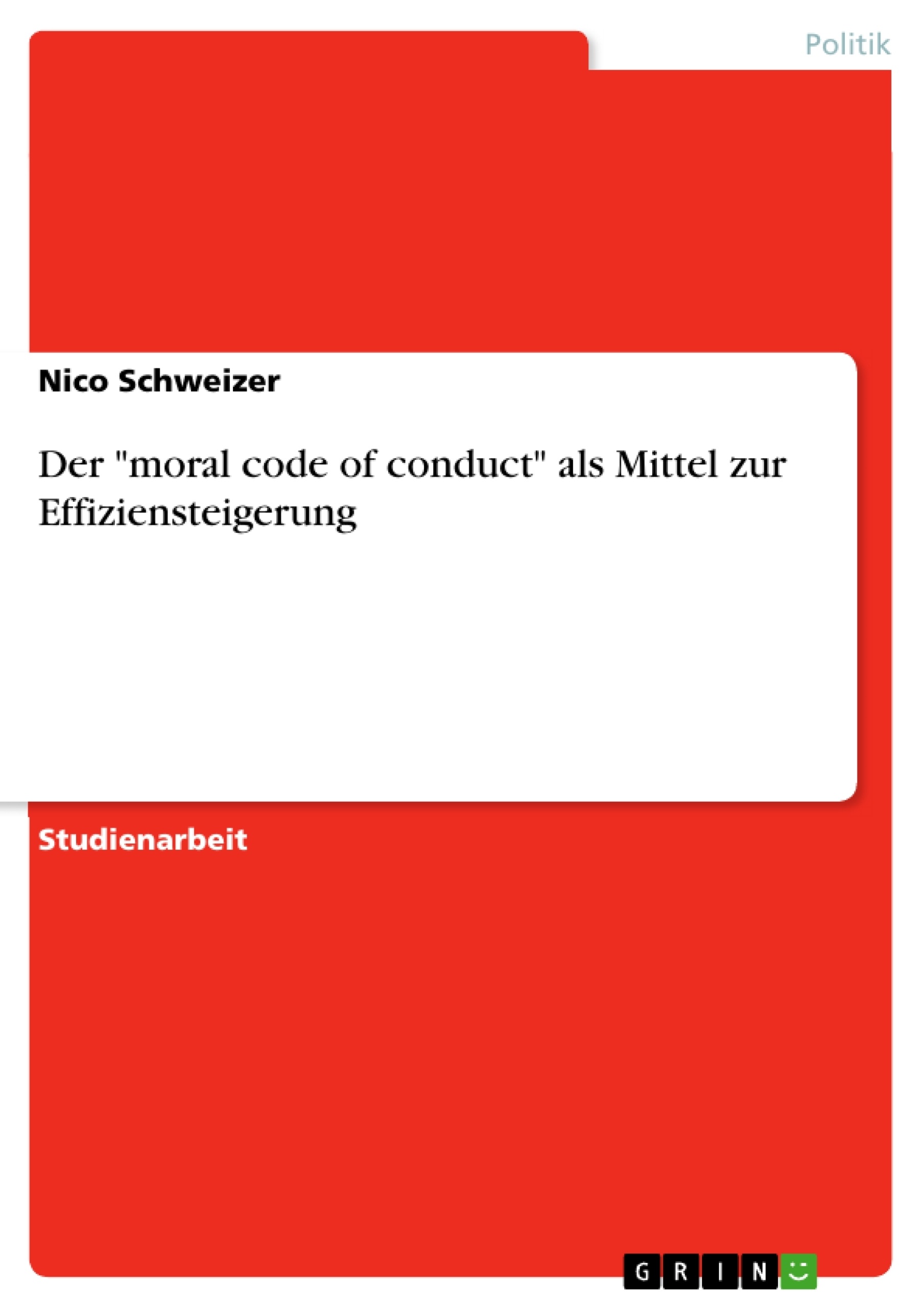Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann sich ein Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften zu entwickeln, der gemeinhin als „Institutionenökonomik “ bekannt ist. Seinen Höhepunkt (gemessen an der Anzahl der veröffentlichten Fachartikel) erreichte dieses breit gefächerte Feld wohl in den 1970er Jahren, als sich angesehene Ökonomen mit immer neuen Gedanken in ihren Abhandlungen kritisch auseinandersetzten und gegenseitig widerlegten.
Grundlegende Ansätze, die heute wie selbstverständlich in die Curricula der Betriebswirtschaft aufgenommen wurden, sind erst vor wenigen Jahrzehnten entwickelt worden und haben seitdem immens an Bedeutung gewonnen. Genannt seien hier beispielsweise der Property-Rights-Ansatz, der Transaktionskostenansatz und die Principal-Agent-Theorie.
Die Hauptvertreter der Verfügungsrechtstheorie, Armen A. Alchian und Harold Demsetz, erörterten in ihrem Artikel „Production, Information Costs, and Economic Organization“ von 1972 die Wirkung eines „moral code of conduct“, dessen Idee einige Jahre später von Josef Wieland aufgegriffen und weiterentwickelt wurde .
Dieser Gedanke ist Hauptbestandteil dieser Ausarbeitung und soll dabei auch auf die Principal-Agent-Theorie übertragen werden. Im Folgenden sollen zunächst die entscheidenden Begriffe fachlich definiert werden, um ein einheitliches Verständnis zu ermöglichen. Daraufhin wird die Idee des code of conduct erläutert und mögliche Wirkungen in der Zusammenarbeit einzelner Individuen diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Grundlegende Theorien der (neuen) Institutionenökonomik
- Property-Rights-Ansatz
- Transaktionskostenansatz
- Principal-Agent-Theorie
- Weitere Definitionen
- Code of Conduct
- Moral
- Ethik
- Team
- Das Ausgangsproblem
- Teamproduktion (Alchian & Demsetz)
- Agency Costs (Jensen & Meckling)
- Kurzzusammenfassung
- Implementierung eines “moral code of conduct”
- Die Grundidee
- Gestaltung und Einführung eines code of conduct
- Mögliche Effekte eines moral code of conduct
- Die Moral in ökonomischen Modellen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Einsatz eines „Moral Code of Conduct“ als Mittel zur Effizienzsteigerung innerhalb von Unternehmen. Sie analysiert, wie die Implementierung eines solchen Codes die Loyalität und den Teamgeist innerhalb von Organisationen fördern kann. Dabei werden relevante Theorien der (neuen) Institutionenökonomik, wie der Property-Rights-Ansatz, der Transaktionskostenansatz und die Principal-Agent-Theorie, herangezogen.
- Analyse des Property-Rights-Ansatzes und seiner Relevanz für den Einsatz eines „Moral Code of Conduct“
- Diskussion der Transaktionskosten und deren Einfluss auf die Effizienz von Teams
- Anwendung der Principal-Agent-Theorie auf die Implementierung eines „Moral Code of Conduct“
- Bewertung der möglichen Effekte eines „Moral Code of Conduct“ auf die Zusammenarbeit innerhalb von Teams
- Untersuchung der Integration von Moral in ökonomische Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz eines „Moral Code of Conduct“ für die Steigerung der Effizienz innerhalb von Unternehmen dar. Kapitel 2 behandelt grundlegende Theorien der (neuen) Institutionenökonomik, die für die Analyse des „Moral Code of Conduct“ relevant sind. Kapitel 3 definiert wichtige Begriffe wie „Code of Conduct“, „Moral“, „Ethik“ und „Team“. Kapitel 4 präsentiert das Ausgangsproblem der Teamproduktion und der damit verbundenen Agency Costs. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Implementierung eines „Moral Code of Conduct“, während Kapitel 6 mögliche Effekte eines solchen Codes diskutiert. Kapitel 7 untersucht die Integration von Moral in ökonomische Modelle.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die Steigerung der Effizienz, die Implementierung eines „Moral Code of Conduct“, Teamgeist, Loyalität, Property-Rights-Ansatz, Transaktionskostenansatz, Principal-Agent-Theorie, Moral, Ethik, Agency Costs und Teamproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Moral Code of Conduct“?
Es handelt sich um einen Verhaltenskodex, der moralische und ethische Richtlinien festlegt, um die Zusammenarbeit und Loyalität in Teams zu fördern.
Wie steigert ein Verhaltenskodex die Effizienz?
Durch die Reduzierung von Transaktionskosten und die Minderung von Agency-Problemen innerhalb der Teamproduktion kann die wirtschaftliche Leistung gesteigert werden.
Welche ökonomischen Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit nutzt den Property-Rights-Ansatz, den Transaktionskostenansatz und die Principal-Agent-Theorie der neuen Institutionenökonomik.
Was versteht man unter Agency Costs?
Agency Costs (Agenturkosten) entstehen durch Interessenkonflikte zwischen Auftraggebern (Principals) und Beauftragten (Agents) in einer Organisation.
Wer sind die Hauptvertreter der zugrundeliegenden Theorien?
Genannt werden unter anderem Alchian und Demsetz für die Teamproduktion sowie Jensen und Meckling für die Agency-Theorie.
Wie lässt sich Moral in ökonomische Modelle integrieren?
Die Arbeit untersucht, wie ethische Normen als informelle Institutionen das Verhalten von Individuen in ökonomischen Modellen beeinflussen können.
- Quote paper
- Nico Schweizer (Author), 2014, Der "moral code of conduct" als Mittel zur Effiziensteigerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276166