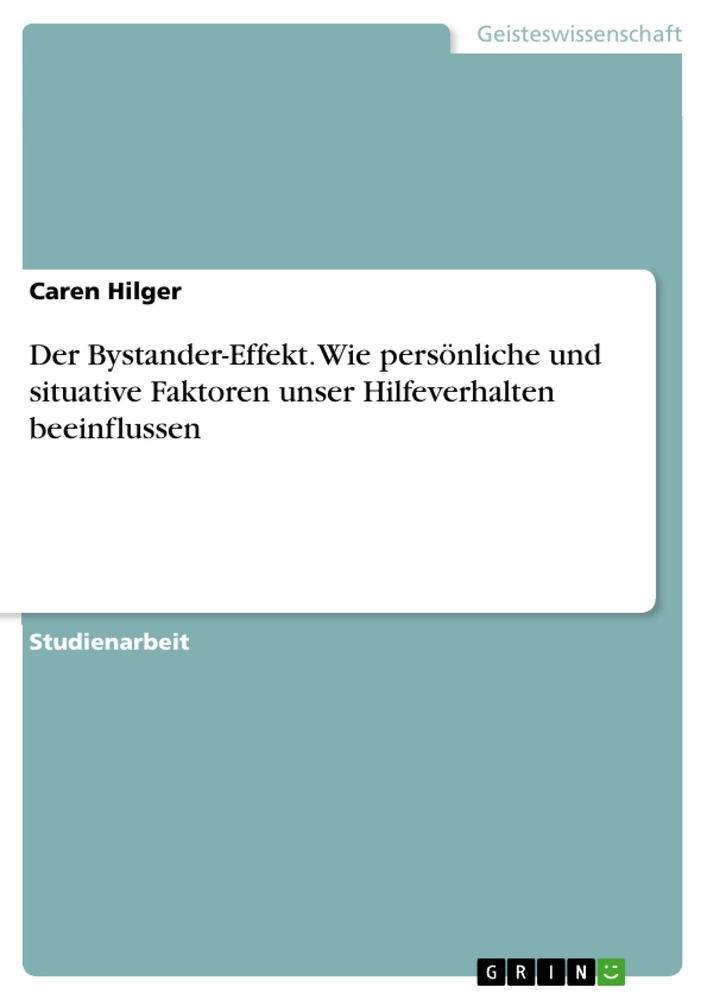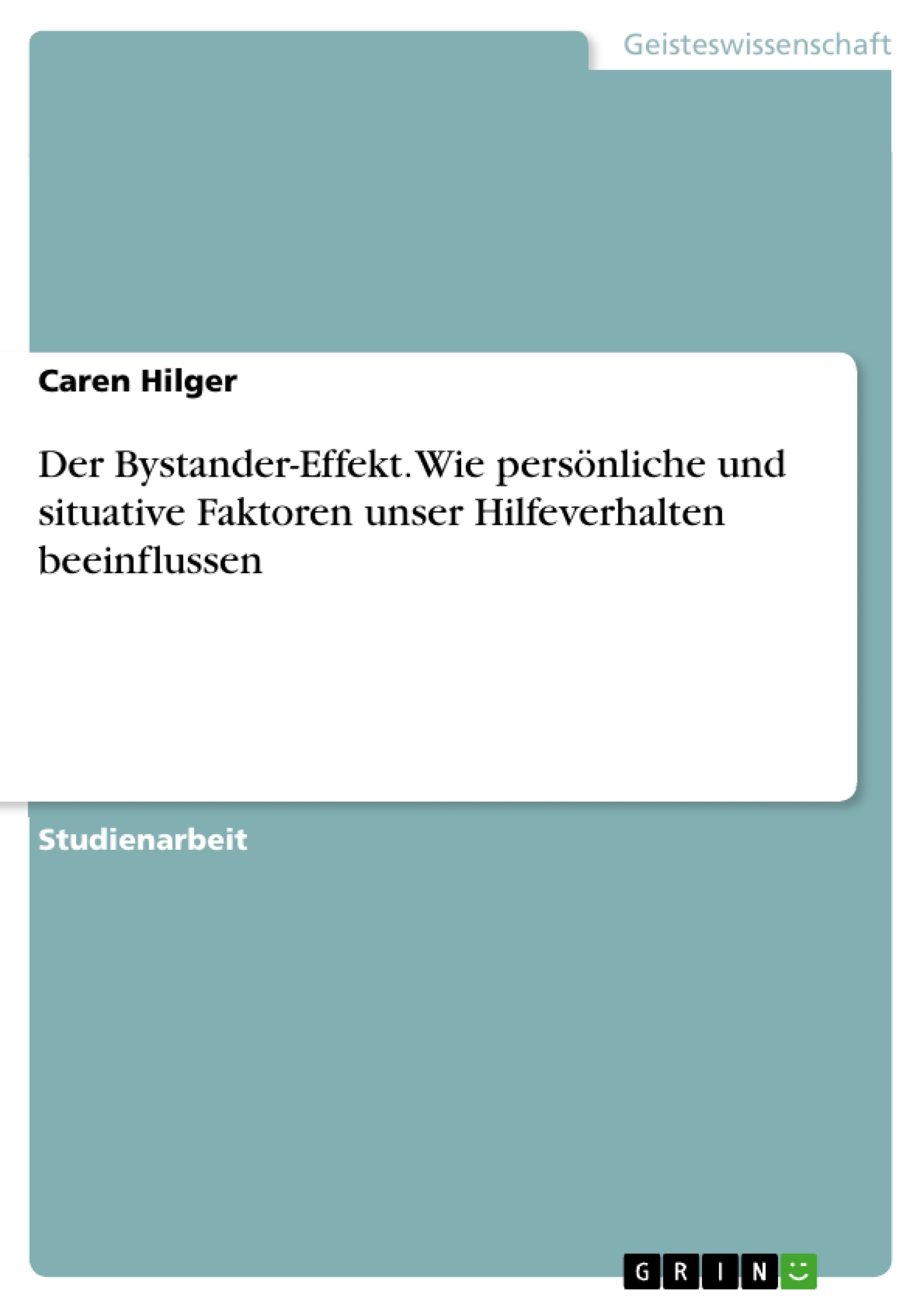Immer wieder berichten Medien von Überfällen und Gewaltakten in der Öffentlichkeit. Obwohl oft eine Vielzahl von Passanten zu Zeugen solcher Taten wird, greifen die wenigsten dieser Menschen in die jeweilige Situation ein, um dem Opfer oder den Opfern zu helfen. So geschieht es auch am 11. Februar 2011 als sich der Maler- und Lackierermeister Marcel R. zusammen mit einem Kollegen auf dem Heimweg von der Arbeit befindet: In der Berliner U-Bahn-Station „Lichtenberg“ werden sie von vier Jugendlichen überfallen. Während sein Kollege fliehen kann, wird Marcel R. von den Tätern brutal zusammengeschlagen. Selbst als er am Boden liegt, treten die jungen Männer weiter auf ihn ein, bis er schließlich ins Koma fällt. Anschließend wird er von seinen Peinigern ausgeraubt. Das Video der Überwachungskamera des U-Bahnhofs dokumentiert dieses Szenario und zeigt darüber hinaus auch Passanten, die den Vorfall ignorieren. Lediglich ein Pärchen leistet Hilfe, indem es die Polizei ruft.
Damit half das Pärchen auf indirekte Weise: Bei dieser berichtenden Art der Hilfestellung teilt man einer anderen, qualifizierteren Person seine Beobachtungen mit und überträgt ihr so die Verantwortung. [...] Konträr zu dieser Form von Hilfeverhalten ist der direkte Weg: Dabei hilft man, indem man unmittelbar in die Situation eingreift. [...] Diese Art zu helfen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie oftmals bestimmte Fähigkeiten, Wissen und körperliche Kraft voraussetzt und darüber hinaus ein gewisses Gefahrenpotential für den Helfer beinhalten kann (Darley & Latané, 1968).
Der zuvor geschilderte Fall von Marcel R. ist nur eins von vielen Beispielen, in denen Menschen zu Zeugen einer Straftat wurden und dennoch nicht einschritten. Dieses Verhaltensmuster ist sogar weitreichender als man zunächst denken könnte: Im Rahmen der sozialpsychologischen Forschung wurden viele Studien zu diesem Thema durchgeführt, die dazu dienten, das oben beschriebene Phänomen zu identifizieren und zu erklären. John M. Darley und Bibb Latané gelten als Pioniere auf diesem Gebiet und prägten durch ihre Untersuchungen den Begriff des „Bystander-Effekts“ (zu Deutsch: „Zuschauer-Effekt“).
Gegenstand dieser Hausarbeit ist der Hintergrund und die Entdeckung des Bystander-Effekts. Gründe, die dieses Phänomen verursachen, werden aufgeführt. Darüber hinaus wird auf Faktoren eingegangen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Effekts erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Der Bystander-Effekt
- 2.1 Geschichtlicher Hintergrund
- 2.2 Die Entdeckung des Bystander-Effekts
- 2.3 Gründe für das Auftreten des Bystander-Effekts
- 3. Beeinflussende Faktoren
- 3.1 Persönliche Einflussgrößen
- 3.2 Situative Einflussgrößen
- 4. Resumé
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Bystander-Effekt, das Phänomen, dass Menschen in Gegenwart anderer weniger bereit sind, Hilfe zu leisten. Die Zielsetzung besteht darin, die Ursachen des Bystander-Effekts zu erläutern und Einflussfaktoren, sowohl persönlicher als auch situationaler Art, zu identifizieren.
- Der geschichtliche Hintergrund des Bystander-Effekts und seine Entdeckung
- Die zentralen Ursachen des Bystander-Effekts (Verantwortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz)
- Persönliche Einflussfaktoren auf das Hilfeverhalten
- Situative Einflussfaktoren auf das Hilfeverhalten
- Maßnahmen zur Vermeidung des Bystander-Effekts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Bystander-Effekt anhand eines realen Beispiels eines Überfalls in der Berliner U-Bahn. Sie verdeutlicht den Unterschied zwischen direkter und indirekter Hilfeleistung und führt in die sozialpsychologische Forschung zum Bystander-Effekt ein, wobei John M. Darley und Bibb Latané als wichtige Pioniere genannt werden. Der Fall dient als eindrückliche Illustration des Phänomens und motiviert die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
2. Der Bystander-Effekt: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Bystander-Effekts, beginnend mit dem Mord an Kitty Genovese im Jahr 1964. Dieser Fall regte Darley und Latané zur Forschung an und führte zur Prägung des Begriffs "Bystander-Effekt". Das Kapitel definiert den Bystander-Effekt und analysiert die von Darley und Latané identifizierten Ursachen für dieses Phänomen, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft werden.
3. Beeinflussende Faktoren: Dieses Kapitel befasst sich mit den Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Bystander-Effekts beeinflussen. Es werden sowohl persönliche als auch situative Faktoren differenziert betrachtet. Anhand von Studien werden Beispiele für persönliche Einflussgrößen (z.B. Persönlichkeitsmerkmale) und situative Einflussgrößen (z.B. die Anzahl der anwesenden Personen) erläutert und ihre Auswirkungen auf das Hilfeverhalten analysiert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Interaktion zwischen individuellen Dispositionen und den Merkmalen der Situation.
Schlüsselwörter
Bystander-Effekt, Hilfeverhalten, Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz, Persönlichkeitsfaktoren, situative Faktoren, Kitty Genovese, Darley & Latané, Sozialpsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Der Bystander-Effekt
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über den Bystander-Effekt. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Ursachen des Bystander-Effekts und den ihn beeinflussenden Faktoren (persönlich und situativ).
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Bystander-Effekt (mit Unterkapiteln zum geschichtlichen Hintergrund, der Entdeckung und den Gründen für das Auftreten), Beeinflussende Faktoren (mit Unterkapiteln zu persönlichen und situativen Einflussgrößen), Resumé und Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist es, den Bystander-Effekt – das Phänomen, dass Menschen in Gegenwart anderer weniger bereit sind zu helfen – zu erläutern und die Ursachen sowie die persönlichen und situativen Einflussfaktoren zu identifizieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den geschichtlichen Hintergrund des Bystander-Effekts, seine Entdeckung, die zentralen Ursachen (Verantwortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz), persönliche und situative Einflussfaktoren auf das Hilfeverhalten sowie Maßnahmen zur Vermeidung des Bystander-Effekts.
Was ist der Bystander-Effekt?
Der Bystander-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer Notsituation Hilfe leistet, abnimmt, je mehr andere Personen anwesend sind. Das Dokument erläutert dies anhand des Falls Kitty Genovese und der Forschung von Darley und Latané.
Welche Ursachen werden für den Bystander-Effekt genannt?
Als zentrale Ursachen werden Verantwortungsdiffusion (die Verantwortung wird auf andere verteilt) und pluralistische Ignoranz (die Annahme, dass andere Personen nicht handeln, weil die Situation nicht als Notfall interpretiert wird) genannt.
Welche Faktoren beeinflussen den Bystander-Effekt?
Das Dokument unterscheidet zwischen persönlichen Einflussfaktoren (z.B. Persönlichkeitsmerkmale) und situativen Einflussfaktoren (z.B. die Anzahl der anwesenden Personen, die Dringlichkeit der Situation). Die Interaktion zwischen diesen Faktoren wird analysiert.
Wer sind Darley und Latané?
John M. Darley und Bibb Latané sind wichtige Pioniere der sozialpsychologischen Forschung zum Bystander-Effekt. Ihre Forschung, angeregt durch den Fall Kitty Genovese, trug maßgeblich zum Verständnis dieses Phänomens bei.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen Bystander-Effekt, Hilfeverhalten, Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz, Persönlichkeitsfaktoren, situative Faktoren, Kitty Genovese, Darley & Latané und Sozialpsychologie.
- Quote paper
- Caren Hilger (Author), 2011, Der Bystander-Effekt. Wie persönliche und situative Faktoren unser Hilfeverhalten beeinflussen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276450