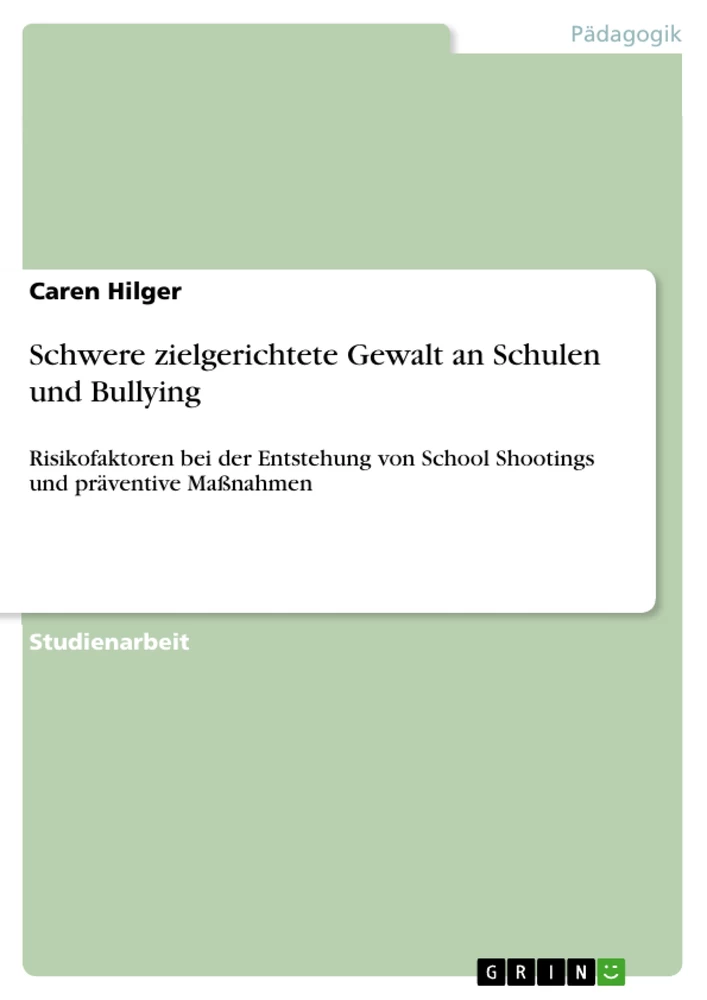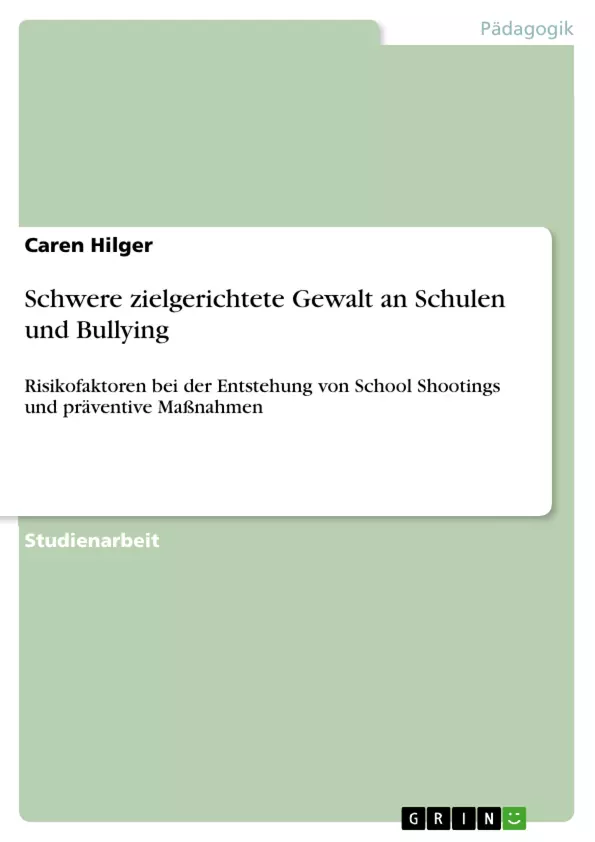In den letzten Jahren berichteten Medien immer wieder über „Amokläufe“ an Schulen, bei denen (ehemalige) Schüler die Bildungseinrichtung stürmten und mit Schuss- und/oder anderen Waffen scheinbar wahllos andere Menschen hinrichteten. Als eine der ersten dieser Meldungen ist der Gesellschaft womöglich der „Amoklauf“ aus Littleton, Colorado in den USA im Gedächtnis geblieben: Am 20. April 1999 betraten die Schüler des Abschlussjahrgangs Dylan Klebold und Eric Harris – ausgerüstet mit Pistolen, Messern und einer Vielzahl an Bomben, die sie zuvor mithilfe von Anleitungen aus dem Internet gebastelt hatten – die Columbine High School. Ihr Plan war es, möglichst viele Leute umzubringen (Rosenberg, 2012). [...]
Doch nicht nur im Ausland haben solche Ereignisse in der letzten Vergangenheit stattgefunden; auch in Deutschland ereigneten sich bis zum heutigen Tag mehrere „Amokläufe“ an Schulen. Der erste dieser Art wurde am 26. April 2002 von Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt verübt (Gebauer, 2002). Mit einem selbstladenden Revolver und einer Pump-Gun bewaffnet kam er am Vormittag des Tattages in seine ehemalige Schule. Zuvor war er des Gymnasiums verwiesen worden, da er des öfteren ärztliche Atteste gefälscht hatte. [...]
Die mediale Berichterstattung fand in beiden Fällen sehr schnell mögliche Ursachen dafür, dass die jeweiligen Täter zu Massenmorden dieser Art überhaupt fähig gewesen waren: Sowohl Dylan Klebold und Eric Harris, als auch Robert Steinhäuser waren unauffällige und ruhige Schüler gewesen, deren familiäre Situation nicht besonders auffällig gewesen war (Rosenberg, 2012; Gebauer, 2002). Alle drei Jungen hörten Heavy-Metal-Musik und beschäftigten sich in ihrer Freizeit mit gewalttätigen Medien, wie Computerspielen oder Filmen. Darüber hinaus hegten alle der erwähnten Täter eine Faszination für Waffen.
Nun stellt sich die Frage, ob solche Gründe wirklich ausschlaggebend sind und Jugendliche dazu verleiten können, einen solchen „Amoklauf“ zu begehen. Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Entstehung von School Shootings. Als eine Größe, die das Vorkommen solcher Massaker begünstigen kann, wird insbesondere das sogenannte „School Bullying“ betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. School Shootings
- 2.1 Definition und Abgrenzung zu dem Begriff „Amoklauf“
- 2.2 Risikofaktoren
- 3. School Bullying
- 3.1 Begriffserklärung
- 3.2 Häufigkeit und Konsequenzen
- 3.3 Prävention
- 4. Résumé
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung von School Shootings, einer Form schwerer, zielgerichteter Gewalt an Schulen. Ziel ist es, Risikofaktoren zu identifizieren, die zur Entstehung von School Shootings beitragen können, und präventive Maßnahmen zu erforschen. Dabei wird insbesondere das Phänomen des School Bullying als ein möglicher Faktor betrachtet.
- Definition und Abgrenzung von School Shootings
- Risikofaktoren für School Shootings
- Begriffserklärung und Häufigkeit von School Bullying
- Konsequenzen von School Bullying
- Präventive Maßnahmen gegen School Bullying
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der School Shootings ein und beleuchtet die mediale Aufmerksamkeit, die diesen Ereignissen in den letzten Jahren zuteil wurde. Es werden zwei prominente Fälle, der Amoklauf an der Columbine High School in den USA und der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, vorgestellt, um die Tragweite des Problems zu verdeutlichen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen von School Shootings und die Rolle von School Bullying als möglicher Faktor in den Vordergrund.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „School Shooting“ vom Begriff „Amoklauf“. Es werden typische Eigenschaften von School Shootings, wie Leaking und langfristige Planung, erläutert. Anschließend werden verschiedene Risikofaktoren, die zu School Shootings führen können, beleuchtet, darunter psychologische Vulnerabilität, kulturelle Sichtweisen, mangelnde Kontrolle von Schülern und Zugang zu Waffen. Besondere Aufmerksamkeit wird der sozialen Marginalität als relevantem Faktor gewidmet, da diese im Zusammenhang mit School Shootings in der Regel an Schulen stattfindet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Phänomen des School Bullying. Es wird die Bedeutung von Bullying als möglicher Auslöser für School Shootings hervorgehoben. Die Häufigkeit von Bullying unter Jugendlichen und die schwerwiegenden Konsequenzen für die Betroffenen werden ausführlich dargestellt. Abschließend werden verschiedene präventive Maßnahmen vorgestellt, die dazu beitragen können, School Bullying einzudämmen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen School Shootings, Bullying, Risikofaktoren, Prävention, soziale Marginalität, psychologische Vulnerabilität, kulturelle Sichtweisen, mangelnde Kontrolle von Schülern, Zugang zu Waffen, Häufigkeit, Konsequenzen, Maßnahmen, Schule, Bildungseinrichtung, Gewalt, Amoklauf, Leaking, Planung, Schüler, Lehrer, Medien, Internet, Waffen, Heavy-Metal-Musik, Computerspiele, Filme, psychische Belastungen, Verhaltensauffälligkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem School Shooting und einem Amoklauf?
School Shootings zeichnen sich oft durch eine langfristige Planung und das sogenannte „Leaking“ (Andeuten der Tat) aus, während der Begriff Amoklauf oft impulsivere Taten beschreibt.
Welche Rolle spielt Bullying bei School Shootings?
School Bullying und soziale Marginalisierung gelten als wesentliche Risikofaktoren. Viele Täter fühlten sich über lange Zeit schikaniert oder ausgegrenzt, was zu psychischen Belastungen und Rachegedanken führen kann.
Was sind typische Risikofaktoren für schwere Gewalt an Schulen?
Dazu gehören psychologische Vulnerabilität, Zugang zu Waffen, eine Faszination für gewalttätige Medien, mangelnde Kontrolle durch das Umfeld und kulturelle Sichtweisen auf Gewalt.
Was versteht man unter „Leaking“?
Leaking bezeichnet das bewusste oder unbewusste Ankündigen einer Gewalttat gegenüber Dritten, etwa durch Zeichnungen, Texte oder Äußerungen im Internet.
Wie kann man School Shootings präventiv verhindern?
Prävention setzt vor allem bei der Bekämpfung von Bullying, der Sensibilisierung für Warnsignale (Leaking) und der Verbesserung des Schulklimas sowie der psychologischen Unterstützung von Schülern an.
- Quote paper
- Caren Hilger (Author), 2012, Schwere zielgerichtete Gewalt an Schulen und Bullying, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276452