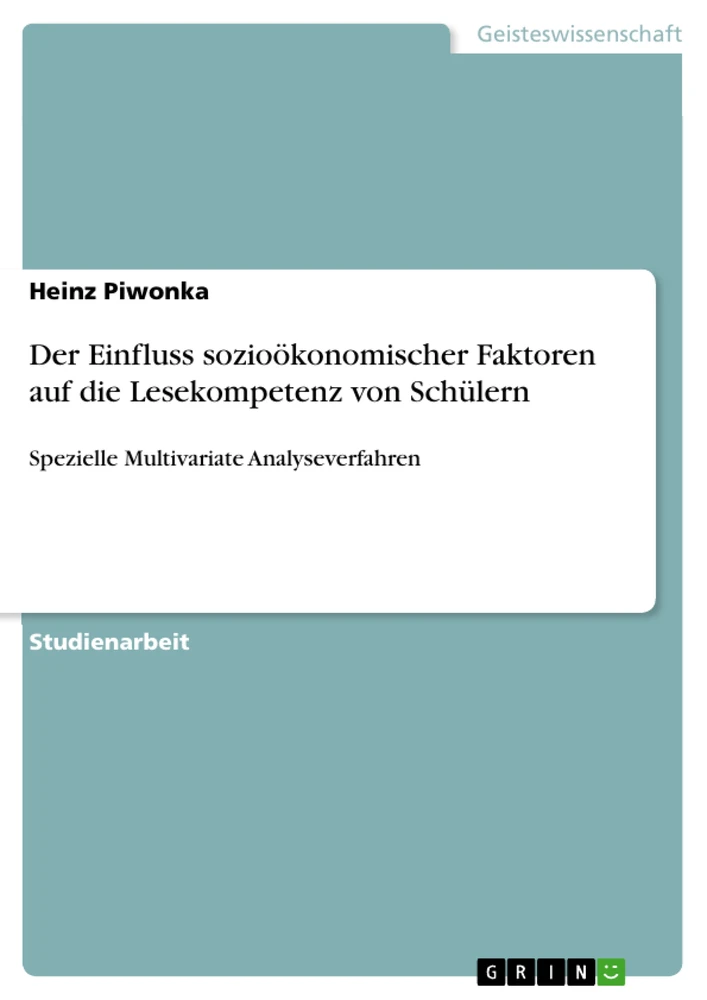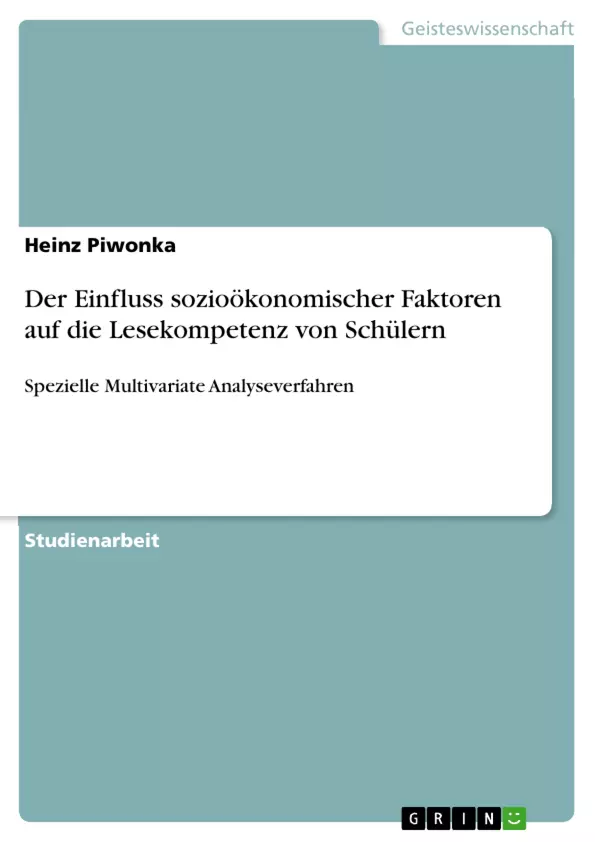Einen besonderen Einfluss hat die Familie auf die schulischen Kompetenzen und Praktiken ihrer Kinder. Ausschlaggebend dafür ist der sozioökonomische Status der Familie, der sich aus kulturellen, sozialen und ökonomischen Praktiken, sowie dem persönlichen Geschmack zusammensetzt (Bourdieu 1982). Nach dieser Idee „erben“ die Kinder den Status ihrer Eltern, welcher ihr Verhalten und in der Folge ihre Kompetenzen beeinflusst.
Schulische Leistungen der Kinder lassen sich in Form von Zeugnissen und Bildungsabschlüssen leicht und standardisiert – zumindest im nationalen Bereich - messen. Die OECD verfolgt mit ihrem PISA-Programm einen anderen Zugang: die tagtäglichen Herausforderungen einer Wissensgesellschaft (vgl. OECD 2012 : 22). Somit stehen weder Zeugnisse noch Schulnoten im Fokus, sondern persönliche Fähigkeiten der SchülerInnen. Im Rahmen der Lehrveranstaltung bei dieser die vorliegende Seminararbeit entstand, wurde der internationale Teil der PISA-Studie 2009 für Österreich zur Verfügung gestellt und bildet somit die Datenbasis für diese Analyse.
Die Lesekompetenz erscheint im Hinblick auf zu Grunde liegende sozioökonomische Faktoren als besonders gut geeigneter Indikator für weitere Untersuchungen, da nach dem nationalen Bildungsbericht 2012 Kinder aus bildungsfernen Familien und Kinder nichtdeutscher Alltagssprache einem hohen Risiko ausgesetzt sind, nur schwache Leseleistungen zu erbringen, was im Speziellen für Österreich gilt, da die österreichischen SchülerInnen in internationalen Vergleichsstudien insgesamt nicht zufriedenstellend abschneiden (vgl. Bruneforth et. al. 2013 : 15). Hier stellt sich die Frage, welche weiteren sozioökonomischen Faktoren ausgemacht werden können, um Leistungsdefizite der SchülerInnen zu identifizieren.
Zur Beschreibung von Bildungs- bzw. Leistungsungleichheiten stehen zwar ausreichend Daten zur Verfügung, es besteht jedoch weiterer Forschungsbedarf mit dem Ziel der besseren Datenauswertung im allgemeinen und in Bezug auf Schulen und Schultypen im besonderen (vgl. ebda : 25). Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten und einerseits strukturprüfend, theoretisch benannte sozioökonomische Faktoren auf ihren Aussage- und Prognosewert untersuchen, andererseits auf Basis der PISA 2009-SchülerInnenbefragung weitere sozioökonomische Einflüsse strukturentdeckend ausfindig machen und adäquat analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Fundierung
- 3. Hypothese, Variablen, (Re)Kodierungen
- 4. Material & Methoden
- 5. Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Lesekompetenz von 15-jährigen Schülerinnen in Österreich. Sie nutzt Daten der PISA-Studie 2009, um bestehenden Forschungsbedarf zur besseren Datenauswertung im Kontext von Bildungsungleichheiten zu adressieren. Die Arbeit analysiert sowohl theoretisch benannte sozioökonomische Faktoren als auch strukturentdeckend weitere Einflüsse.
- Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Lesekompetenz
- Analyse von Bildungsungleichheiten in Österreich
- Identifizierung weiterer sozioökonomischer Einflussfaktoren auf die Leseleistung
- Auswertung der PISA-Studie 2009 für Österreich
- Verbindung von Struktur- und Handlungsebene im Kontext von Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung von Bildung für den zukünftigen Lebensweg junger Menschen. Sie hebt den Einfluss der Familie und des sozioökonomischen Status auf den Kompetenzerwerb hervor (Bourdieu 1982). Die Arbeit stützt sich auf die PISA-Studie 2009 für Österreich, welche die Lesekompetenz von 15-jährigen Schülerinnen untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse sozioökonomischer Faktoren, die schwache Leseleistungen erklären könnten, besonders im österreichischen Kontext, wo SchülerInnen in internationalen Vergleichsstudien oft nicht zufriedenstellend abschneiden (Bruneforth et al. 2013). Die Arbeit zielt darauf ab, theoretisch benannte Faktoren zu untersuchen und weitere sozioökonomische Einflüsse zu identifizieren.
2. Theoretische Fundierung: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der Familie auf den Kompetenzerwerb der Kinder, wobei sowohl Sozialisation als auch gelebte kulturelle Praktiken berücksichtigt werden (Bourdieu 1982; Watermann 2006; Piwonka 2010). Der Zusammenhang zwischen Präferenzen (Literatur, Musik etc.), sozialer Klasse, Ausbildungsgrad und sozialer Herkunft wird diskutiert. Der stetig wachsende Anteil von Personen, die durch Akkumulation von Bildungskapital aufgestiegen sind, wird ebenso thematisiert wie das weiterhin bestehende Auftreten sozioökonomischer Benachteiligungen in der postmodernen Gesellschaft (OECD 2011). Das Kapitel legt die theoretische Grundlage für die Analyse der Beziehung zwischen sozioökonomischem Status und Lesekompetenz, indem es die Bedeutung von klassenspezifischen Leistungen und deren Interpretation im Kontext ungleicher Lebensverläufe hervorhebt (Nollmann 2004). Der Unterschied zwischen schulischer Bewertung und späteren beruflichen Gegebenheiten wird als wichtiger Aspekt in den Zusammenhang eingeordnet.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Sozioökonomische Faktoren, Bildungsungleichheit, PISA-Studie 2009, Österreich, Familienstatus, Bildungskapital, Soziale Herkunft, Leistungsdefizite, Empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Sozioökonomische Faktoren und Lesekompetenz
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Lesekompetenz von 15-jährigen Schülerinnen in Österreich, basierend auf Daten der PISA-Studie 2009.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Lesekompetenz zu analysieren, Bildungsungleichheiten in Österreich zu untersuchen, weitere sozioökonomische Einflussfaktoren auf die Leseleistung zu identifizieren und die PISA-Studie 2009 für Österreich auszuwerten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbindung von Struktur- und Handlungsebene im Bildungskontext.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien von Bourdieu (1982), Watermann (2006), Piwonka (2010), Nollmann (2004) und bezieht sich auf Daten der OECD (2011). Es werden der Einfluss der Familie auf den Kompetenzerwerb, der Zusammenhang zwischen Präferenzen, sozialer Klasse und Herkunft sowie die Bedeutung von Bildungskapital diskutiert.
Welche Daten werden verwendet?
Die Seminararbeit basiert auf Daten der PISA-Studie 2009 für Österreich.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Fundierung, Hypothese, Variablen, (Re)Kodierungen, Material & Methoden, Ergebnisse und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Lesekompetenz, Sozioökonomische Faktoren, Bildungsungleichheit, PISA-Studie 2009, Österreich, Familienstatus, Bildungskapital, Soziale Herkunft, Leistungsdefizite, Empirische Analyse.
Welche Forschungslücke wird adressiert?
Die Arbeit adressiert den bestehenden Forschungsbedarf zur besseren Datenauswertung im Kontext von Bildungsungleichheiten, insbesondere die Analyse sozioökonomischer Faktoren, die schwache Leseleistungen erklären könnten.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet, den Einfluss theoretisch benannter sozioökonomischer Faktoren auf die Lesekompetenz zu belegen und weitere, bisher nicht identifizierte Einflussfaktoren aufzudecken.
- Quote paper
- Heinz Piwonka (Author), 2014, Der Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Lesekompetenz von Schülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276551