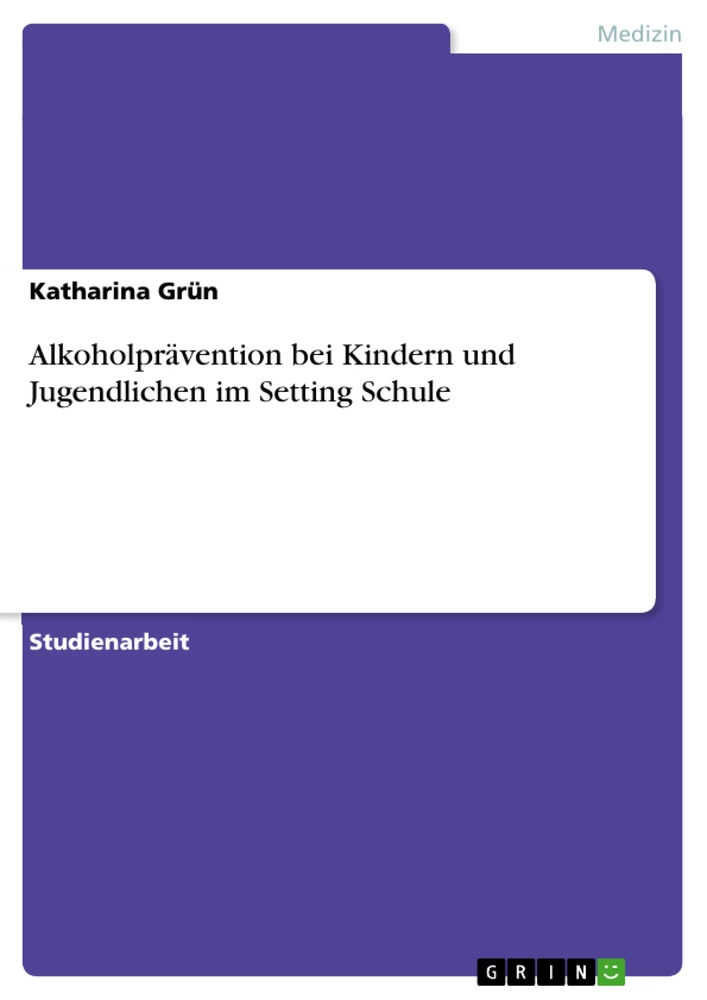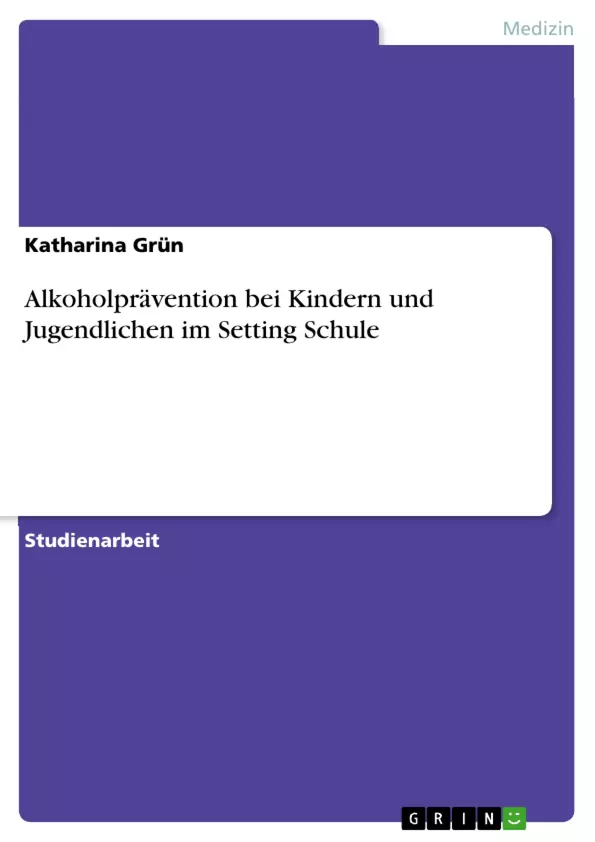Nach Angaben der ersten Studie zur Gesundheit von deutschen Kindern und Jugendlichen, welche im Zeitraum von 2003-2006 vom Robert-Koch-Institut durchgeführt wurde (KiGGS-Studie), haben die meisten Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren bereits einmal Alkohol getrunken. Dabei ist zu beobachten, dass mit dem Alter auch die Menge des Alkohols zunimmt. Die Zahlen des Alkoholkonsums zeigen die dringende Notwendigkeit auf, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, welche sich nicht nur auf eine Minimierung des gesundheitsschädlichen Alkoholkonsums überhaupt, sondern ebenfalls darauf richten, Kinder und Jugendliche vor dem frühen Einstieg in den schädlichen Konsum zu bewahren. Diese wissenschaftliche Arbeit versucht der Frage nachzugehen, wie die Alkoholprävention im Setting Schule so gestaltet werden kann, dass diese erfolgreich ist und das Setting zu einem gesundheitsfördernden Setting wird. Der Setting-Ansatz reicht in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen hinein, in das System Schule, und will diese dort mithilfe eines systemischen Zugangs erreichen. Um negativen Verhaltensweisen vorzubeugen, muss das Setting Schule seiner Pflicht nachkommen, Kindern und Jugendlichen eine gute Grundlage zu vermitteln, welche zu eine gesundheitsförderlichen Einstellung führen kann. Durch die gesundheitsfördernden Schulen wurde diesbezüglich bereits ein erstes Zeichen gesetzt für ein gesundheitsförderliches Setting.
Im Folgenden wird für das bessere Verständnis zunächst die Datenlage dargelegt, um aufzuzeigen, wie verbreitet die Problematik des Alkoholkonsums an Schulen ist und wie notwendig demzufolge die Intervention ist. Anschließend werden außerdem die Begrifflichkeiten des Settingansatzes und des Settings sowie der „Gesundheitsfördernden Schule“ genauer definiert und festgelegt. Daraufhin wird der Versuch unternommen, den Settingansatz als eine mögliche Maßnahme zur Alkoholprävention von Kindern und Jugendlichen im Setting Schule näher zu erläutern. Zur Untermauerung und Verdeutlichung der Komplexität sowie zum Verständnis folgt daraufhin ein Praxisbeispiel. Schließlich folgt das Fazit, welches aufzeigen soll, welche Bedeutung und Relevanz das Thema der Alkoholprävention für die Gesundheitsförderung hat und welche Folgen sich daraus für die Arbeit mit der Zielgruppe ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Datenlage
- Zusammenfassende Darstellung
- Zum Begriff des Settingansatzes und des Settings
- Zum Begriff der „Gesundheitsfördernde Schule“
- Der Settingansatz als mögliche Maßnahme zur Alkoholprävention
- Praxisbeispiel
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen im Setting Schule. Ziel ist es, die Wirksamkeit des Settingansatzes als Maßnahme zur Alkoholprävention zu untersuchen und die Gestaltung einer gesundheitsfördernden Schulumgebung zu beleuchten.
- Alkoholprävention im Setting Schule
- Der Settingansatz als Kernstrategie in der Gesundheitsförderung
- Die Bedeutung der „Gesundheitsfördernden Schule“
- Datenlage zum Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen
- Praxisbeispiele für die Umsetzung von Alkoholpräventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen dar und erläutert die Notwendigkeit gezielter Präventionsmaßnahmen. Die Datenlage zeigt die Verbreitung des Alkoholkonsums in verschiedenen Altersgruppen auf und verdeutlicht die Dringlichkeit des Themas. Im Anschluss werden die Begriffe des Settingansatzes und des Settings sowie der „Gesundheitsfördernden Schule“ definiert.
Das Kapitel über den Settingansatz als mögliche Maßnahme zur Alkoholprävention beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen dieses Ansatzes im Kontext der Schule. Es werden konkrete Strategien und Maßnahmen vorgestellt, die zur Gestaltung einer gesundheitsfördernden Schulumgebung beitragen können.
Das Praxisbeispiel veranschaulicht die praktische Umsetzung von Alkoholpräventionsmaßnahmen in der Schule. Es zeigt, wie der Settingansatz in der Praxis angewendet werden kann und welche Erfolge erzielt werden können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Alkoholprävention, Settingansatz, Gesundheitsförderung, Schule, Kinder und Jugendliche, Datenlage, Gesundheitsfördernde Schule, Praxisbeispiel. Der Text beleuchtet die Bedeutung der Alkoholprävention im Setting Schule und zeigt die Möglichkeiten und Herausforderungen des Settingansatzes auf.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die KiGGS-Studie zum Alkoholkonsum?
Die Studie zeigt, dass die meisten 12- bis 17-Jährigen bereits Alkohol getrunken haben und die Konsummenge mit steigendem Alter zunimmt.
Was versteht man unter dem 'Setting-Ansatz'?
Es ist ein systemischer Zugang, der Gesundheitsförderung direkt in der Lebenswelt (z.B. der Schule) verankert, um Kinder dort zu erreichen, wo sie sich täglich aufhalten.
Was ist eine 'Gesundheitsfördernde Schule'?
Eine Schule, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Rahmenbedingungen schafft, die eine gesundheitsförderliche Einstellung und Lebensweise der Schüler unterstützen.
Welche Ziele verfolgt die Alkoholprävention in der Schule?
Ziel ist die Minimierung des gesundheitsschädlichen Konsums und der Schutz vor einem frühen Einstieg in den Alkoholkonsum.
Gibt es praktische Beispiele für diese Prävention?
Ja, das Dokument enthält ein Praxisbeispiel, das die Komplexität und Umsetzung des Settingansatzes zur Alkoholprävention veranschaulicht.
- Arbeit zitieren
- Katharina Grün (Autor:in), 2013, Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen im Setting Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276614