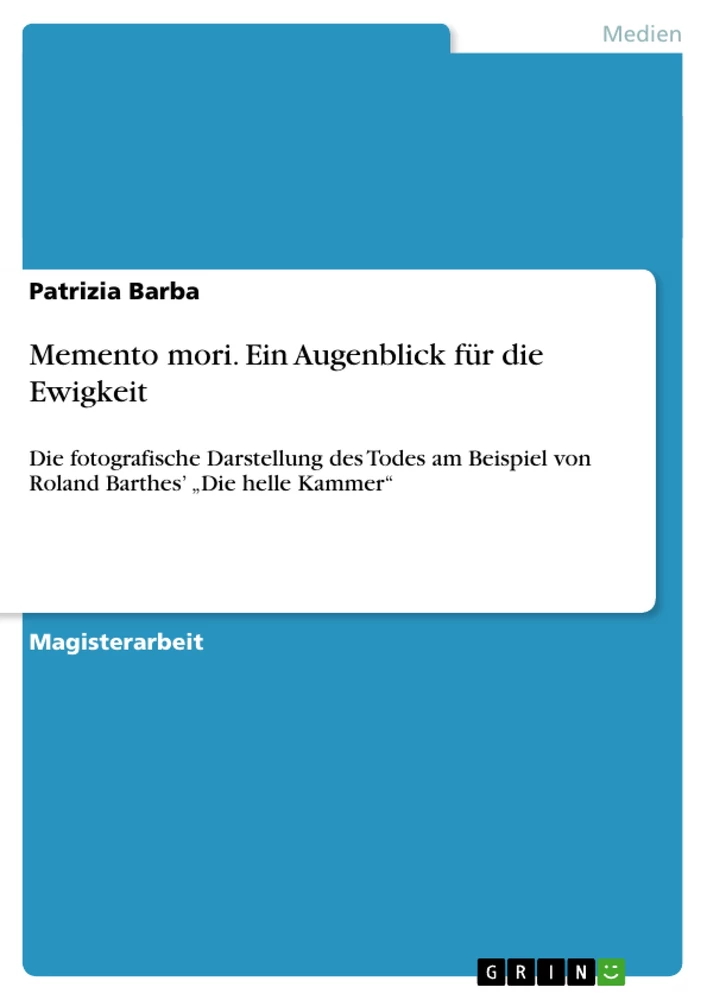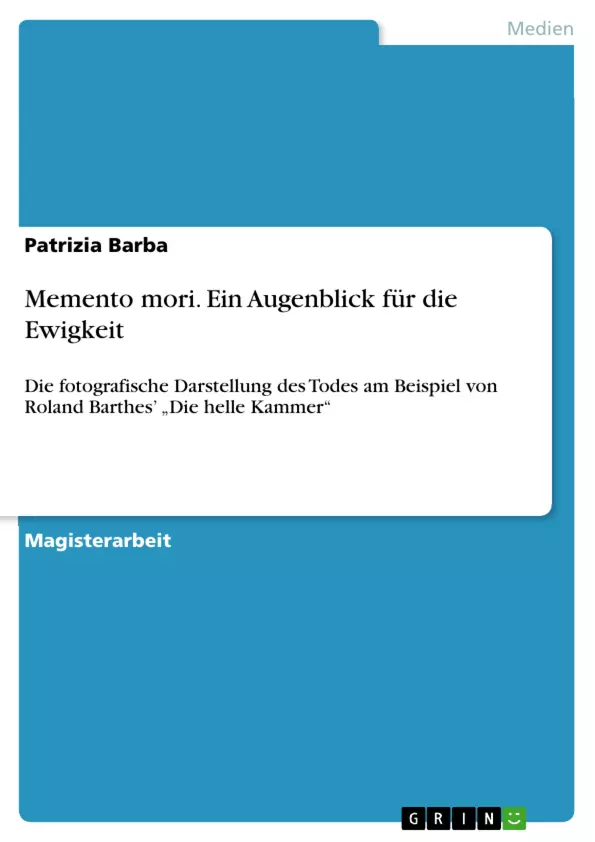'Das Erstaunliche an jedem Foto ist dabei nicht so sehr, daß dort, der landläufigen Meinung nach, ‘die Zeit festgehalten’ worden wäre, sondern im Gegenteil, daß sie gerade in jedem Foto aufs Neue beweist, WIE un-aufhaltsam und stetig sie ist. Jedes Photo ist eine Erinnerung an unsere Sterblichkeit. Jedes Photo handelt von Leben und Tod.'
(Wenders, Wim: Einmal. Bilder und Geschichten.)
Durch jede Fotografie wird ein Augenblick festgehalten. Ein wichtiger Moment wird dokumentiert und aus dem Fluss der Zeit herausgerissen. Im 21. Jahrhundert hat der Mensch fast immer und überall eine Kamera dabei, so dass der Weg, den er geht, jederzeit festgehalten und später wieder ins Gedächtnis gerufen werden kann. Denn etwas zu fotografieren heißt für die meisten Menschen einen flüchtigen und vergänglichen Augenblick mit der Kamera festzuhalten und ihn dadurch zu konservieren. Auf diese Weise fixiert man eine Erinnerung und kann sie sich jederzeit wieder „lebendig“ machen. Die Fotografie bildet die Wirklichkeit ab und fixiert sie dauerhaft – erhält sie also am Leben, sowohl für den auf der Fotografie Abgebildeten als auch für seine Nachkommen.
Macht man sich Gedanken zur Fotografie, stellt man fest, dass diese ein durchaus paradoxes Wesen besitzt. Sie besitzt zum einen die Eigenschaft, einen Augenblick (das Leben) festzuhalten und bis in alle Ewigkeit beizubehalten, stellt sich also damit der Zeit entgegen, indem sie diese arretiert, „das Leben anhält und auf Dauer einstellt wider den Tod [...]“ . Zum
anderen wird durch dieses Festhalten – im fotografischen Jargon durch dieses Fixieren – eines Augenblicks ebenso die Vergänglichkeit des fotografierten Objekts oder Individuums sichtbar gemacht. Durch dieses Sichtbarmachen streift das Medium Fotografie nah an dem unsichtbaren Tod vorbei, es mortifiziert das Leben vorträglich. Die Fotografie zeigt also
nicht nur das auf, was einmal dagewesen ist, sondern auch das, was (irgendwann) nicht mehr sein wird. Dieser ambivalente Doppelcharakter wird der Fotografie schon seit ihren Anfängen zugeschrieben. Dabei wurde sie zumeist in einen metaphorischen Kontext zum Leben und zum Tod gebracht.
'Die besondere Metaphorizität der Photographie ist auch dadurch begründet, daß die Photographie seit ihren Anfängen in prekärer Weise ambivalent ist. Sie wurde immer
als Mortifikation und Vivifikation, als Wahrheit und Lüge, als Auslöschung und Rettung angesehen und beschrieben.'
(Stiegler, Bernd: Bilder der Photographie.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Konzeption
- Geschichte der Fotografie
- Definition
- Vor der Fotografie
- Entwicklungsgeschichte
- Wahrnehmungsweise des neuen Mediums
- Roland Barthes
- Kurzporträt
- Roland Barthes' erste Überlegungen zur Fotografie
- ,,Die helle Kammer" - ein Überblick
- ,,Die helle Kammer" - der erste Teil
- Die drei Aktionen der Fotografie: operator - spectrum - spectator
- studium - punctum
- ,,Die helle Kammer" - der zweite Teil
- Das Grundprinzip: „Es-ist-so-gewesen“
- Das Wesen der Fotografie
- Der Tod in der Fotografie
- Tod, Theater und Maskierung
- Das Spektrum der Fotografie
- Vom Subjekt zum Objekt
- L'arrêt de mort
- Das Objekt
- Tod und Zeit
- Memento mori
- Der Tod der Mutter
- Die Wintergartenfotografie
- Das unsichtbare punctum
- Die temporale Struktur der Wintergartenfotografie
- Blickwechsel
- Andy Warhol
- Kurzporträt
- Die Reproduktion der Reproduktion
- Andy Warhols Selbstinszenierung
- Andy Warhols retardierter Tod
- Schlussbemerkung
- Literatur- & Quellenverzeichnis
- Ausgaben und Forschungsliteratur
- Wörterbücher und Lexika
- Internetquellen
- Film
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der fotografischen Darstellung des Todes am Beispiel von Roland Barthes' „Die helle Kammer“. Ziel ist es, die besondere Beziehung zwischen Fotografie und Tod zu untersuchen und aufzuzeigen, wie das Medium die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes widerspiegelt. Die Arbeit analysiert Barthes' Theorie der Fotografie und untersucht, wie er die Konzepte von „studium“ und „punctum“ auf die Darstellung des Todes anwendet.
- Die Rolle der Fotografie als Medium der Erinnerung und des Gedenkens
- Die Ambivalenz der Fotografie: Festhalten und Vergänglichkeit
- Die Bedeutung des „punctum“ in der Fotografie und seine Verbindung zum Tod
- Die Darstellung des Todes in der Fotografie und die Frage nach der Objektivierung des Subjekts
- Die temporale Struktur der Fotografie und ihre Beziehung zur Zeitlichkeit des Todes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Konzeption. Sie beleuchtet die besondere Beziehung zwischen Fotografie und Tod und stellt die Ambivalenz des Mediums heraus. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Fotografie und ihrer Entwicklung. Es werden die verschiedenen Phasen der Fotografiegeschichte beleuchtet und die Wahrnehmung des neuen Mediums im Kontext der Zeit betrachtet. Das dritte Kapitel widmet sich Roland Barthes und seiner Theorie der Fotografie. Es wird ein Kurzporträt von Barthes gegeben und seine ersten Überlegungen zur Fotografie vorgestellt. Anschließend wird Barthes' Werk „Die helle Kammer“ im Detail analysiert, wobei die beiden Teile des Buches, „studium“ und „punctum“, im Fokus stehen. Das vierte Kapitel untersucht die Darstellung des Todes in der Fotografie. Es werden verschiedene Aspekte des Todes in der Fotografie beleuchtet, wie zum Beispiel die Frage nach der Objektivierung des Subjekts, die Beziehung zwischen Tod und Zeit sowie die Rolle des „Memento mori“. Der Tod der Mutter, der für Barthes eine zentrale Rolle in „Die helle Kammer“ spielt, wird im Detail analysiert. Das fünfte Kapitel bietet einen Blickwechsel und betrachtet die Fotografie aus einer anderen Perspektive. Das sechste Kapitel widmet sich Andy Warhol und seiner Arbeit. Es wird ein Kurzporträt von Warhol gegeben und seine Arbeit im Kontext der Fotografie betrachtet. Die Reproduktion der Reproduktion, die Selbstinszenierung und der retardierte Tod Warhols werden analysiert. Die Schlussbemerkung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fotografie, den Tod, Roland Barthes, „Die helle Kammer“, „studium“, „punctum“, Erinnerung, Vergänglichkeit, Objektivierung, Zeitlichkeit, Memento mori, Andy Warhol, Reproduktion, Selbstinszenierung und retardierter Tod.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Roland Barthes' „Die helle Kammer“?
Barthes untersucht das Wesen der Fotografie („Es-ist-so-gewesen“) und ihre tiefe Verbindung zur Vergänglichkeit und zum Tod.
Was bedeuten die Begriffe „studium“ und „punctum“?
„Studium“ bezeichnet das allgemeine kulturelle Interesse an einem Foto, während „Punctum“ das persönliche Detail ist, das den Betrachter emotional trifft oder „sticht“.
Inwiefern ist jedes Foto ein „Memento mori“?
Ein Foto hält einen Augenblick fest, der bereits vergangen ist, und erinnert dadurch an die Sterblichkeit des Abgebildeten und die Unaufhaltsamkeit der Zeit.
Welche Rolle spielt die „Wintergartenfotografie“ in Barthes' Werk?
Es ist ein Bild seiner verstorbenen Mutter als Kind, in dem Barthes das wahre Wesen der Fotografie und seinen persönlichen Schmerz über den Verlust findet.
Wie wird Andy Warhol in diesem Kontext analysiert?
Warhols Arbeit wird im Hinblick auf die Reproduktion, Selbstinszenierung und das Konzept des „retardierten Todes“ untersucht.
- Arbeit zitieren
- Patrizia Barba (Autor:in), 2010, Memento mori. Ein Augenblick für die Ewigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276680