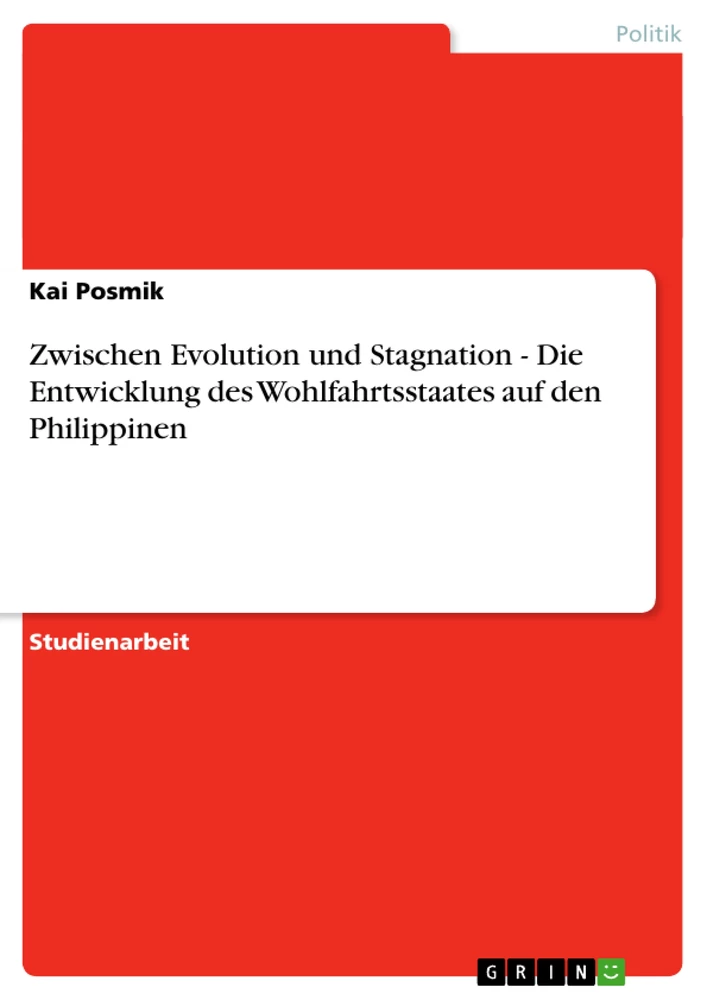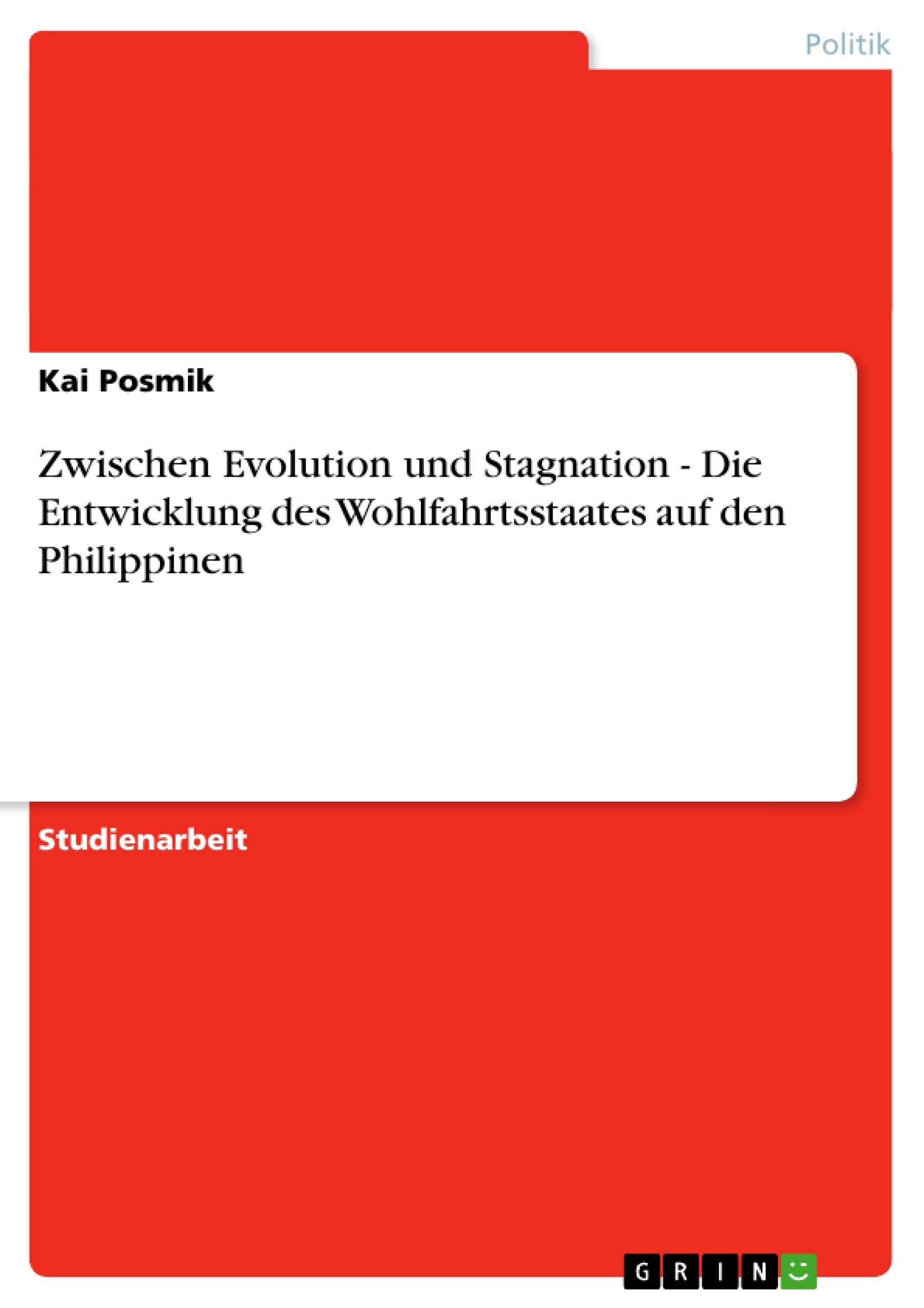Betrachtet man die Entwicklung der Wohlfahrtsregime im Osten und Südosten Asiens, so
fällt auf, dass sie ihre heutige Ausprägung zumeist relativ spät erreicht haben, jedenfalls
wenn man sie mit dem „wohlfahrtsstaatlichem Vorreiter“1 Deutschland vergleicht. Die Gründe
hierfür sind vielfältig, für eine erschöpfende Aufzählung ist hier nicht der Raum. Mit dem
negativen Einfluss japanischer und europäischer Kolonisation und sich daran häufig anschließender,
einheimischer autoritärer Herrschaft, dem Vorhandensein tradierter soziokultureller
Wertesysteme und der (von Japan abgesehen) spät einsetzenden Industrialisierung seien
wichtige Gründe für die verzögerte Entwicklung moderner asiatischer Staatlichkeit und damit
auch Wohlfahrt genannt.2 Aus dieser Reihe „wohlfahrtsstaatlicher Spätzünder“ ragt jedoch
ein Land auffällig heraus, passt es doch nicht bruchlos in den Entwicklungsweg der Wohlfahrtsregime
Ost- und Südostasiens: Die Republik der Philippinen. Nur noch Japan, welches
sein Wohlfahrtssystem zwischen den Weltkriegen nach deutschem Vorbild gestaltete,3 kann
im ostasiatischen Raum auf eine längere Tradition staatlicher Versuche eine soziale Grundsicherung
zu implementieren zurückblicken.
Diese wohlfahrtsstaatliche Entwicklung auf den Philippinen soll Thema dieser Arbeit sein.
Wie dem Titel entnommen werden kann, ist der philippinische Wohlfahrtsstaat dabei in zwei
Phasen zu unterteilen: Einer früh einsetzenden Evolutionsphase folgt der Übergang in eine
bis heute andauernde Phase der Stagnation. Dabei stehen verschiedene Fragen im Mittelpunkt,
die an dieser Stelle beantwortet werden sollen: Warum unternahm das Land im Vergleich
zu anderen in der Region relativ früh erste Versuche, Wohlfahrtspolitik zu betreiben?
Was sind die Determinanten gewesen, die den Anstoß hierfür gegeben haben? Welche Entwicklungen
können während der Diktatur des Marcos-Regimes festgehalten werden?
Schließlich: Warum wirkte sich trotz großer sozialer Probleme im Land und dem damit vorhandenen
Bedarf an weiterer wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung, die Demokratisierung nicht
positiv aus, sondern kam es im Gegenteil zum Eintritt in eine stagnative Phase, die immer
noch nicht überwunden ist? [...]
1 Schmid 2002, S. 1099
2 Vgl. Wallraf/Gottwald 1999, S. 345
3 Vgl. Aspalter 2001, S. 18 f.; Wallraf 1999; Anderson 1993
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Theorie des Wohlfahrtsstaates
- C. Die Evolution des philippinischen Wohlfahrtsstaates
- I. Wohlfahrtspolitische Maßnahmen während der amerikanischen Kolonialzeit
- II. Die Entwicklung bis zum Ende der Marcos-Diktatur
- D. Die Stagnation seit dem Beginn der Demokratisierung
- I. Flagship Program und Widerstandsfähigkeit alter Eliten
- II. Exkurs: Die Bedeutung der Arbeitsemigration für die Soziale Sicherung
- E. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des philippinischen Wohlfahrtsstaates und untersucht die Gründe für seine frühe Evolutionsphase und die anschließende Stagnation. Sie befasst sich insbesondere mit der Frage, warum die Philippinen im Vergleich zu anderen Ländern der Region relativ früh erste Versuche unternahmen, Wohlfahrtspolitik zu betreiben, und warum die Demokratisierung trotz großer sozialer Probleme im Land nicht zu einer Erweiterung des Wohlfahrtsstaates führte.
- Die Determinanten der frühen wohlfahrtspolitischen Aktivitäten auf den Philippinen
- Die Entwicklung des philippinischen Wohlfahrtsstaates während der Marcos-Diktatur
- Die Gründe für die Stagnation des philippinischen Wohlfahrtsstaates seit der Demokratisierung
- Die Rolle der Arbeitsemigration für die soziale Sicherung auf den Philippinen
- Der Vergleich des philippinischen Wohlfahrtsstaates mit anderen asiatischen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Diese Einleitung liefert einen Überblick über die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in Ost- und Südostasien und stellt die Besonderheiten der philippinischen Situation heraus. Sie führt die wichtigsten Fragestellungen der Arbeit ein, die im weiteren Verlauf untersucht werden.
- B. Theorie des Wohlfahrtsstaates: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die wichtigsten Theorien und Ansätze zum Wohlfahrtsstaat. Es werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, darunter normative, funktionale und politisch orientierte Ansätze. Darüber hinaus wird auf das Modell der „drei Welten“ des Wohlfahrtsstaates von Goran Esping-Andersen eingegangen.
- C. Die Evolution des philippinischen Wohlfahrtsstaates: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des philippinischen Wohlfahrtsstaates von der amerikanischen Kolonialzeit bis zum Ende des Marcos-Regimes. Es werden die wichtigsten wohlfahrtspolitischen Maßnahmen und die treibenden Kräfte hinter ihrer Entwicklung analysiert.
- D. Die Stagnation seit dem Beginn der Demokratisierung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Stagnation des philippinischen Wohlfahrtsstaates nach dem Beginn der Demokratisierung. Es untersucht die Gründe für diese Entwicklung und die Rolle der Arbeitsemigration für die soziale Sicherung im Land.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Philippinen, Kolonialismus, Marcos-Diktatur, Demokratisierung, Stagnation, Arbeitsemigration, Soziale Sicherung, Asien.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben die Philippinen eine so lange wohlfahrtsstaatliche Tradition?
Bereits während der amerikanischen Kolonialzeit wurden erste Versuche unternommen, soziale Grundsicherungen zu implementieren, was das Land zu einem "Spätzünder" mit früher Startphase macht.
Was charakterisiert die Stagnationsphase des philippinischen Wohlfahrtsstaates?
Trotz Demokratisierung und großer sozialer Probleme verhinderte der Widerstand alter Eliten einen weiteren Ausbau der sozialen Sicherungssysteme.
Welche Rolle spielt die Arbeitsemigration für die soziale Sicherung?
Die Emigration dient oft als Ersatz für staatliche Wohlfahrt. Rücküberweisungen der im Ausland arbeitenden Filipinos stützen die soziale Sicherheit der Familien im Heimatland.
Wie entwickelte sich die Wohlfahrt unter dem Marcos-Regime?
Während der Diktatur gab es punktuelle wohlfahrtspolitische Maßnahmen, die jedoch oft primär dem Machterhalt und der Beruhigung der Bevölkerung dienten.
Wie stehen die Philippinen im Vergleich zu Japan da?
Nur Japan hat eine noch längere Tradition staatlicher Wohlfahrt in Asien. Während Japan jedoch ein hochentwickeltes System aufbaute, blieben die Philippinen in der Entwicklung stecken.
- Quote paper
- Kai Posmik (Author), 2004, Zwischen Evolution und Stagnation - Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates auf den Philippinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27705