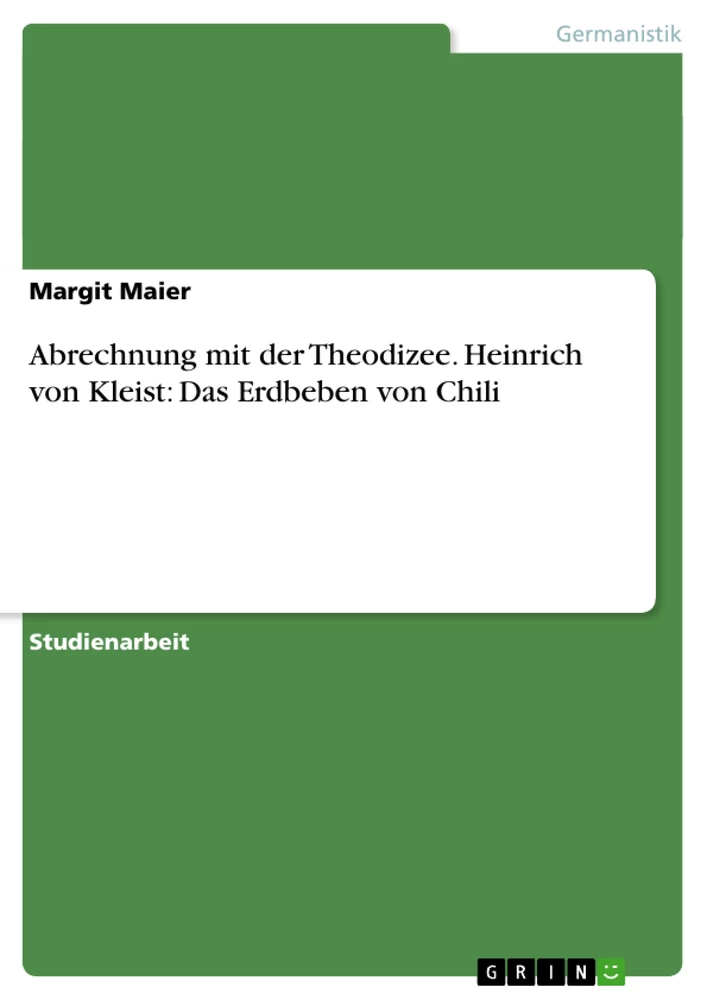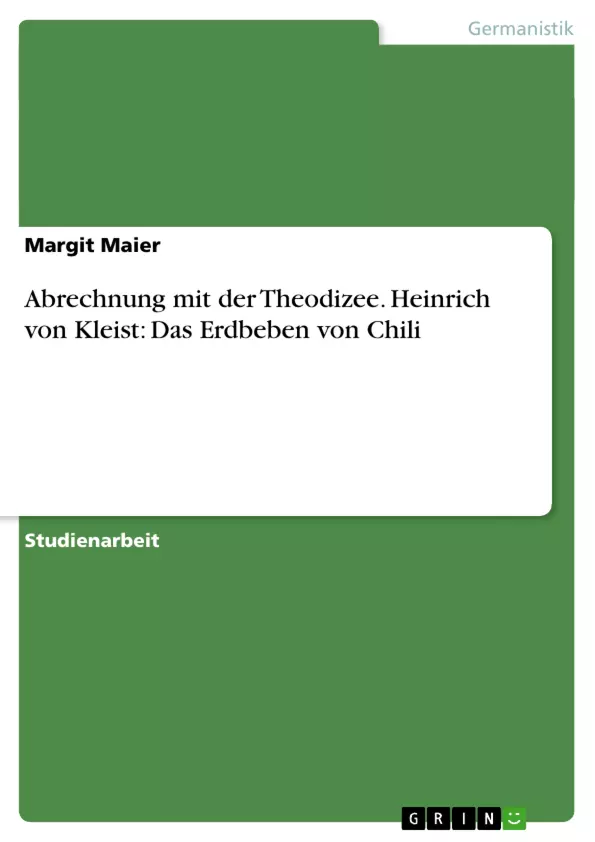Ein Erdbeben ist vordergründig ein Ereignis der Natur, in seinem Wesen neutral und
frei von jeder Wertung. Erst die Folgen und gesellschaftlichen Phänomene, die es mit
sich bringt, lassen es für den Menschen zu einer Katastrophe werden. Um ein solches
Ereignis dreht sich die erstmals im Jahre 1807 unter dem Titel „Jeronimo und Josephe“
erschienene Erzählung Heinrich von Kleists. Obwohl darin ein Rückbezug auf ein im
Jahre 1647 tatsächlich stattgefundenes Erdbeben in Chile vorhanden ist, handelt es sich
nicht um eine Historienerzählung. Der zeitgenössische Leser assoziierte mit der
Thematik viel mehr das für die Epoche wesentlich stärker prägende schwere Erdbeben
von Lissabon im Jahre 1755, welches viele Menschenleben forderte.
Das Lissabonner Erdbeben war unter anderem Auslöser einer zentralen Diskussion um
die vorherrschende Gottesanschauung und die Herkunft des Bösen in der Welt, an
welcher sich die bedeutendsten Theologen, Philosophen und Schriftsteller der Zeit
beteiligten. Die meisten Anhänger fand das Weltenmodell von Leibniz, welches er in
seinem Werk „Essais de théodicée sur la Bonté de Dieu, la liberté de l’homme et
l’origine du mal“ darlegte: Unsere Welt ist die beste aller möglichen Welten und basiert
auf einer von Gott prästabilierten Harmonie aller Dinge, d. h. alle Ereignisse sind im
Vorhinein festgelegt, zwangsläufig auch das Übel, weil alles Geschaffene nicht perfekt
sein kann, da es in diesem Fall gottgleich wäre. Eine ähnliche Ansicht vertrat auch Pope
in seiner Schrift „An Essay on Man“, welche in der griffigen Formel endet: „Whatever
is, is right.“
Während der junge Kant und vor allem Rousseau sich diesem Optimismus anschlossen,
dementierte Voltaire deren Ansichten vehement und stellte sich auf die Seite der
Optimismuskritiker. Heftigen Widerspruch gegen die Philosophen, die trotz aller
Katastrophen noch immer von der „Besten aller Welten“ sprachen, leistete Voltaire mit
seinem Gedicht „Poème sur la désastre de Lisbonne” und seinem satirischen Roman
„Candide”.
Kleist griff verschiedene Aspekte der Theodizeediskussion auf und entwickelte daraus
in seiner Erdbeben-Erzählung sein eigenes Weltbild. Ziel dieser Arbeit soll sein, „Das
Erdbeben von Chili“ als Stellungnahme zur Theodizeediskussion anhand einiger
ausgewählter Thesen zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Das Erdbeben von Chili – eine Stellungnahme
- Zwischen Polarität und Einheit
- Zum Menschenbild
- Begrifflichkeit des Weltsystems
- Der Glücksbegriff.
- Der Schicksalsbegriff.
- Auserwählt oder verdammt
- Christliche und menschliche Werte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Heinrich von Kleists Erzählung „Das Erdbeben von Chili“ als Stellungnahme zur Theodizeediskussion. Sie untersucht das Werk anhand ausgewählter Thesen und betrachtet Kleists eigene Sicht auf die Beziehung zwischen Gott, Mensch und Welt.
- Die Rolle des Erdbebens als Katalysator für die Auseinandersetzung mit der Theodizee.
- Kleists Darstellung von Polarität und Einheit im Leben und in der Welt.
- Die Frage des Menschenbildes im Kontext von Glück, Schicksal und Gotteserfahrung.
- Die Bedeutung des Christlichen und Menschlichen in Kleists Erzählung.
- Die Analyse von Kleists Werk im Kontext der Theodizeediskussion des 18. Jahrhunderts.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Erdbeben als Auslöser gesellschaftlicher und persönlicher Katastrophen und setzt Kleists Erzählung in den Kontext der Theodizeediskussion des 18. Jahrhunderts. Im zweiten Kapitel wird Kleists Gebrauch von Polaritäten und Gegensätzen untersucht, die sich in der Handlungsstruktur, dem Erzählstil und den Charakteren widerspiegeln. Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellung des Menschenbildes in der Erzählung und beleuchtet die Bedeutung von Glück, Schicksal und Gotteserfahrung. Das vierte Kapitel behandelt die Begrifflichkeit des Weltsystems, insbesondere die Themen des Glücksbegriffs und des Schicksalsbegriffs.
Schlüsselwörter
Theodizee, Erdbeben, Polarität, Einheit, Menschenbild, Glück, Schicksal, Gotteserfahrung, Christliche Werte, Menschliche Werte, Heinrich von Kleist, Das Erdbeben von Chili.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kleists „Das Erdbeben von Chili“?
Die Erzählung handelt von Jeronimo und Josephe, die während eines schweren Erdbebens in Chile (1647) knapp dem Tod entgehen. Das Naturereignis wird zum Auslöser für eine tiefgreifende gesellschaftliche und theologische Krise.
Was bedeutet „Theodizee“ im Kontext der Erzählung?
Theodizee ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids in der Welt. Kleist nutzt das Erdbeben, um die optimistische Weltsicht von Leibniz („beste aller möglichen Welten“) kritisch zu hinterfragen.
Welchen Einfluss hatte das Erdbeben von Lissabon auf Kleist?
Obwohl Kleist über Chile schreibt, war das Erdbeben von Lissabon (1755) der eigentliche zeitgenössische Bezugspunkt. Es löste eine europaweite Debatte über Gott und das Böse aus, an der sich Philosophen wie Voltaire und Kant beteiligten.
Wie stellt Kleist das Schicksal des Menschen dar?
Kleist zeigt den Menschen in einem Spannungsfeld aus Polarität und Einheit. Glück und Verdammnis liegen oft nah beieinander, und die göttliche Ordnung erscheint dem Menschen oft unbegreiflich oder grausam.
Ist die Erzählung eine Kritik an der Kirche?
Ja, Kleist kritisiert die religiöse Deutungsmacht. Während das Erdbeben die Liebenden rettet, führt die fanatische religiöse Interpretation des Ereignisses am Ende zum grausamen Tod der Protagonisten durch den Mob.
- Arbeit zitieren
- Margit Maier (Autor:in), 2003, Abrechnung mit der Theodizee. Heinrich von Kleist: Das Erdbeben von Chili, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27729