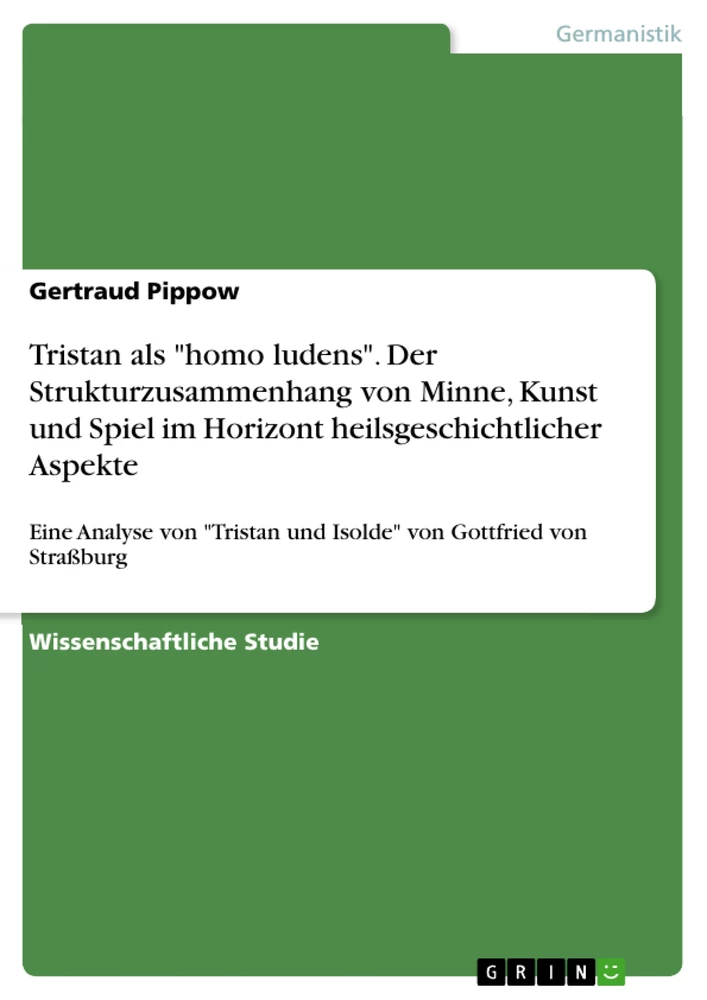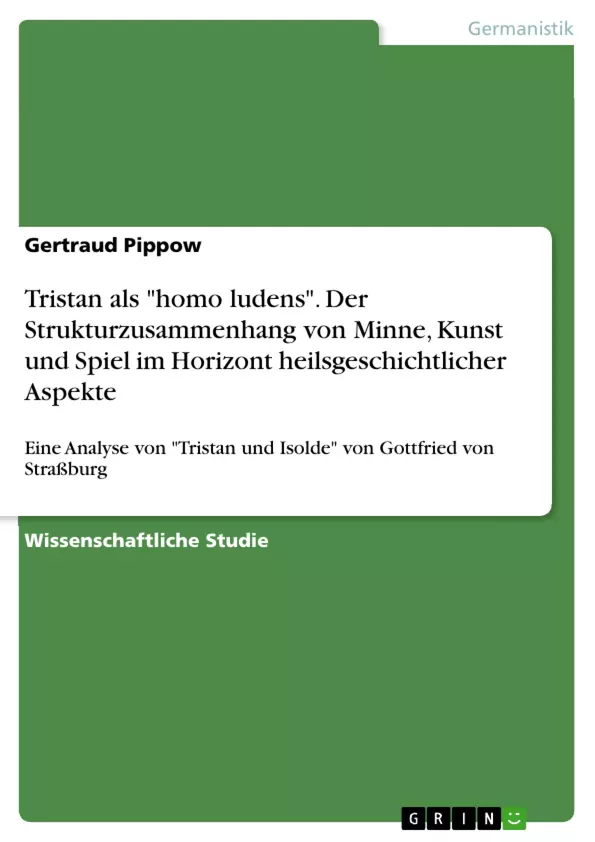Nach dem Scheitern des Dichters bei der Darstellung von Tristans Schwertleite geht dieser stellvertretend für ihn in die Rolle des apollinischen Künstlers ein und bringt in der Folge sich selbst und seine Liebesbeziehung zu Isolde hervor – und zwar nach dem Schema künstlerischen Produzierens. Seine Kunst erfüllt hierdurch die Kriterien des Spiels, nämlich die Identität von Darstellendem und Dargestelltem im Prozess der Darstellung. Dieser Vorgang verlangt in letzter Konsequenz, dass auch der Künstler selbst bzw. seine Liebe eingeht in das Werk, d.h. als Kunstwerk gestaltet wird.
Die Tristanliebe formt sich dadurch in Analogie zum christlichen Heilsgeschehen: Der Künstler stirbt den Liebestod mit dem Resultat einer Erlösung bzw. Selbstversöhnung der Gesellschaft, der die Liebe als deren eigene subjektive Seite fremd entgegensteht. Sein Weg durch die Welt hindurch trägt deren Merkmale: alle Varianten eines Spiels zwischen betrügerischem Blendwerk und reiner Liebe, die als Strukturmomente dieses Prozesses jeweils aufzuzeigen und einzuordnen sind, wobei die Beziehung zwischen Dichtertrank und Minnetrank von besonderer Relevanz ist.
Die Dichtung erscheint von ihrem Ende her als ein „Weltspiel“, das von seinen Protagonisten in allen seinen Höhen und Tiefen ausgeschritten wird. In einem komplexen Gefüge von Spiel und Widerspiel entwickelt sich das Geschehen schlüssig zu einem Prozess, der auf dem Wege kontinuierlicher Verinnerlichung in seine Reflexion durch den Leser mündet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Tristan als „,homo ludens“ Der Zusammenhang von Minne, Kunst und Spiel
- 2. Die Vorgeschichte als Präfiguration von Tristans Wesensbestimmung
- 3. Die Unverfügbarkeit des Anfangs und Tristans Weg ins Leben als Rollenspiel
- 4. Aneignung der Fremde über die Kunst des basts und des Harfenspiels: Tristans Selbstdarstellung als „Kunstwerk“ im Vollzug der eigenen Kunstfertigkeiten
- 5. Die Schwertleite: Tristans Aufnahme in die höfische Gesellschaft als ein das Sagbare überschreitender Akt.
- 6. Tristans Selbstproduktion in der Praxis des Kampfes
- a) Der Morgankampf als Versuch der Heilung einer inneren Wunde.
- b) Der Moroldkampf als Gottesurteil mit vertauschten Rollen
- c) Der Moroldkampf als Initiationsritual mit vertauschten gesellschaftlichen Rollen
- d) Der Moroldkampf als sich selbst aufhebendes Spiel um Leben und Tod
- 7. Tristans Heilung als Spiel mit dem Spiel
- 8. Isolde als lebendes Werk des Künstlers Tristan
- a) moraliteit daz süeze lesen
- b) Der Sirenenvergleich
- c) Das Preislied auf die niuwe sunne
- 9. Tristan als Meister der Hofintrige in einem doppelbödigen Spiel von Schein und Wahrheit.
- 10. Das Spiel um die Verwirklichung des Minneschicksals
- 11. Der Auftritt am Gerichtstag: Isolde als das verderspil der Minne – Tristan als Gegenspieler und Spiegel des Truchsess
- 12. Die ambivalenten Mächte der Nachtseite des Bewusstseins: Drachenkampf, Brunnenschlaf und Minnetrank.
- 13. Das Spiel von List und Gegenlist am Hofe als teidinc.
- a) Hochzeitsnacht und Ebertraum.
- b) Das teidinc im Baumgarten und das Gottesurteil
- 14. Das „Spielzeug“ Petitcriu als Objektivation des Trugbildes der Minne
- a) Farbenspiel und Schellenklang in ihrer Zuordnung zu Tristan und Isolde.
- b) Die Funktion Petitcrius als Spiegel der Tristan-Isolde-Minne.
- 15. Die Verlagerung des Spielraumes der Minne in die Innerlichkeit.
- a) Der Verzicht auf die state
- b) Das reine spil in der Minnegrotte.
- 16. Ars venandi und ars amandi
- 17. Das im Herzen begrabene lebende paradís und die Verkehrung des spils durch die huote..
- 18. Tristan als Spieler im Spiel der eigenen Liebe.
- a) Unser beider leben daz leitet ir
- b) Der edele leich Tristanden..........
- 19. Der Prolog als das „Ende“ der unvollendeten Dichtung.
- 20. Die Tristanminne als Imitatio des Heilsgeschehens?
- Literatur..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Gottfried von Straßburgs „Tristan und Isolde“ unter dem Aspekt des „homo ludens“. Sie untersucht, wie das Spiel als Strukturprinzip die Beziehung zwischen Minne, Kunst und Heilsgeschichte in der Dichtung prägt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Rolle des Spiels im Kontext der Tristan-Isolde-Liebe zu beleuchten und die Bedeutung des Spiels für die Selbstfindung und -verwirklichung der Figuren zu analysieren.
- Die Bedeutung des Spiels als Strukturprinzip in der Tristan-Isolde-Liebe
- Die Verbindung von Kunst, Spiel und Minne im Werk Gottfrieds von Straßburg
- Die Rolle des Spiels in der Selbstfindung und -verwirklichung der Figuren
- Die Analogie zwischen dem Spiel der Tristanliebe und dem christlichen Heilsgeschehen
- Die Bedeutung des Spiels für die Interpretation der Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Zusammenhang von Minne, Kunst und Spiel im Kontext der Tristan-Isolde-Liebe. Es wird argumentiert, dass Tristans Kunstfertigkeit, insbesondere im Harfenspiel, als Ausdruck seiner Selbstdarstellung und als Mittel zur Aneignung der Fremde verstanden werden kann. Das zweite Kapitel analysiert die Vorgeschichte als Präfiguration von Tristans Wesensbestimmung. Es wird gezeigt, wie Tristans Leben von Anfang an durch das Spiel geprägt ist und wie er sich in verschiedenen Rollen versucht. Das dritte Kapitel untersucht die Unverfügbarkeit des Anfangs und Tristans Weg ins Leben als Rollenspiel. Es wird deutlich, dass Tristan seine Identität durch das Spiel und die Aneignung verschiedener Rollen konstruiert. Das vierte Kapitel analysiert die Schwertleite als einen Akt, der das Sagbare überschreitet und Tristans Aufnahme in die höfische Gesellschaft markiert. Das fünfte Kapitel beleuchtet Tristans Selbstproduktion in der Praxis des Kampfes. Es werden verschiedene Kampfszenen analysiert, die als Ausdruck von Tristans Selbstfindung und -verwirklichung interpretiert werden können. Das sechste Kapitel untersucht Tristans Heilung als Spiel mit dem Spiel. Es wird gezeigt, wie Tristan durch das Spiel seine inneren Wunden heilt und zu sich selbst findet. Das siebte Kapitel analysiert Isolde als lebendes Werk des Künstlers Tristan. Es wird deutlich, wie Isolde als Objekt von Tristans Kunstfertigkeit und als Ausdruck seiner Liebe verstanden werden kann. Das achte Kapitel beleuchtet Tristans Rolle als Meister der Hofintrige in einem doppelbödigen Spiel von Schein und Wahrheit. Es wird gezeigt, wie Tristan durch List und Täuschung seine Ziele verfolgt. Das neunte Kapitel untersucht das Spiel um die Verwirklichung des Minneschicksals. Es wird deutlich, wie Tristan und Isolde in einem komplexen Spiel um ihre Liebe kämpfen. Das zehnte Kapitel analysiert den Auftritt am Gerichtstag und die Rolle von Isolde als das verderspil der Minne. Es wird gezeigt, wie Isolde als Objekt von Tristans Spiel und als Spiegelbild seiner Liebe verstanden werden kann. Das elfte Kapitel beleuchtet die ambivalenten Mächte der Nachtseite des Bewusstseins: Drachenkampf, Brunnenschlaf und Minnetrank. Es wird gezeigt, wie diese Elemente als Ausdruck von Tristans inneren Konflikten und seiner Suche nach Liebe und Glück interpretiert werden können. Das zwölfte Kapitel untersucht das Spiel von List und Gegenlist am Hofe als teidinc. Es werden verschiedene Szenen analysiert, die als Ausdruck von Tristans strategischem Vorgehen und seiner Fähigkeit zur Manipulation interpretiert werden können. Das dreizehnte Kapitel analysiert das „Spielzeug“ Petitcriu als Objektivation des Trugbildes der Minne. Es wird gezeigt, wie Petitcriu als Spiegelbild der Tristan-Isolde-Liebe und als Ausdruck von Tristans Sehnsucht nach Liebe und Glück verstanden werden kann. Das vierzehnte Kapitel beleuchtet die Verlagerung des Spielraumes der Minne in die Innerlichkeit. Es wird gezeigt, wie Tristan und Isolde in der Minnegrotte ein reines spil erleben, das von der Außenwelt abgeschnitten ist. Das fünfzehnte Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Ars venandi und ars amandi. Es wird gezeigt, wie Tristans Jagdkünste als Ausdruck seiner Liebe und seiner Fähigkeit zur Selbstbeherrschung verstanden werden können. Das sechzehnte Kapitel untersucht das im Herzen begrabene lebende paradís und die Verkehrung des spils durch die huote. Es wird gezeigt, wie Tristans Liebe zu Isolde als Ausdruck seiner Sehnsucht nach einem idealen Zustand verstanden werden kann. Das siebzehnte Kapitel analysiert Tristan als Spieler im Spiel der eigenen Liebe. Es wird gezeigt, wie Tristan in einem komplexen Spiel um seine Liebe kämpft und wie er sich selbst in diesem Spiel verliert. Das achtzehnte Kapitel beleuchtet den Prolog als das „Ende“ der unvollendeten Dichtung. Es wird gezeigt, wie der Prolog als ein Spiegelbild von Tristans Leben und seiner Liebe verstanden werden kann. Das neunzehnte Kapitel untersucht die Tristanminne als Imitatio des Heilsgeschehens. Es wird gezeigt, wie Tristans Liebe zu Isolde als ein Ausdruck von Gottes Liebe und als ein Spiegelbild des christlichen Heilsgeschehens verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „homo ludens“, die Tristan-Isolde-Liebe, Minne, Kunst, Spiel, Heilsgeschichte, Selbstfindung, Selbstverwirklichung, Rollenspiel, Hofintrige, List, Täuschung, Minnetrank, Drachenkampf, Brunnenschlaf, Petitcriu, Minnegrotte, Ars venandi, ars amandi, lebende paradís, Prolog, Imitatio, Heilsgeschehen.
- Arbeit zitieren
- Gertraud Pippow (Autor:in), 2014, Tristan als "homo ludens". Der Strukturzusammenhang von Minne, Kunst und Spiel im Horizont heilsgeschichtlicher Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277342