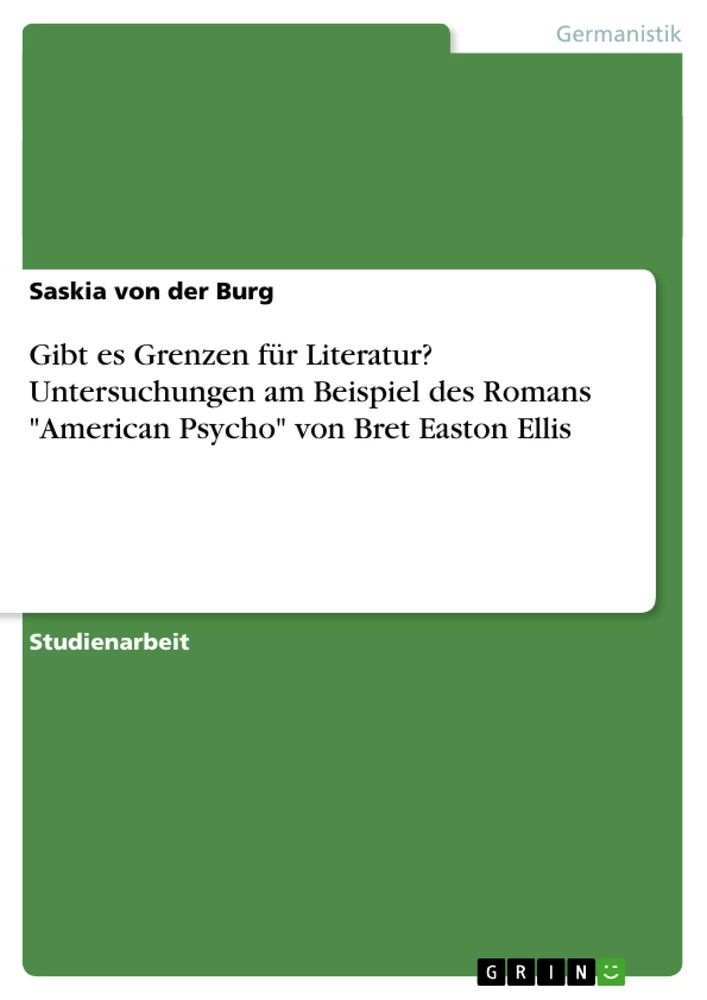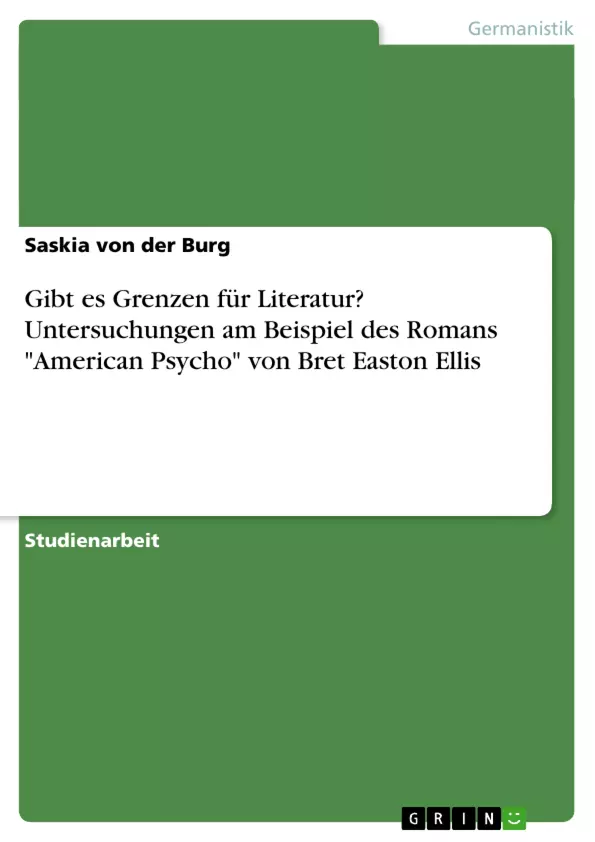Kinofilme fallen immer wieder der "Schere" zum Opfer. Jugendgefährende Szenen werden entschärft oder komplett entfernt. Gleiches gilt für Popsongs. Aber wie ist das eigentlich bei Literatur? Hat Literatur Grenzen? Und wenn ja, wer legt diese fest?
In den 90er Jahren löste Bret Easton Ellis mit seinem Roman "American Psycho" einen regelrechten Skandal aus. Frauenverbände gingen auf die Straße und veranlassten die Indizierung des Romans. "American Psycho" war nur noch unter der Ladentheke oder auf Nachfrage und Vorzeigen des AUsweises zu bekommen. Zu Recht? Handelt es sich bei diesem Buch u Splatter und Pornografie oder hohe Kunst? Mit dieser Frage beschäftigt sich das vorliegende Buch.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Gegenstand der Arbeit
- Was darf Literatur?
- Ein inszenierter Skandal?
- Literatur, die Kunst des schönen Wortes?
- Die Grenzen der Literatur am Beispiel von Bret Easton Ellis' „American Psycho“
- Frauenfeindlichkeit als Grenze für Literatur?
- Muss Literatur moralisch sein?
- Abschlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach den Grenzen der Literatur, insbesondere im Kontext von Gewaltdarstellungen. Sie analysiert den Skandal um Bret Easton Ellis' Roman „American Psycho“ und die damit verbundenen Reaktionen von Kritikern, Behörden und der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stehen die ethischen und ästhetischen Fragen, die sich aus extremen literarischen Darstellungen ergeben.
- Die Darstellung von Gewalt in der Literatur und ihre gesellschaftliche Relevanz
- Der Einfluss von Kontext und Interpretation auf die Bewertung literarischer Texte
- Die Rolle des Autors und des Verlegers bei der Gestaltung literarischer Grenzen
- Die Zensur und Indizierung von Literatur
- Die Debatte um Moral und Ästhetik in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Gegenstand der Arbeit: Die Einleitung beleuchtet die zeitlose Frage nach den Grenzen der Literatur, insbesondere im Kontext von Gewaltdarstellungen. Sie führt in die Thematik ein und verortet die Debatte im gesellschaftlichen Kontext, besonders im Hinblick auf die Reaktionen nach den Terroranschlägen vom 11. September. Die Arbeit kündigt die Analyse von Bret Easton Ellis' „American Psycho“ an, um die Frage nach dem Sagbaren in der Literatur zu untersuchen.
Was darf Literatur?: Dieses Kapitel untersucht die Frage nach den zulässigen Grenzen literarischer Darstellungen. Es analysiert den Skandal um „American Psycho“, der durch die extreme Gewaltdarstellung und die Darstellung von Frauenfeindlichkeit ausgelöst wurde. Die Reaktionen des Autors und der Kritik werden beleuchtet, ebenso wie die Frage nach der Intention des Autors und ob der Roman als inszenierter Skandal betrachtet werden kann. Es wird die Spannung zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung diskutiert.
Die Grenzen der Literatur am Beispiel von Bret Easton Ellis' „American Psycho“: Dieses Kapitel analysiert den Roman „American Psycho“ im Detail. Es beleuchtet die kontroversen Aspekte des Romans, wie die Darstellung von Frauenfeindlichkeit und die Frage, ob Literatur moralisch sein muss. Die Diskussion der öffentlichen Reaktionen, der Indizierung und der unterschiedlichen Bewertungen durch Experten und die Öffentlichkeit zeigen die Komplexität der Problematik. Die Kapitel befassen sich mit den verschiedenen Interpretationen des Romans und der Frage, ob die Extreme des Romans ihre Grenzen überschreiten.
Schlüsselwörter
Literatur, Grenzen der Literatur, Gewaltdarstellung, „American Psycho“, Bret Easton Ellis, Zensur, Indizierung, Moral, Ästhetik, gesellschaftliche Verantwortung, künstlerische Freiheit, Skandal, Frauenfeindlichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Grenzen der Literatur am Beispiel von Bret Easton Ellis' American Psycho"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage nach den Grenzen der Literatur, insbesondere im Hinblick auf Gewaltdarstellungen. Sie analysiert den Skandal um Bret Easton Ellis' Roman "American Psycho" und die darauf folgenden Reaktionen. Im Fokus stehen die ethischen und ästhetischen Fragen extremer literarischer Darstellungen, besonders im Kontext der gesellschaftlichen Reaktionen nach den Anschlägen vom 11. September.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Gewalt in der Literatur und deren gesellschaftlicher Relevanz, dem Einfluss von Kontext und Interpretation auf die Bewertung literarischer Texte, der Rolle von Autor und Verleger bei der Gestaltung literarischer Grenzen, der Zensur und Indizierung von Literatur sowie der Debatte um Moral und Ästhetik in der Literatur.
Welche Kapitel umfasst das Buch und worum geht es in diesen?
Das Buch gliedert sich in Kapitel zu: "Zum Gegenstand der Arbeit" (Einleitung und Kontextualisierung), "Was darf Literatur?" (Analyse des Skandals um "American Psycho" und die Frage nach zulässigen Grenzen), "Die Grenzen der Literatur am Beispiel von Bret Easton Ellis' 'American Psycho'" (Detaillierte Analyse des Romans, kontroverse Aspekte und öffentliche Reaktionen), und "Abschlussbemerkung".
Wie wird der Roman "American Psycho" analysiert?
Die Analyse von "American Psycho" konzentriert sich auf die kontroversen Aspekte wie die Darstellung von Frauenfeindlichkeit und die Frage nach der Moral in der Literatur. Die unterschiedlichen Reaktionen der Öffentlichkeit, die Indizierung und die verschiedenen Interpretationen des Romans werden diskutiert, um die Komplexität der Problematik aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literatur, Grenzen der Literatur, Gewaltdarstellung, "American Psycho", Bret Easton Ellis, Zensur, Indizierung, Moral, Ästhetik, gesellschaftliche Verantwortung, künstlerische Freiheit, Skandal, Frauenfeindlichkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage nach den Grenzen der Literatur anhand des Skandals um "American Psycho". Sie analysiert die Reaktionen von Kritikern, Behörden und der Öffentlichkeit und beleuchtet die ethischen und ästhetischen Fragen, die sich aus extremen literarischen Darstellungen ergeben.
- Citar trabajo
- Saskia von der Burg (Autor), 2002, Gibt es Grenzen für Literatur? Untersuchungen am Beispiel des Romans "American Psycho" von Bret Easton Ellis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27736