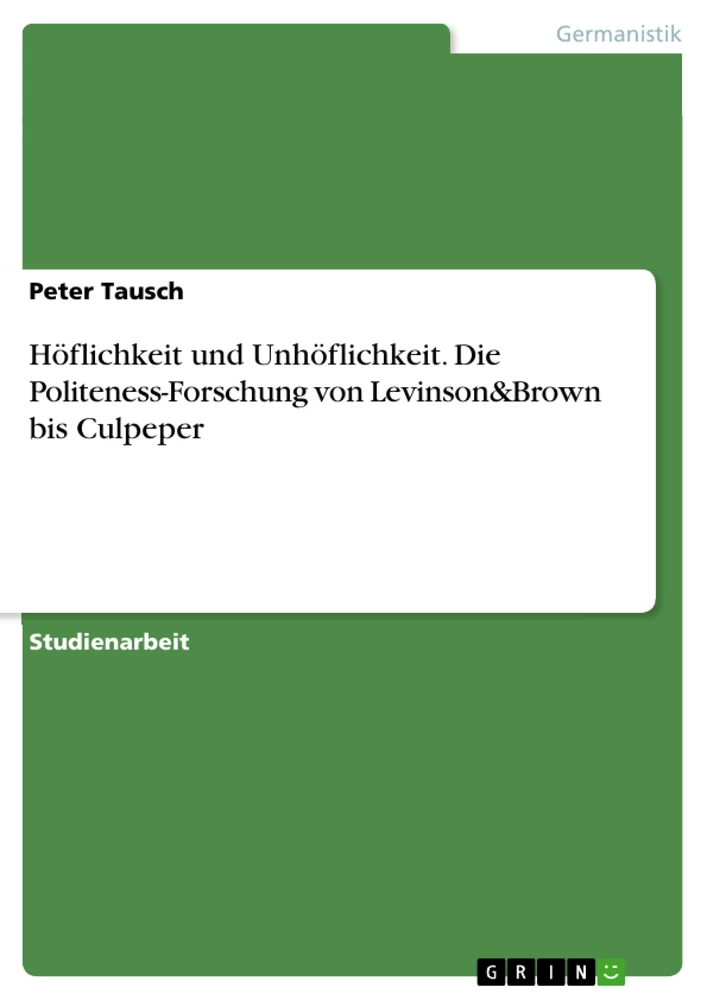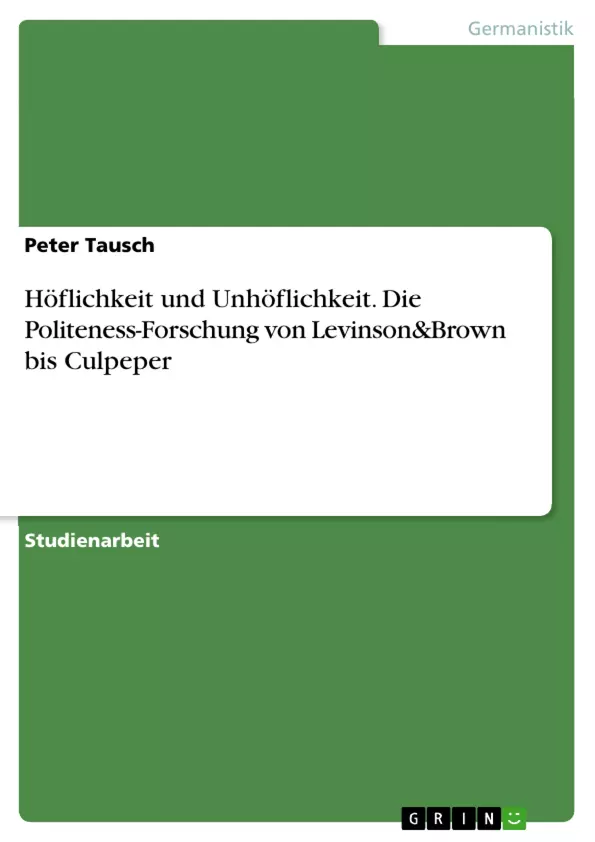Goffman entwirft in seinem Buch `Interaktionsrituale` den Gedanken des Image als „ein in Termini sozial anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild“. Diese sozial vermittelte Bewusstseinskonstruktion ist ein Mittel sozialer Repräsentation und bestimmt weitgehend Denken und Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft. Das Image repräsentiert den `Wert` einer Persönlichkeit, sowohl in ihren wie in den Augen der Anderen. Der Einzelne verbindet sich emotional mit seinem Bild und investiert in sozialen Interaktionen dieses Image zu erhalten und zu bewahren und ist im wohlverstandenen Eigeninteresse daran interessiert, anderen den gleichen Dienst zu erweisen. Damit werden im Prozess der Identifikationsbildung Werte und Strategien angelegt, die ohne ein bewusster Akt sein zu müssen, das Verhalten der Menschen bestimmen. Sie zielen auf eine berechenbare Strukturierung gesellschaftlicher Prozesse, da der Einzelne, will er nicht unglaubwürdig erscheinen, an sein Selbstbild gebunden und gezwungen ist, dieses in die Zukunft zu tragen. Um den drohenden Gesichtsverlust zu vermeiden, neigen diese Strategien zu Formen sozialen Ausgleiches im Spannungsfeld von Selbstbehauptung und freiwilliger Rücksichtnahme. Schon Goffmann sieht in den Variationen angewandter Höflichkeit Kommunikationsstrategien am Werke, die als Techniken der Imagepflege anzusehen sind und den zivilisatorischen Charakter einer Gesellschaft ausmachen können. Kommt es in Interaktionen zu face-Verletzungen, so haben diese für jeden Teilnehmer Konsequenzen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit mit verschiedenen Theorien zum Thema Höflichkeit und Unhöflichkeit, darunter die funktionale Bestimmung von Levinson & Brown, moderne Höflichkeitstheorien sowie die Theorien zu Un-/Höflichkeit von Culpeper.
Inhaltsverzeichnis
- Erving Goffmann's Theorie des `Image`
- Die funktionale Bestimmung der Höflichkeit bei Levinson&Brown
- Die frühe Theorie der Unhöflichkeit von Culpeper
- Postmoderne Höflichkeitstheorien
- Culpepers Definition von Impoliteness 2013
- Die Bedeutung des Contextes: Neutralisation, Normalisation und Legitimation
- Neutralisation am Beispiel von mock impoliteness
- Normalisation
- Legitimation
- Analyse der Krömer Late Night Show
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Höflichkeit und Unhöflichkeit in der Kommunikation. Sie analysiert verschiedene Theorien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, und untersucht die Bedeutung des Kontextes für die Interpretation von Höflichkeit und Unhöflichkeit. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle von Höflichkeit und Unhöflichkeit in der Late Night Show von Oliver Krömer.
- Theorien der Höflichkeit und Unhöflichkeit
- Die Bedeutung des Kontextes
- Die Rolle von Höflichkeit und Unhöflichkeit in der Kommunikation
- Analyse der Late Night Show von Oliver Krömer
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt Erving Goffmanns Theorie des `Image` vor. Goffmann argumentiert, dass das Image eine sozial vermittelte Bewusstseinskonstruktion ist, die das Denken und Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft bestimmt. Das Image repräsentiert den Wert einer Persönlichkeit und ist ein Mittel sozialer Repräsentation. Goffmann sieht in den Variationen angewandter Höflichkeit Kommunikationsstrategien am Werke, die als Techniken der Imagepflege anzusehen sind.
Das zweite Kapitel behandelt die funktionale Bestimmung der Höflichkeit bei Levinson&Brown. Levinson&Brown gehen davon aus, dass sprachliches Handeln zweckrational gesteuert wird. Sie differenzieren den Ansatz von Goffmann weiter in dem Sinne, dass sie das Image aufteilen in die Komponente des positiven und negativen face. Der Mensch wird hier nicht als ein harmonisches Wesen gesetzt, sondern wird erfahren als ein zwischen Autonomie und Gemeinschaft zerrissenes Wesen, welches ständig zwischen den eigenen widersprüchlichen Interessen und denen der anderen vermitteln muss.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der frühen Theorie der Unhöflichkeit von Culpeper. Culpeper definiert Unhöflichkeit als eine Form der sprachlichen Aggression, die darauf abzielt, das Gesicht des Gesprächspartners zu verletzen. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Unhöflichkeit, wie z.B. Beleidigungen, Drohungen und Beschimpfungen.
Das vierte Kapitel behandelt postmoderne Höflichkeitstheorien. Diese Theorien gehen davon aus, dass Höflichkeit und Unhöflichkeit nicht als feste Kategorien zu verstehen sind, sondern als dynamische Prozesse, die von den jeweiligen Kontextbedingungen abhängen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Culpepers Definition von Impoliteness aus dem Jahr 2013. Culpeper erweitert seine frühere Definition von Unhöflichkeit und betont die Bedeutung des Kontextes für die Interpretation von Unhöflichkeit. Er argumentiert, dass Unhöflichkeit nicht immer als negative Handlung zu verstehen ist, sondern auch als Mittel der sozialen Kontrolle oder der Selbstbehauptung dienen kann.
Das sechste Kapitel untersucht die Bedeutung des Kontextes für die Interpretation von Höflichkeit und Unhöflichkeit. Es werden drei verschiedene Formen der Kontextualisierung vorgestellt: Neutralisation, Normalisation und Legitimation. Am Beispiel von mock impoliteness wird gezeigt, wie Unhöflichkeit in bestimmten Kontexten neutralisiert werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Höflichkeit, Unhöflichkeit, Kommunikation, Image, face, face-threatening acts, Kontext, Neutralisation, Normalisation, Legitimation, Late Night Show, Oliver Krömer.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Erving Goffman unter dem "Image" (face)?
Das Image ist ein sozial anerkanntes Selbstbild, das Akteure in Interaktionen zu wahren und zu schützen versuchen, um Peinlichkeit oder Gesichtsverlust zu vermeiden.
Was ist der Unterschied zwischen positivem und negativem Face?
Das positive Face ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit; das negative Face ist das Bedürfnis nach Autonomie und Handlungsfreiheit.
Was sind "Face-Threatening Acts" (FTA)?
Handlungen wie Kritik, Befehle oder Beleidigungen, die das Gesicht des Gegenübers oder des Sprechers gefährden.
Wie definiert Culpeper Unhöflichkeit (impoliteness)?
Als sprachliche Strategien, die darauf abzielen, das Gesicht des anderen bewusst anzugreifen oder zu verletzen.
Was ist "mock impoliteness"?
Eine Form der scheinbaren Unhöflichkeit (z.B. Necken oder Scherzen unter Freunden), die im gegebenen Kontext nicht als Angriff, sondern als Zeichen von Vertrautheit verstanden wird.
Welche Rolle spielt der Kontext bei Unhöflichkeit?
Der Kontext bestimmt, ob eine Äußerung als legitim, normal oder neutralisiert (wie in Comedy-Shows) wahrgenommen wird.
- Arbeit zitieren
- Peter Tausch (Autor:in), 2014, Höflichkeit und Unhöflichkeit. Die Politeness-Forschung von Levinson&Brown bis Culpeper, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277460