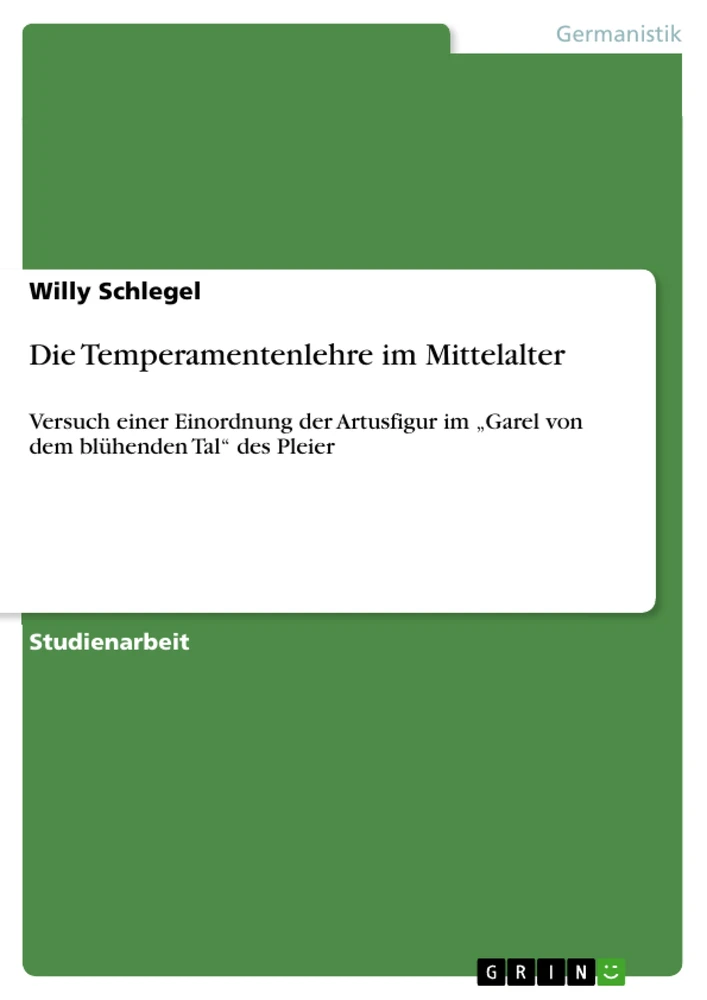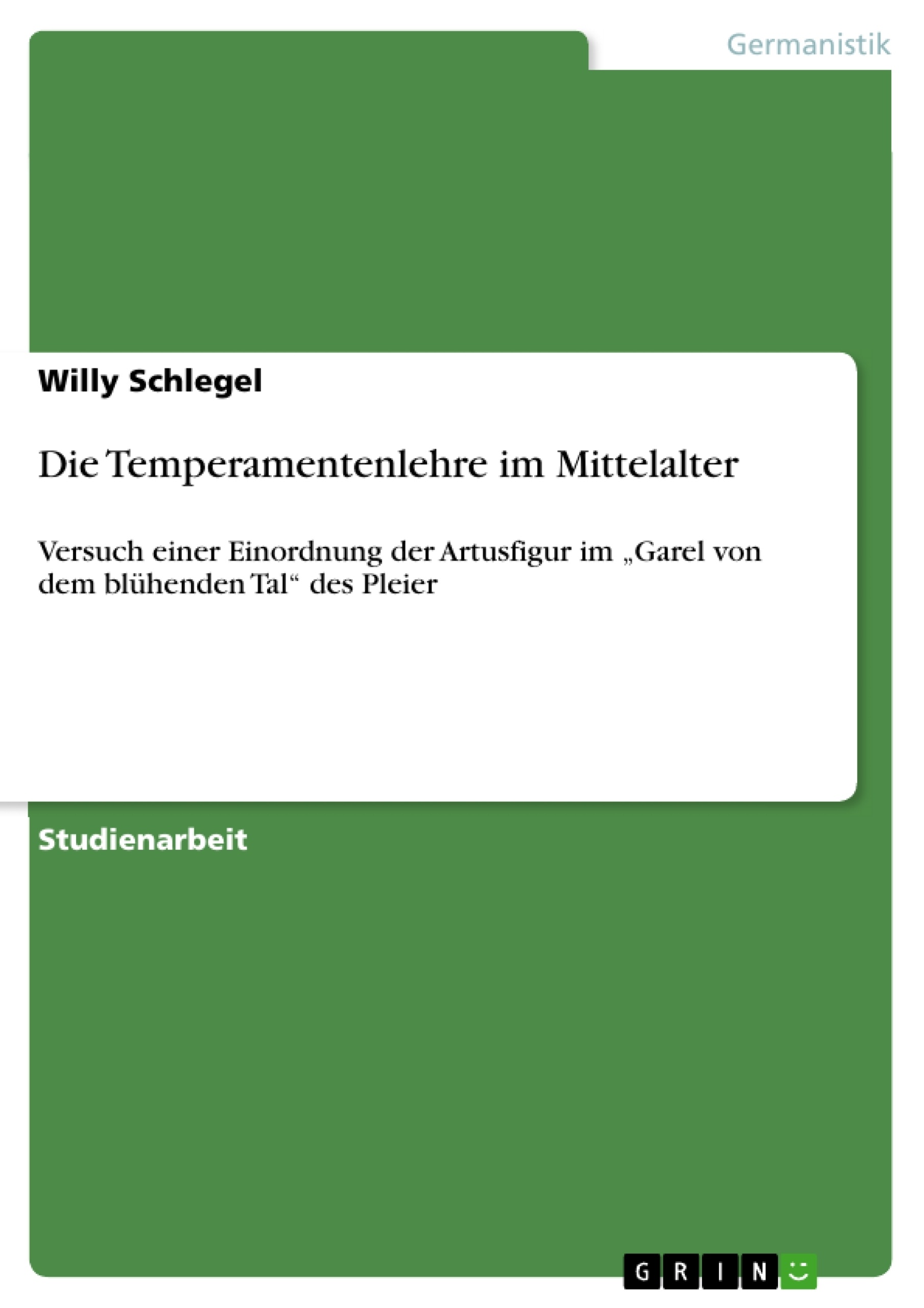Das „ӕvum medium“, das mittlere Zeitalter, wird häufig als eine Zeit der Stagnation und des Übergangs von der Antike und der Völkerwanderung bis wiederum zum Aufkeimen einer zivilisierten Kultur, der Renaissance, betrachtet. Voller Begeisterung und mit großer Freude stürzen sich Wissenschaftler auf die Überreste der römischen und griechischen, ja sogar der arabischen Schriften und rezipieren, strukturieren, rezitieren, kollationieren und traktieren sie unaufhörlich und unnachgiebig. Errungenschaften des Mittelalters? Fehlanzeige. Allenfalls die Literaturgeschichte, Kunsthistorik und Religionswissenschaften können ein relativ ausführliches Bild zeichnen, auch im technischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich laufen die Untersuchungen der Geschichte des Mittelalters nebenher. Die Medizingeschichte jedoch ist ein bisweilen eher unerforschtes Gebiet mit einer geringen Publikationsrate. Was das Mittelalter betrifft, kann durchaus von einer Statik des Wissenskanons gesprochen werden, doch bedeutet Statik auch System und Struktur. Und diese Solidität hat eine Dynamik in anderen, soziokulturellen Bereichen initiiert: So sind die großen Errungenschaften der Medizin des Mittelalters zum Ersten die Öffnung der Heilkunde für die Allgemeinheit in Form eines öffentlichen medizinischen Pflegedienstes, zum Zweiten begann die Entwicklung eines Krankenhauses im heutigen Sinne, auch wenn die Wohlsituierten natürlich den Arzt nach Hause kommen ließen und durch das Hospital eher das hoffnungslose Dahinvegetieren der Unterschicht abgefangen werden sollte, und zum Dritten hielt die Medizin Einzug in die Universitäten und bekam damit eine ungeheure Aufwertung.
Doch wie sieht nun dieses mittelalterliche Bild der Medizin auf den Menschen aus? In welchem Zusammenhang stehen dabei die Begriffe Humoralpathologie und Viersäftelehre. Und was hat nun der Charakter eines Menschen mit seiner physischen Beschaffenheit zu tun?
Im Folgenden soll ausführlich und schlüssig dargelegt werden, mit was sich die Humoralpathologie im Mittelalter beschäftigt, um davon ausgehend die mediävistische Temperamentenlehre zu erklären. Beispielhaft soll schließlich die Artusfigur des Schriftstellers, der sich selbst „Pleier“ nannte, in seinem Werk „Garel von dem blühenden Tal“ zur Untersuchung herangezogen werden. Dabei erfolgt eine Einordnung und Bewertung des Temperamentes der vorliegenden Figur im Kontext der mittelalterlichen viergeteilten Charakterlehre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Humoralpathologie
- Die Viersäftelehre der Antike
- Übergang zur Temperamentenlehre des Mittelalters
- Artus Zwischen Ruhe und Klage
- Pleiers Artusfigur im „Garel“
- Das arthurische Temperament im System der Humoralpathologie
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Temperamentenlehre des Mittelalters und ordnet die Artusfigur in Pleiers Werk „Garel von dem blühenden Tal“ in diesen Kontext ein. Die Analyse beleuchtet den Einfluss der antiken Viersäftelehre auf das mittelalterliche Verständnis von Charakteren und Persönlichkeit.
- Die Entwicklung der Humoralpathologie von der Antike bis ins Mittelalter
- Die Viersäftelehre und ihre Bedeutung für die Temperamentenlehre
- Die Charakterisierung der Artusfigur in „Garel von dem blühenden Tal“
- Die Einordnung des arthurischen Temperaments in das mittelalterliche System
- Die Bedeutung der mittelalterlichen Medizin im soziokulturellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Mittelalter als eine Zeit des Übergangs und der Rezeption antiken Wissens. Sie hebt die Bedeutung der mittelalterlichen Medizin hervor, insbesondere die Öffnung der Heilkunde für die Allgemeinheit, die Entwicklung von Krankenhäusern und die Einbindung der Medizin in die Universitäten. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Humoralpathologie, der Viersäftelehre und deren Zusammenhang mit der Charakterlehre an, wobei die Artusfigur in Pleiers „Garel von dem blühenden Tal“ als Beispiel dient.
Die Humoralpathologie: Dieses Kapitel beginnt mit der Darstellung der Viersäftelehre in der Antike, fokussiert auf Hippokrates und sein Corpus Hippocraticum. Es wird die Bedeutung seiner Theorie der Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) für die Entwicklung der Humoralpathologie erläutert und der Übergang zur mittelalterlichen Temperamentenlehre vorbereitet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Krankheit als Disharmonie der Säfte und deren Ausgleich als Therapieziel. Die Zuordnung von Säften zu Jahreszeiten, Lebensaltern und Farben wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Humoralpathologie, Viersäftelehre, Temperamentenlehre, Mittelalter, Hippokrates, Artusfigur, Garel von dem blühenden Tal, Pleier, Charakterlehre, Medizin, Antike.
Häufig gestellte Fragen zu "Garel von dem blühenden Tal" und der mittelalterlichen Temperamentenlehre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Temperamentenlehre des Mittelalters und ordnet die Artusfigur in Pleiers Werk „Garel von dem blühenden Tal“ in diesen Kontext ein. Sie analysiert den Einfluss der antiken Viersäftelehre auf das mittelalterliche Verständnis von Charakteren und Persönlichkeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Humoralpathologie von der Antike bis ins Mittelalter, die Viersäftelehre und ihre Bedeutung für die Temperamentenlehre, die Charakterisierung der Artusfigur in „Garel von dem blühenden Tal“, die Einordnung des arthurischen Temperaments in das mittelalterliche System und die Bedeutung der mittelalterlichen Medizin im soziokulturellen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Humoralpathologie, ein Kapitel zu Artus in "Garel von dem blühenden Tal" und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und die Zielsetzung. Das Kapitel zur Humoralpathologie behandelt die antike Viersäftelehre und ihren Übergang ins Mittelalter. Das Kapitel zu Artus analysiert seine Figur im Kontext der Temperamentenlehre. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die Humoralpathologie und ihre Bedeutung?
Die Humoralpathologie ist eine medizinische Theorie der Antike, die auf der Lehre von vier Körpersäften (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) basiert. Sie beeinflusste maßgeblich das mittelalterliche Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Temperament. Krankheiten wurden als Disharmonie dieser Säfte betrachtet, deren Ausgleich die Therapie zielte.
Welche Rolle spielt die Viersäftelehre?
Die Viersäftelehre, im Kern der Humoralpathologie, bildet die Grundlage für das Verständnis der Temperamente im Mittelalter. Die Zuordnung von Säften zu Jahreszeiten, Lebensaltern und Farben zeigt den ganzheitlichen Ansatz dieser Theorie.
Wie wird die Artusfigur in "Garel von dem blühenden Tal" analysiert?
Die Artusfigur in Pleiers Werk wird im Kontext der mittelalterlichen Temperamentenlehre analysiert. Die Arbeit untersucht, wie Pleiers Darstellung von Artus mit den humoralpathologischen Konzepten übereinstimmt oder davon abweicht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Humoralpathologie, Viersäftelehre, Temperamentenlehre, Mittelalter, Hippokrates, Artusfigur, Garel von dem blühenden Tal, Pleier, Charakterlehre, Medizin, Antike.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der mittelalterlichen Literatur, Medizin und Geschichte. Sie bietet einen Einblick in die medizinischen und kulturellen Kontexte der mittelalterlichen Literatur und deren Einfluss auf die Charakterisierung literarischer Figuren.
- Citation du texte
- Willy Schlegel (Auteur), 2013, Die Temperamentenlehre im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277629