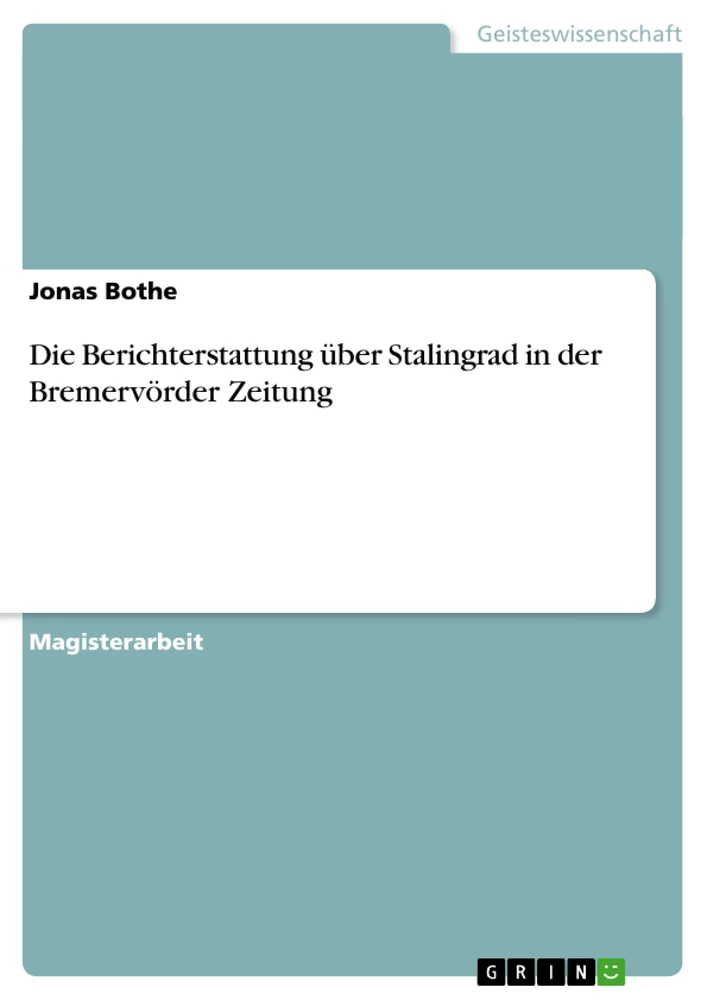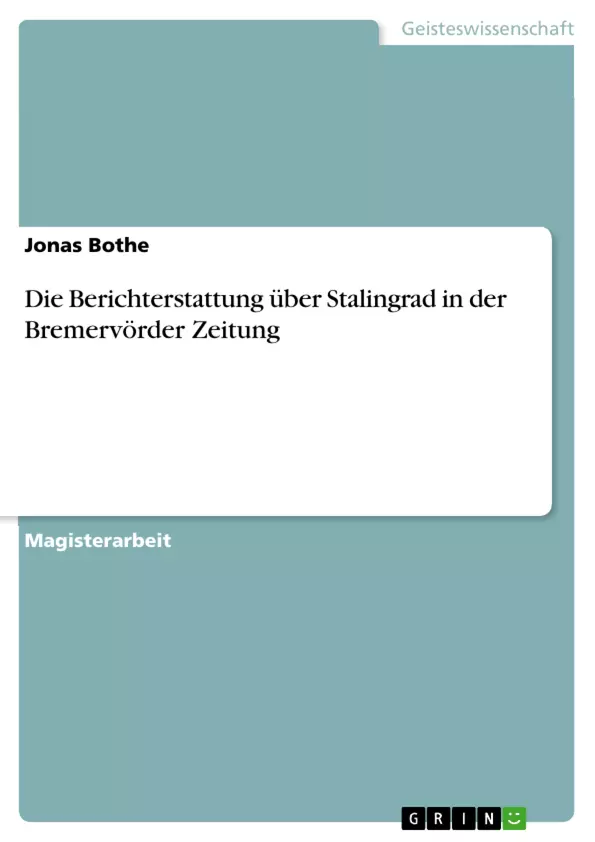Immer wieder wird in der Literatur Stalingrad als Mythos, als Legende, als das prägende Ereignis der Deutschen im Verlauf des Zweiten Weltkrieges dargestellt. Wie kam es dazu, dass dieser Mythos entstand? In der „Schlacht von Stalingrad“ haben Teile der deutschen Bevölkerung zumindest einen „Wendepunkt des Krieges“ gesehen, wie es die „Meldungen aus dem Reich“ des Sicherheitsdienstes der SS zu Protokoll gaben. Aus diesem Grund wird Stalingrad als psychologischer Wendepunkt des Krieges, nicht aber zwingend als militärischer angesehen. Es stellte sich in großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl ein, dass Stalingrad „der Anfang vom Ende“ sein könnte.
Die Frage ist, wie die „Schlacht von Stalingrad“ der Bevölkerung vermittelt wurde und wie die Wirkung entstehen konnte, dass es sich hierbei um den psychologischen Wendepunkt des Krieges handelte. Um diese Frage zu beantworten, hat sich die Forschung bislang überwiegend nur allgemein mit der Vorgehensweise der NS-Propaganda während der Kämpfe befasst. Der Fokus lag dabei nicht auf der konkreten Ausgestaltung der Berichterstattung in Presse und Rundfunk, sondern vielmehr auf den Anweisungen der obersten NS-Führung.
Diese Arbeit fragt daher nicht nach dem Vorgehen der NS-Führung im Allgemeinen, sondern geht vielmehr der Frage nach, wie versucht wurde, die „Destabilisierung des NS-Regimes“ zu verhindern. Dabei soll vor allem die Berichterstattung über Stalingrad in einer Heimatzeitung für eine ländlich geprägte Region im nationalsozialistischen Deutschland betrachtet werden. Aus diesem Grund wurde als Untersuchungsobjekt die „Bremervörder Zeitung“ gewählt. Sie stellt eine vormals bürgerlich-konservative Heimatzeitung dar, die während der NS-Diktatur vereinnahmt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Presse im Nationalsozialismus
- Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg
- Die,,Schlacht von Stalingrad“
- Die Bremervörder Zeitung
- Methodik
- Die vier Phasen der Berichterstattung
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4
- Die Modifikation des Raumes
- Der Wandel des Soldatenbildes
- Die Art und Weise der Berichterstattung
- Die Funktion der Berichterstattung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Bibliographie der Artikel der Bremervörder Zeitung
- Sekundärliteratur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit analysiert die Berichterstattung über die „Schlacht von Stalingrad“ in der „Bremervörder Zeitung“, einer Heimatzeitung im nationalsozialistischen Deutschland. Ziel ist es, die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung in einer ländlichen Region zu untersuchen und zu verstehen, wie die NS-Propaganda in einer kleinen Zeitung umgesetzt wurde. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob die „Bremervörder Zeitung“ als ein eher kritisches oder ein der NS-Propaganda loyales Blatt angesehen werden kann.
- Die Rolle der Presse im Nationalsozialismus und die Funktionsweise der Kriegsberichterstattung
- Die Darstellung der „Schlacht von Stalingrad“ in der „Bremervörder Zeitung“
- Die Analyse der Berichterstattung anhand der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse
- Die Frage nach der Wirkung der Berichterstattung auf die Leserinnen und Leser
- Die Untersuchung der Umsetzung von Propagandarichtlinien in einer kleinen Zeitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung des Stalingrad-Mythos und der Rolle der Berichterstattung in der „Bremervörder Zeitung“ in diesem Prozess. Sie beleuchtet die Bedeutung von Stalingrad als psychologischer Wendepunkt des Krieges und die bisherige Forschung, die sich vor allem mit der NS-Propaganda im Allgemeinen befasst hat. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung in einer Heimatzeitung zu untersuchen.
Das Kapitel „Historischer Kontext“ beleuchtet die funktionale Ausgestaltung der Presse im Nationalsozialismus und die Funktionsweise der Kriegsberichterstattung. Es stellt die allgemeine Presselandschaft unter der NS-Diktatur dar und erläutert die Strukturen und Handlungsabläufe im Kriegsalltag. Außerdem werden die militärischen Abläufe der „Schlacht von Stalingrad“ und die Geschichte der „Bremervörder Zeitung“ dargestellt.
Das Kapitel „Methodik“ erläutert die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, die für die Analyse der Berichterstattung in der „Bremervörder Zeitung“ verwendet wurde. Es wird die konkrete Umsetzung der Analyse dargelegt und begründet.
Die Kapitel „Die vier Phasen der Berichterstattung“, „Die Modifikation des Raumes“, „Der Wandel des Soldatenbildes“, „Die Art und Weise der Berichterstattung“ und „Die Funktion der Berichterstattung“ präsentieren die Ergebnisse der Inhaltsanalyse und interpretieren diese ausführlich. Sie beleuchten die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung in der „Bremervörder Zeitung“ und analysieren die Umsetzung von Propagandarichtlinien in einer kleinen Zeitung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Berichterstattung über Stalingrad, die „Bremervörder Zeitung“, die NS-Propaganda, die Kriegsberichterstattung, die qualitative Inhaltsanalyse, die „Schlacht von Stalingrad“ und die Rolle der Presse im Nationalsozialismus. Die Arbeit untersucht die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung in einer Heimatzeitung und analysiert die Umsetzung von Propagandarichtlinien in einer kleinen Zeitung. Sie beleuchtet die Darstellung der „Schlacht von Stalingrad“ in der „Bremervörder Zeitung“ und die Frage nach der Wirkung der Berichterstattung auf die Leserinnen und Leser.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Stalingrad oft als psychologischer Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges bezeichnet?
Stalingrad gilt als psychologischer Wendepunkt, weil sich in großen Teilen der deutschen Bevölkerung das Gefühl einstellte, dass die Niederlage „der Anfang vom Ende“ sein könnte. Während die militärische Bedeutung debattiert wird, war die Wirkung auf die Moral der Bevölkerung und die Wahrnehmung des NS-Regimes massiv.
Welche Rolle spielt die Bremervörder Zeitung in dieser Forschungsarbeit?
Die Bremervörder Zeitung dient als Untersuchungsobjekt, um die konkrete Umsetzung der NS-Propaganda in einer ländlich geprägten Region zu analysieren. Es wird untersucht, wie eine ehemals bürgerlich-konservative Heimatzeitung während der NS-Diktatur vereinnahmt wurde.
Wie wurde die Schlacht von Stalingrad der Bevölkerung vermittelt?
Die Vermittlung erfolgte durch eine gezielte Steuerung der NS-Führung in Presse und Rundfunk. Die Arbeit untersucht dabei vier Phasen der Berichterstattung, die Modifikation des Raumes sowie den Wandel des Soldatenbildes, um eine Destabilisierung des Regimes zu verhindern.
Was ist das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit?
Die Methode wird genutzt, um die Berichterstattung systematisch zu untersuchen und zu klären, ob die Zeitung als kritisches Medium oder als loyales Instrument der NS-Propaganda agierte.
Welche Aspekte der Berichterstattung werden detailliert analysiert?
Die Analyse umfasst die vier Phasen der Berichterstattung, die Veränderung der räumlichen Darstellung, den Wandel des Bildes vom deutschen Soldaten sowie die allgemeine Funktion und Art der Propagandaumsetzung.
- Arbeit zitieren
- Jonas Bothe (Autor:in), 2011, Die Berichterstattung über Stalingrad in der Bremervörder Zeitung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277633