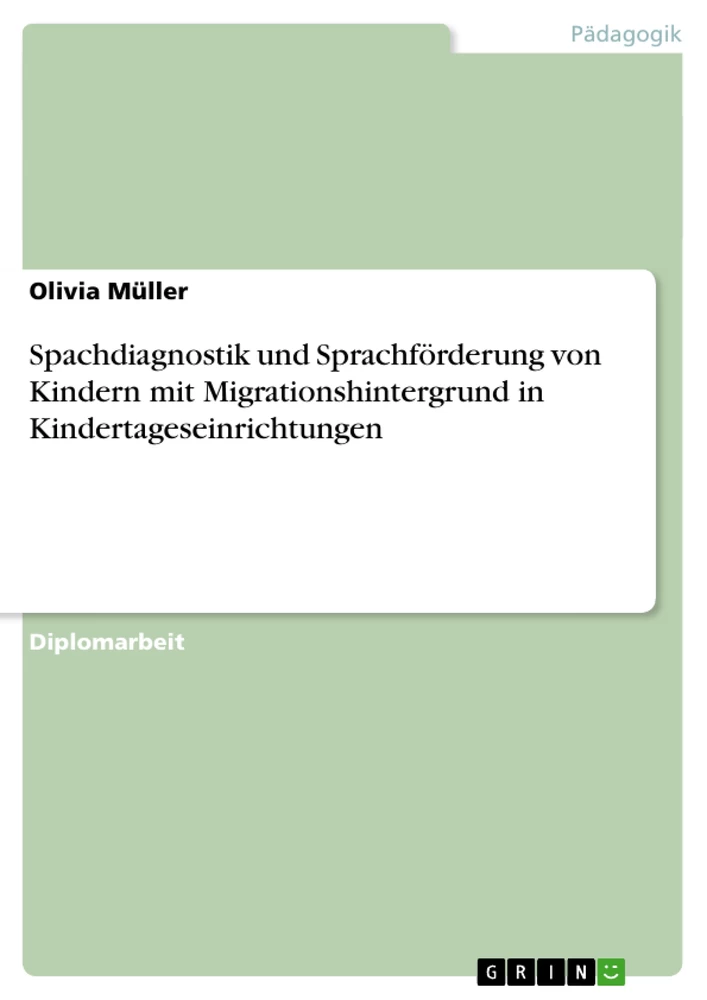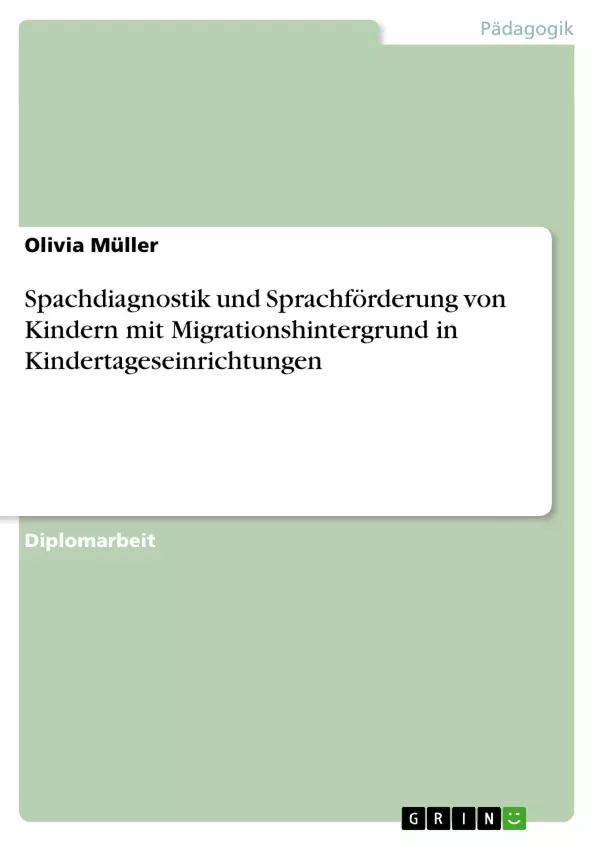Im Zuge der Ergebnisse von internationalen Leistungsvergleichstudien wie IGLU (Internationale
Grundschul-Leseuntersuchung) oder PISA (Program for International Student Assessment) (vgl. Deutsches Pisakonsortium, 2003), geriet auch der Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen in den Fokus der Öffentlichkeit. In Deutschland begann eine breite Debatte darüber, dass Kindergärten und andere Tageseinrichtungen ihren Schwerpunkt von der reinen Betreuung und „Aufbewahrung“ der Kinder, hin zur
Bildungsstätte für die frühkindliche Entwicklung verlagern müssen, was durch die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Jugendministerkonferenz (JMK) (2004) im ‚Gemeinsamen
Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen‘ konkretisiert wurde. Besonderes Augenmerk wurde u.a. auf die Sprachentwicklung gelegt und darauf, mögliche Sprachentwicklungsstörungen und damit eventuell drohenden, schulischen Misserfolg frühzeitig zu erkennen und die Sprachentwicklung angemessen zu fördern (KMK u. JMK (2004, S.4)). Das bedeutet für die Bildungspolitik
die große Aufgabe, die frühpädagogische Sprachdiagnostik aufzubauen und Sprachförderangebote auszubauen.
Ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema ist die Tatsache, dass der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, bzw. derer, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, in den Kindertageseinrichtungen weiter zunimmt, wie die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2012, S.76) feststellte.
Was bedeutet diese Tatsache für die Sprachdiagnostik und Sprachförderung, die in den Bildungseinrichtungen stattfindet?
Die folgende Arbeit soll einen Einblick geben in die derzeitige Situation der sprachlichen Diagnostik, Förderung und Bildung im frühkindlichen Bereich und darin, wie das Thema in den verschiedenen Bundesländern gehandhabt wird. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, in welchem Umfang dabei berücksichtigt wird, dass längst nicht mehr vom einsprachig, Deutsch sprechenden Kindergartenkind ausgegangen werden kann, sondern der Anteil der Kinder, die mehrsprachig aufwachsen oder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch, immer mehr steigt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Einleitung
- Sprachdiagnostik
- Definitionen und Begriffe
- Notwendigkeit von Spracherfassungsverfahren
- Funktionen der Spracherfassungsverfahren
- Diagnostische Methoden
- Untersuchungsbereiche
- Qualitätsmerkmale
- Probleme der Sprachstandsmessung
- Zweitspracherwerb und Mehrsprachigkeit
- Sprachentwicklung, Sprachlernen, Spracherwerb oder Sprachaneignung
- Grundlegendes zum Spracherwerb
- Mehrsprachigkeit
- Besonderheiten des Zweitspracherwerbs
- Einflussfaktoren auf den Spracherwerb
- Spracherwerbsstörung oder mangelnde Sprachbeherrschung
- Faktoren in der Entwicklung kindlicher Mehrsprachigkeit
- Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit bei Sprachstandsmessungen
- Ansprüche an Diagnoseverfahren für mehrsprachige Kinder
- Verfahren, die Mehrsprachigkeit berücksichtigen
- Sprachförderung
- verschiedene Arten der Sprachförderung
- Sprachfördertools
- Sprachfördermaßnahmen
- Einzelne Sprachförderprogramme für mehrsprachige Kinder
- Erfolgsfaktoren für die Sprachförderung
- Zusammenfassung
- Die Orientierungs- und Bildungspläne im Elementarbereich
- Der Bildungsbereich Sprache
- Diagnostik in den Bildungsplänen
- Sprachförderung in den Bildungsplänen
- Mehrsprachigkeit in den Bildungsplänen
- Eingesetzte Testverfahren und Förderprogramme in den Bundesländern
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Nordrhein-Westfalen
- Zusammenfassung
- weitere Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die gegenwärtige Situation der Sprachdiagnostik, -förderung und -bildung im frühkindlichen Bereich unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie untersucht, wie die Mehrsprachigkeit dieser Kinder in den verschiedenen Bundesländern berücksichtigt und in die pädagogische Praxis integriert wird.
- Die Bedeutung von Sprachdiagnostik in Kindertageseinrichtungen
- Die Herausforderungen der Sprachstandsmessung bei mehrsprachigen Kindern
- Die Integration von Mehrsprachigkeit in Sprachfördermaßnahmen
- Die Rolle von Bildungsplänen in der Förderung sprachlicher Kompetenzen
- Die Analyse von Beispielen aus verschiedenen Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der Sprachdiagnostik, ihrer Notwendigkeit und verschiedenen Methoden. Anschließend werden die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs und der Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Ansprüchen an Diagnoseverfahren für mehrsprachige Kinder und stellt verschiedene Verfahren vor, die die Mehrsprachigkeit berücksichtigen. Das vierte Kapitel widmet sich verschiedenen Methoden der Sprachförderung, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund liegt. Im fünften Kapitel werden die Orientierungs- und Bildungspläne im Elementarbereich hinsichtlich ihrer Berücksichtigung von Sprachdiagnostik, -förderung und -bildung analysiert. Das sechste Kapitel präsentiert exemplarisch die Vorgehensweisen und Verfahren zur Diagnose und Sprachförderung in vier verschiedenen Bundesländern.
Schlüsselwörter
Sprachdiagnostik, Sprachförderung, Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund, Kindertageseinrichtungen, Bildungspläne, Diagnoseverfahren, Förderprogramme, Bundesländer.
- Quote paper
- Olivia Müller (Author), 2014, Spachdiagnostik und Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277807