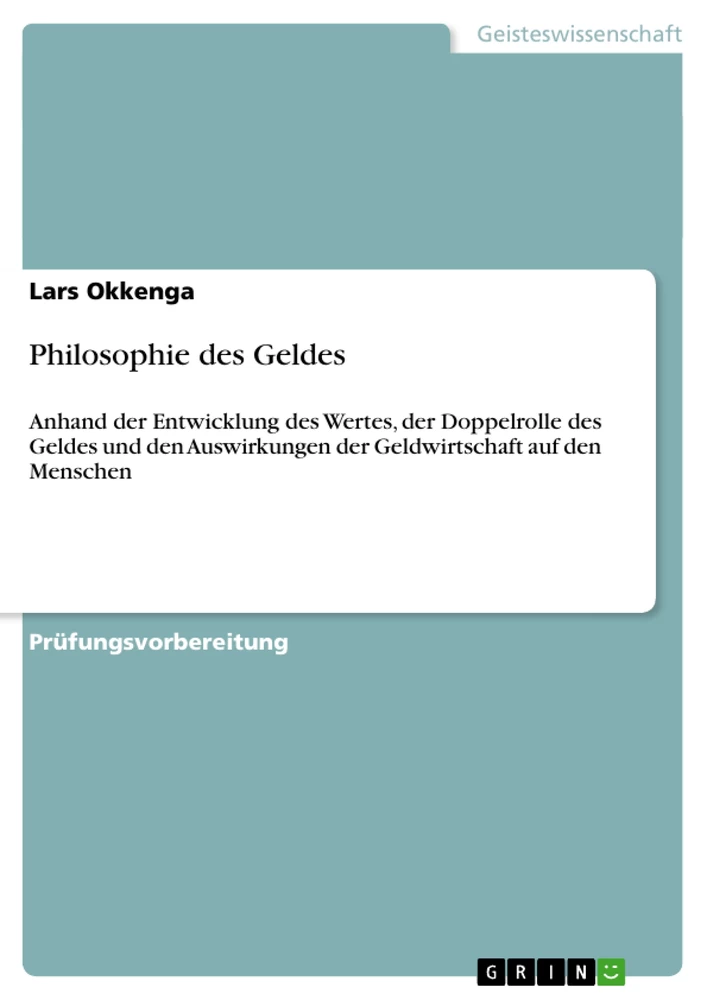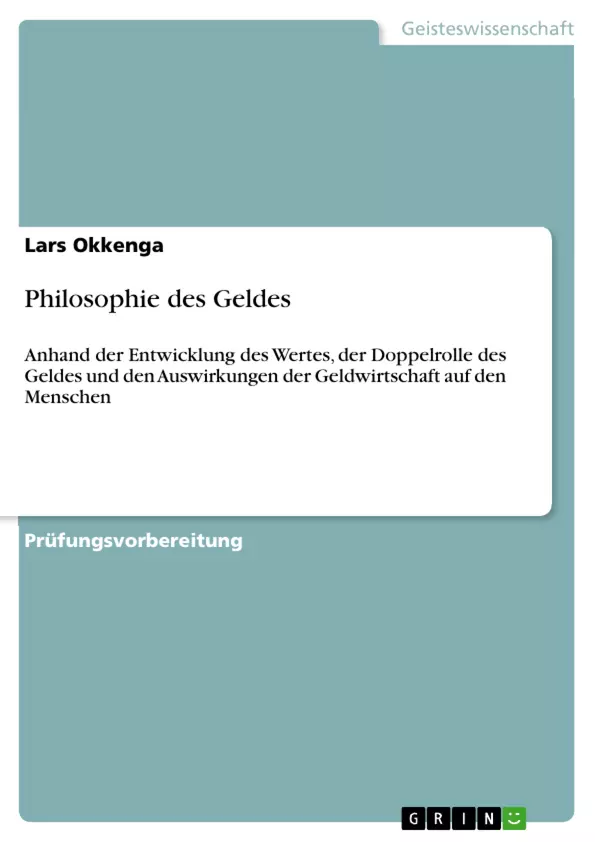Darstellung der Philosophie des Geldes anhand der Entwicklung des Wertes, der Doppelrolle des Geldes und den Auswirkungen der Geldwirtschaft auf den Menschen.
Vorbereitung für mündliche Prüfung (Vordiplom)
Inhaltsverzeichnis
- Grundsätzliche Bestimmung des Wertes eines Objekts durch ein subjektives Urteil
- Der ökonomisch relevante Wert ergibt sich erst im Tausch
- Das Geld entspricht einem Symbol für den im Tausch ermittelten Wert
- Die Doppelrolle des Geldes in der Geldwirtschaft
- Möglichkeit der Wertkonstanz des Geldes beruht auf seiner Funktion innerhalb und außerhalb der Zeit ( Aktionsreihe )
- Auswirkungen der Geldwirtschaft der Geldwirtschaft auf den Menschen anhand der Individualisierung, Vergesellschaftung und Versachlichung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Philosophie des Geldes und untersucht die Entwicklung des Wertes, die Doppelrolle des Geldes und die Auswirkungen der Geldwirtschaft auf den Menschen. Die zentrale These ist, dass Geld die treibende Kraft der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ist. Die Philosophie des Geldes wird dabei sowohl im Kontext der ökonomischen Wissenschaft als auch jenseits davon betrachtet. Die Arbeit analysiert die Bedingungen der Möglichkeit von Geld und untersucht, wie das Wesen des Geldes aus den Bedingungen und Verhältnissen des allgemeinen Lebens zu verstehen ist. Darüber hinaus wird die Frage untersucht, wie das Geld das allgemeine Leben prägt und welche Auswirkungen die Geldwirtschaft auf den Menschen und die Gesellschaft hat.
- Die Entwicklung des Wertes und die Rolle des subjektiven Urteils
- Die Doppelrolle des Geldes als Relation und als absolutes Maßstab
- Die Bedeutung der Wertkonstanz des Geldes und seine Funktion innerhalb und außerhalb der Zeit
- Die Auswirkungen der Geldwirtschaft auf die Individualisierung, Vergesellschaftung und Versachlichung
- Die Rolle des Geldes als treibende Kraft der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der grundsätzlichen Bestimmung des Wertes eines Objekts. Es wird argumentiert, dass der Wert eines Objekts nicht aus einer Eigenschaft des Objekts selbst hervorgeht, sondern aus einem subjektiven Urteil des Betrachters. Der Wert entsteht durch die Relation zwischen dem begehrenden Subjekt und dem distanzierten Objekt. Der ökonomisch relevante Wert ergibt sich erst im Tausch, wobei der Tausch das einzige Kriterium für die Ermittlung des Wertes der ausgetauschten Güter ist. Die Wertbildung innerhalb der Wirtschaft erfolgt durch den Austausch von Dingen zwischen zwei Personen, wobei die eigene Wertung an der Wertung des anderen gemessen werden muss. Der Wert hat sowohl einen subjektiven Aspekt (Begehren und Genießen) als auch einen objektiven Aspekt (Distanz oder ökonomische Seltenheit). Das Geld entspricht einem Symbol für den im Tausch ermittelten Wert und drückt den relativen Tauschwert in Geld aus. Das Geld hat somit eine Doppelrolle: Es ist einerseits Relation für den relativen Tauschwert, andererseits hat es auch Relation.
Das zweite Kapitel analysiert die Doppelrolle des Geldes in der Geldwirtschaft. Es wird gezeigt, dass die Geldwirtschaft entweder als Tauschwirtschaft (W-W) oder als Wirtschaft in der Waren gegen Geld verkauft/gekauft werden (W-G-W-G) betrachtet werden kann. Im ersten Fall ist Geld Relation, im zweiten Fall ist es Teil des Wert-/Preisbildungsprozesses und wird zum absoluten Maßstab. Das Geld bezieht sich in der Ökonomien auf den abnehmenden Grenznutzen (Wertrelativismus). Der Grenznutzen sinkt bei zunehmender Menge, wobei Güter wie Nahrung und Kleidung einen begrenzten Bedarf haben, während Luxusgüter und Geld einen unbegrenzten Bedarf haben. Das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen trifft auf Nahrung und Kleidung zu, nicht aber auf Luxusgüter und Geld. Wenn das Geld Relation hat, bildet es die absoluten Preise, die beim Kauf/Verkauf gezahlt wurden, wieder.
Das dritte Kapitel untersucht die Möglichkeit der Wertkonstanz des Geldes. Es wird argumentiert, dass die Wertkonstanz des Geldes auf seiner Funktion innerhalb und außerhalb der Zeit (Aktionsreihe) beruht. Außerhalb der Zeit ist das Geld selbst wertlos, es spiegelt nur die Tauschwerte wieder. Innerhalb der Zeit muss es wertvoll sein, weil es den Wert von einem Zeitpunkt zum anderen Zeitpunkt übertragen muss. Die Funktion des Geldes außerhalb der Zeit (Zeichen des relativen Wertes) macht den reinen Sinn des Geldes aus, seine ideelle Stellung. Die Funktion innerhalb der Zeit (Funktion als absoluter Wert) macht seine reale Stellung aus. Die ideelle Stellung des Geldes ist eine Vorstellung in den Köpfen der wirtschaftlichen Menschen, die Vorstellung des Geldes als wertkonstantem Zeichen des relativen Wertes. Das Rechnen mit absoluten Preisen findet im Bewusstsein statt, wobei das Geld als ideales Geld und damit nichts als Zeichen des relativen Wertes betrachtet wird. Die Geldwirtschaft funktioniert so, als ob das Geld nur als reines Zeichen der relativen Werte entscheidend sei und gleichzeitig als ob der Geldpreis entscheidend sei. Ökonomisch wirkt das Geld sowohl als Zeichen des relativen Wertes als auch als Zeichen der absoluten Preise.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Philosophie des Geldes, die Entwicklung des Wertes, die Doppelrolle des Geldes, die Auswirkungen der Geldwirtschaft auf den Menschen, die Individualisierung, die Vergesellschaftung, die Versachlichung, die Wertkonstanz, der Grenznutzen, die Aktionsreihe, die ideelle Stellung des Geldes, die reale Stellung des Geldes, die Tauschwirtschaft, die Geldwirtschaft, die subjektive Wertung, die objektive Wertung, die relative Seltenheit, die relative Freiheit, die Abhängigkeit von der Geldwirtschaft, die sachliche Beziehung, die Rechtsform des Vertrags, die Börse.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Wert eines Objekts philosophisch bestimmt?
Der Wert entsteht nicht aus dem Objekt selbst, sondern durch ein subjektives Urteil des Begehrens und wird ökonomisch erst im Moment des Tausches fassbar.
Was ist die Doppelrolle des Geldes?
Geld fungiert einerseits als reines Relationsmittel für Tauschwerte und andererseits als absoluter Maßstab für Preise innerhalb der Geldwirtschaft.
Wie wirkt sich die Geldwirtschaft auf die Individualisierung aus?
Geld ermöglicht eine sachliche Distanz in Beziehungen, was einerseits zu mehr persönlicher Freiheit führt, andererseits aber auch eine Versachlichung menschlicher Kontakte zur Folge hat.
Was bedeutet „Wertkonstanz“ des Geldes?
Geld muss ideell als wertbeständig wahrgenommen werden, um Werte über die Zeit hinweg übertragen zu können, auch wenn es als Zeichen selbst wertlos ist.
Was besagt das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens?
Es besagt, dass der Nutzen eines Gutes mit zunehmender Menge sinkt. Während dies für Grundbedürfnisse wie Nahrung gilt, bleibt der Bedarf an Geld und Luxusgütern oft unbegrenzt.
Warum wird Geld als „Symbol für den Tauschwert“ bezeichnet?
Weil Geld selbst keinen Eigenwert besitzen muss; es drückt lediglich die Relation zwischen verschiedenen tauschbaren Gütern in einer abstrakten Form aus.
- Citation du texte
- Diplom-Soziologe Lars Okkenga (Auteur), 2004, Philosophie des Geldes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277813