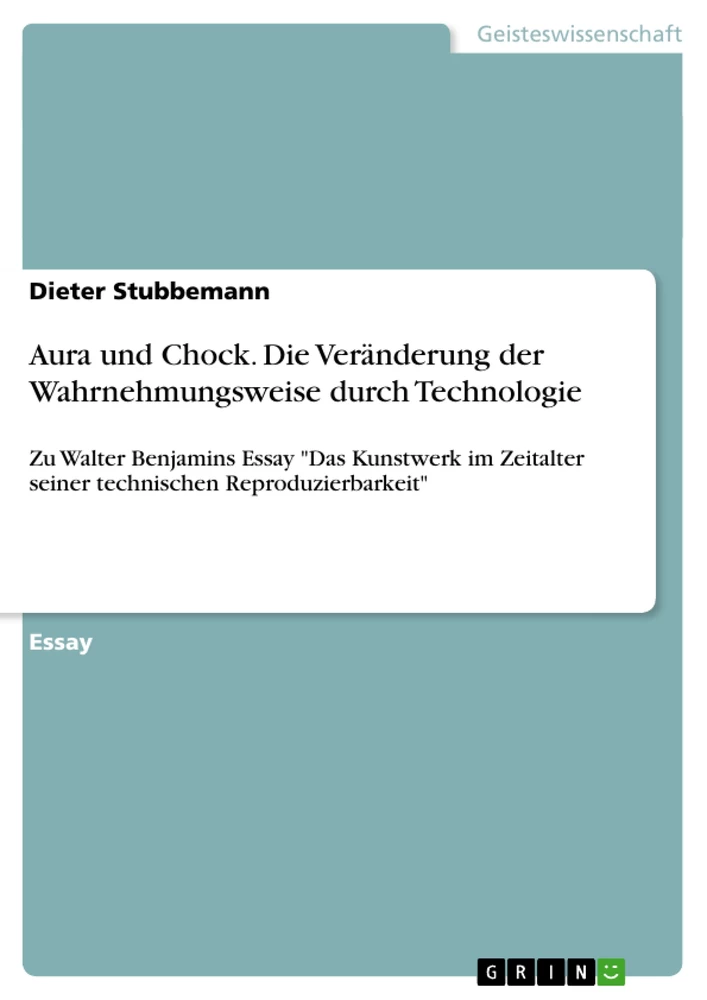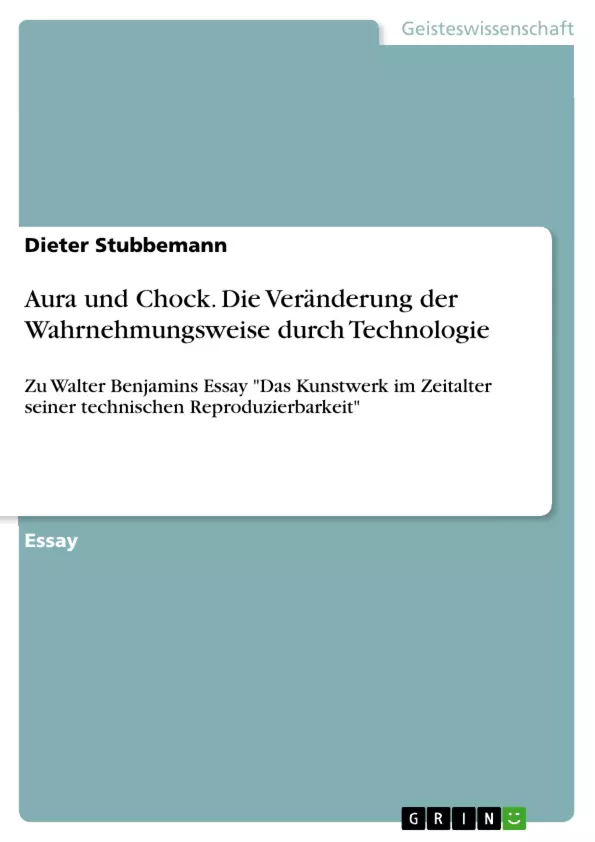Für Benjamin veränderte die Entwicklung der Technologie im Bereich der Kunst nicht nur deren Form, genauer die Formen, in denen sie sich entäußert, sondern auch die Wahrnehmung ihrer Rezipienten. Dabei forderte jedoch nicht nur die Kunst diese Veränderungen der Wahrnehmung zum Zwecke ihrer durch die Technologie veränderten Rezeptionsprämissen, sondern jene selbst waren ebenso ein Reflex auf veränderte Anforderungen an die menschliche Wahrnehmung, die ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Verhältnissen, also Produktionsverhältnissen hatten.
Inhaltsverzeichnis
- Aura und Chock
- Die Veränderung der Wahrnehmungsweise durch Technologie
- Aura
- Kultwert und Ausstellungswert
- Chock
- Die Zurichtung des Menschen auf die entfremdeten Bedingungen
- Der Film als kathartisches Element
- Die Masse als Daseinsform
- Die Technisierung und die Massenpsychosen
- Der Film als wissenschaftliches und gesellschaftliches Werkzeug
- Die technische Reproduktion und die Krise der Demokratien
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Walter Benjamins Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und untersucht die Veränderungen der Wahrnehmungsweise durch die Technologie, insbesondere im Bereich der Kunst. Der Fokus liegt auf den Begriffen Aura und Chock, die Benjamin als zentrale Elemente der Rezeption von Kunstwerken in der modernen Welt beschreibt.
- Die Veränderung der Wahrnehmungsweise durch die Technologie
- Der Verlust der Aura und die Entstehung des Chocks
- Die Rolle des Films in der modernen Gesellschaft
- Die Entfremdung des Menschen durch die Technik
- Die politische und gesellschaftliche Bedeutung der technischen Reproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse von Benjamins These, dass die Entwicklung der Technologie nicht nur die Form der Kunst verändert, sondern auch die Wahrnehmung ihrer Rezipienten. Benjamin argumentiert, dass die Aura, die einmalige Erscheinung eines Kunstwerks, durch die Reproduzierbarkeit durch Fotografie und Film zerstört wird. Die Aura ist für Benjamin eng mit der Echtheit und der Geschichte eines Kunstwerks verbunden, während der Chock, die neue Form der Rezeption, durch die Unwillkürlichkeit und die Zerstreuung der Wahrnehmung gekennzeichnet ist.
Der Text untersucht dann die Entstehung des Chocks als Reaktion auf die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und die technische Revolution. Benjamin argumentiert, dass der Film als Kunstform die Wahrnehmungsweise des Chocks widerspiegelt und die Menschen auf die Apparatur und die Maschinerie ausrichtet. Der Film bietet den Massen ein kathartisches Element, indem er die Entfremdung des Menschen durch die Technik scheinbar aufhebt und die Illusion von Identität und Persönlichkeit aufrechterhält.
Der Text analysiert schließlich die politische und gesellschaftliche Bedeutung der technischen Reproduktion. Benjamin argumentiert, dass die Massenproduktion von Reproduktionen die Masse als falsches Kollektiv hervorbringt und das Individuum zu einem bloßen Anhängsel der Masse degradiert. Die Technisierung führt zu psychischen Spannungen, die durch den Film als Mittel der psychischen Impfung und Katharsis verarbeitet werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Aura, Chock, technische Reproduzierbarkeit, Kunstwerk, Film, Fotografie, Entfremdung, Masse, Gesellschaft, Politik, Kapitalismus, Faschismus, Walter Benjamin, Wahrnehmungsweise, Rezeption, Kultur, Technologie, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Walter Benjamin unter der „Aura“ eines Kunstwerks?
Die Aura ist das „einmalige Erscheinen einer Ferne“ und die Echtheit eines Kunstwerks, die an seinen Ort und seine Geschichte gebunden ist. Durch technische Reproduktion (Fotografie, Film) geht diese Einmaligkeit verloren.
Was bedeutet der Begriff „Chock“ (Schock) bei Benjamin?
Der Chock beschreibt die moderne Form der Wahrnehmung, insbesondere im Film. Durch schnelle Schnitte und wechselnde Perspektiven wird der Betrachter ständig in seiner Kontemplation gestört und muss sich blitzschnell anpassen.
Wie verändert Technologie unsere Wahrnehmung?
Laut Benjamin ist die Veränderung der Wahrnehmung ein Reflex auf die modernen Produktionsverhältnisse. Die Technik richtet den Menschen auf die Apparatur aus und ersetzt beschauliches Betrachten durch zerstreute Rezeption.
Welche Rolle spielt der Film für die Massen?
Der Film dient als kathartisches Element und „psychische Impfung“. Er hilft den Massen, die Entfremdung der technisierten Welt zu verarbeiten, birgt aber auch die Gefahr der politischen Instrumentalisierung.
Was ist der Unterschied zwischen Kultwert und Ausstellungswert?
Früher hatten Kunstwerke einen Kultwert (religiöse/rituelle Bedeutung). Mit der Reproduzierbarkeit verschiebt sich der Fokus auf den Ausstellungswert – das Werk ist überall verfügbar und dient der öffentlichen Betrachtung und Politik.
- Arbeit zitieren
- Dieter Stubbemann (Autor:in), 2005, Aura und Chock. Die Veränderung der Wahrnehmungsweise durch Technologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277860