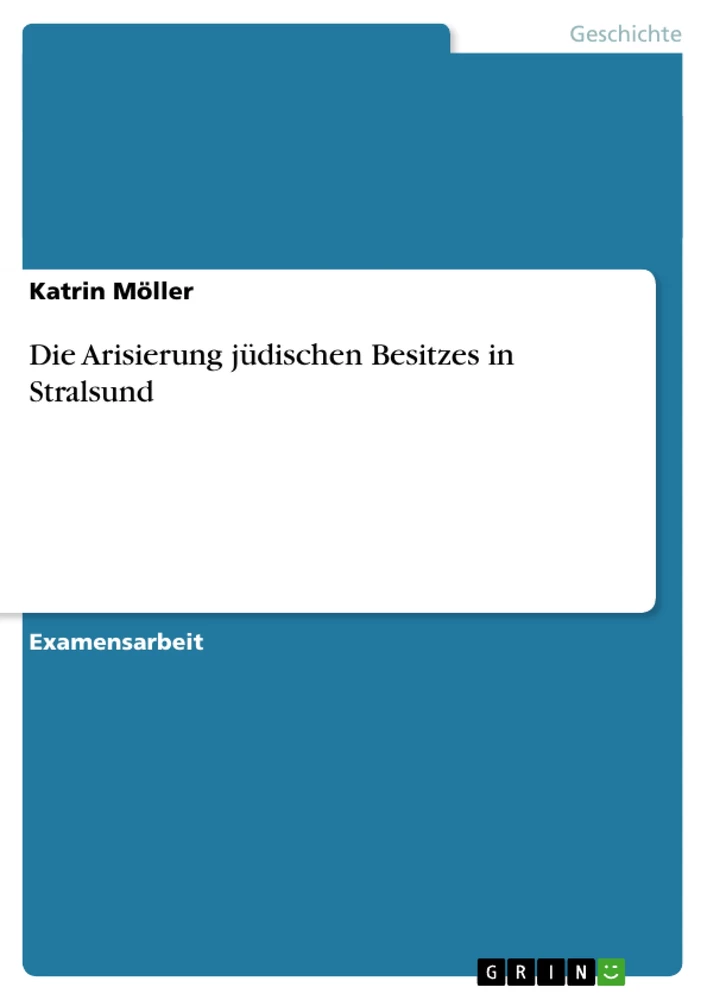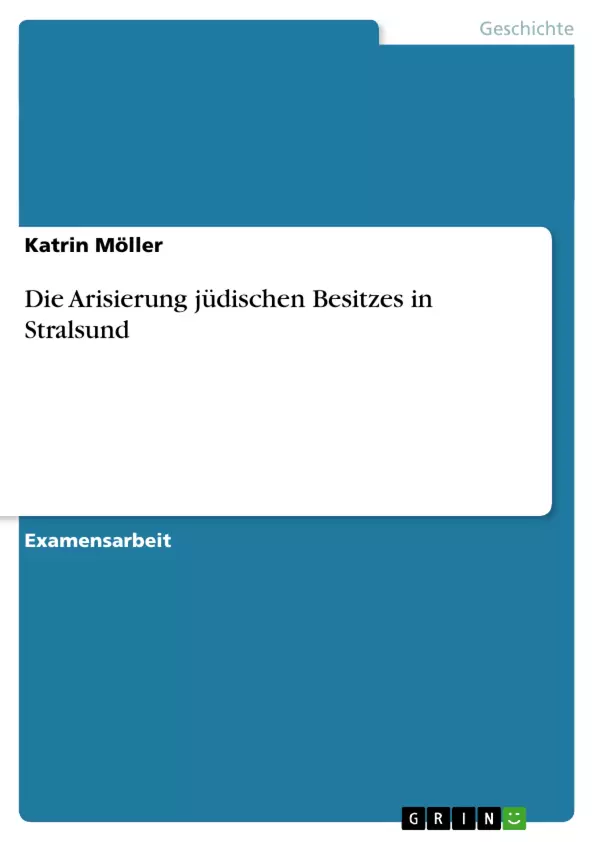Einleitung
Durch die Wiedervereinigung wurde im Einigungsvertrag das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen als partielles Bundesrecht übernommen. Bei dem Vermögensgesetz handelt es sich um ein Gesetz, das noch zu DDR-Zeiten erlassen worden und am 29.09.1990 in Kraft getreten ist. Vorläufer dieses Gesetzes war die gemeinsame Erklärung der beiden Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 15.06.1990. Darin wurden Eckdaten für die zukünftige Regelung der offenen Vermögensfragen festgeschrieben. Im § 1 Absatz 6 des Vermögensgesetzes wurde bestimmt, dass die Regelung des Vermögensgesetzes entsprechend Anwendung auf vermögensrechtliche Ansprüche von Bürgern und Vereinigungen finden wird, die in der Zeit vom 30.01.1933 bis zum 8.05.1945 aus rassischen, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen in Folge von Zwangskäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben. Hintergrund dieser Regelung war, dass anders als in den drei westlichen Besatzungszonen in der sowjetischen Besatzungszone keine Rückerstattung arisierten Vermögens durchgeführt worden ist. Die drei westlichen Militärregierungen hatten in ihren drei Zonen Rückerstattungsgesetze und in den drei westlichen Zonen Berlins eine Rückerstattungsan-ordnung erlassen, wonach grundsätzlich arisiertes Vermögen an die Erben und im Falle der Nichterben an jüdische Organisationen zurückzuerstatten war. Die Anwendung des § 1 Absatz 6 führte zunächst zu Schwierigkeiten, da die Verfolgungsbedingtheit und ihr Nachweis nicht geregelt waren. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1992 durch das 2. Vermögensrechtsänderungsgesetz im § 1 Absatz 6 ein Satz 2 eingefügt mit folgendem Wortlaut: Zu Gunsten des Berechtigten wird ein verfolgungsbedingter Vermögensverlust nach Maßgabe des zweiten Abschnitts der Anordnung BK/O(49)180 der Alliierten Kommandantur Berlin vom 26.07.1949 vermutet. Durch diese Vermutungsregelung sollte die Beweislastschwierigkeit, welche die Deportierten und Überlebenden grundsätzlich durch Unterlagen nachzuweisen hatten, beseitigt werden. Das bedeutet im Grundsätzlichen, dass Verkäufe von Juden grundsätzlich als verfolgungsbedingt angesehen wurden und der Ariseur diesen Beweis der Vermutung der Verfolgungsbedingtheit nur dadurch wiederlegen konnte, dass er nachwies, dass ein angemessener Kaufpreis gezahlt worden ist, [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff
- Zum Forschungsstand
- Die Quellenlage
- Antisemitismus vor 1933?
- Stralsunder Juden im Dritten Reich
- Hauptteil
- Chronologie der Arisierung in Stralsund
- April-Boykott 1933
- Die ersten Arisierungen: Die Stralsunder Warenhäuser
- Das Jahr 1935 und die Nürnberger Gesetze
- Das Jahr 1938
- Auswirkungen der Boykottmaßnahmen
- Die Ausschaltung der Stralsunder Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit
- Aufgabe jüdischer Geschäfte
- Die Reichspogromnacht und das Ende des jüdischen Geschäftslebens
- Arisierung der jüdischen Geschäfte in Stralsund
- Die Abwickler
- Veräußerung der jüdischen Warenlager
- Städtisches Interesse an jüdisch versippten Geschäften
- Arisierung der jüdischen Grundstücke in Stralsund
- Wohnungseinrichtungen der Grundstücke
- Zahlung der Grundstücke
- Gewährung von Wohnrecht
- Städtisches Interesse an jüdisch versippten Grundstücken
- Staatliche Einziehung des verbliebenen jüdischen Grundbesitzes nach den Deportationen
- Unterschiede von Geschäfts- und Grundstücks-Arisierungen
- Arisierungsbeispiele
- Beispiel: Familie Cohn Knaben- und Herrenbekleidungsgeschäft Ossenreyerstraße 21/22
- Beispiel: Fischkonservenfabrik S. Cassel Großer Diebsteig 2 und Kleiner Diebsteig 8b
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Arisierung jüdischen Besitzes in Stralsund während der NS-Zeit. Sie beleuchtet die Prozesse der Entrechtung und Enteignung jüdischer Bürger in Stralsund und analysiert die Auswirkungen der Arisierung auf das jüdische Leben in der Stadt.
- Chronologie der Arisierung in Stralsund
- Unterschiede von Geschäfts- und Grundstücksarisierung
- Städtisches Interesse an jüdischem Besitz
- Auswirkungen der Arisierung auf das jüdische Leben in Stralsund
- Arisierungsbeispiele als Fallstudien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arisierung ein und stellt den Forschungsstand und die Quellenlage dar. Der Hauptteil beleuchtet die Chronologie der Arisierung in Stralsund, wobei der Fokus auf den April-Boykott 1933, die ersten Arisierungen, die Nürnberger Gesetze und die Auswirkungen der Boykottmaßnahmen liegt. Zudem wird die Ausschaltung von Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit, die Aufgabe jüdischer Geschäfte, die Reichspogromnacht und die Arisierung von Geschäfts- und Grundstücken behandelt. Verschiedene Beispiele veranschaulichen die Praxis der Arisierung.
Schlüsselwörter
Arisierung, Stralsund, Juden, Antisemitismus, Entrechtung, Enteignung, Geschäftsarisierung, Grundstücksarisierung, Reichspogromnacht, Deportation, Stadt Stralsund, Nürnberger Gesetze, April-Boykott 1933.
- Quote paper
- Katrin Möller (Author), 2003, Die Arisierung jüdischen Besitzes in Stralsund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27809