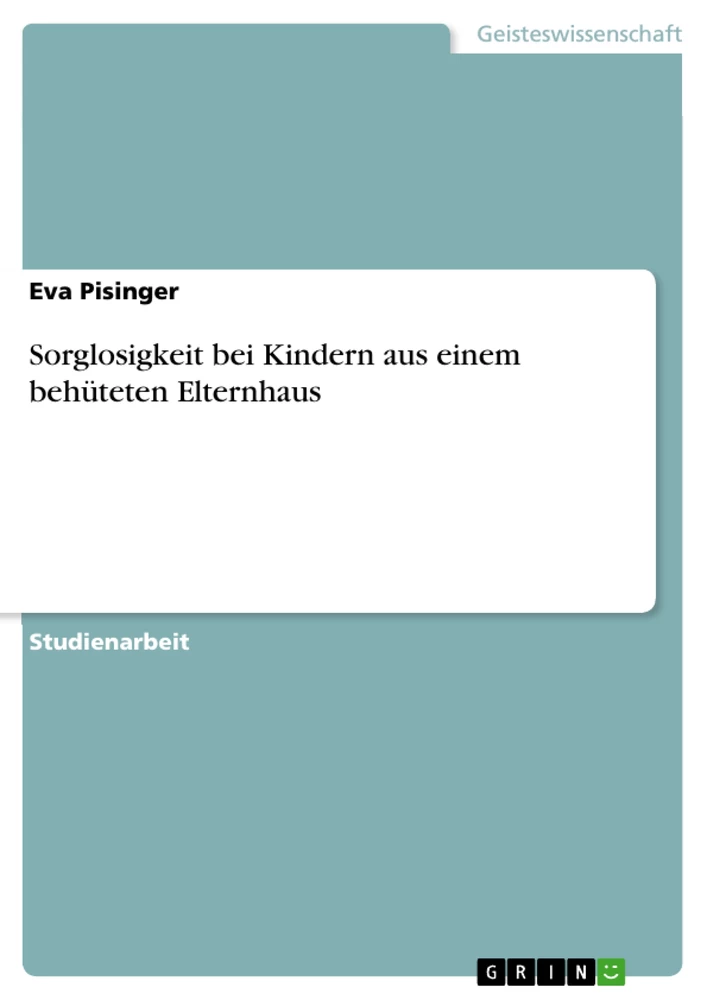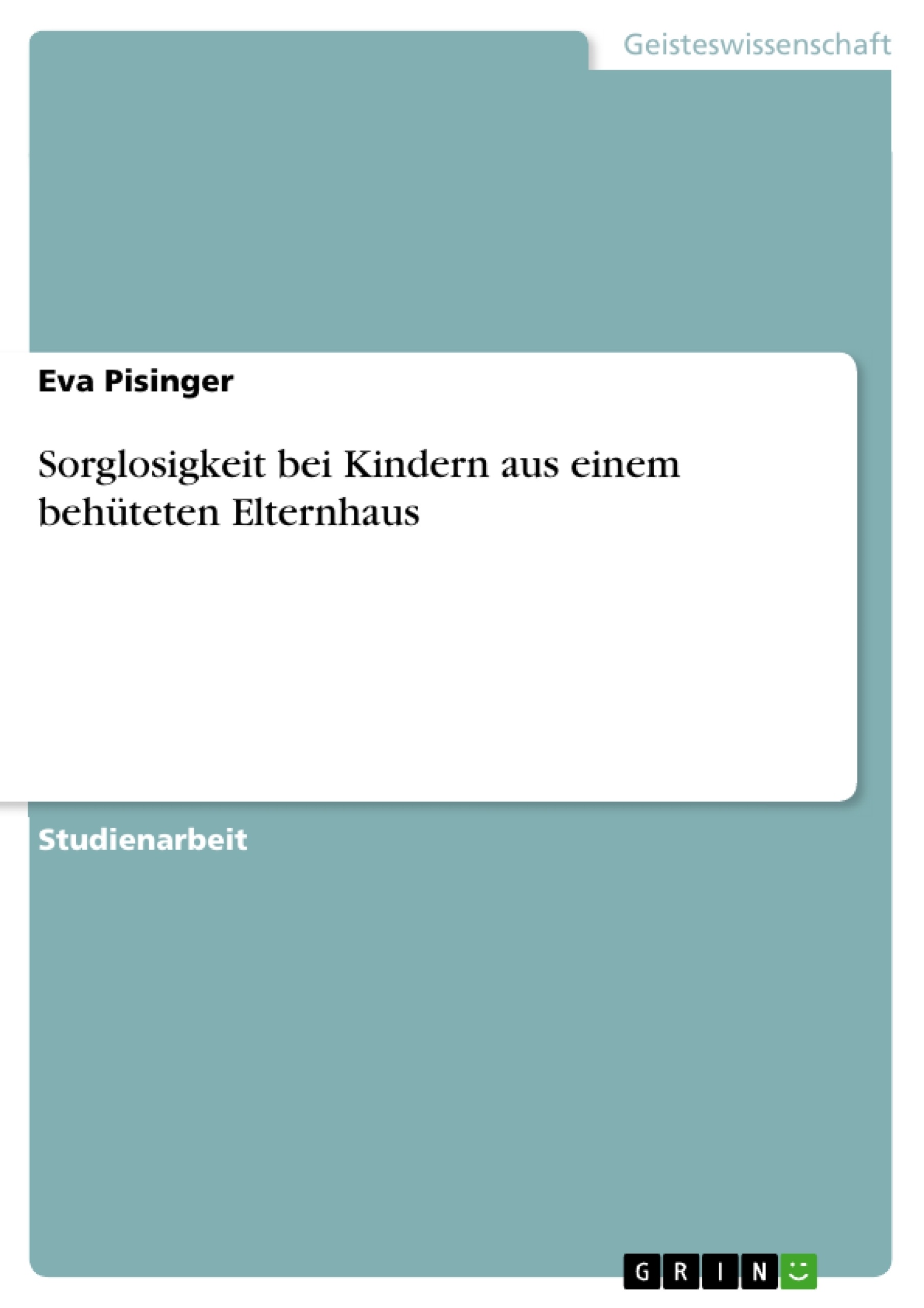Einleitung
Kinder, die in einem behüteten Elternhaus aufwachsen, sind es gewohnt, dass für alle Probleme materieller und sozialer Natur die Eltern aufkommen.
Durch den Rückhalt der Eltern machen sie immer wieder positive Erfahrungen von Sorglosigkeit: bei Krisen ist immer jemand da, der Probleme und Hindernisse aus dem Weg räumt. Kinder, die diese Erfahrung gemacht haben, werden nur zögernd lernen, dass sie selbst für ihr Leben verantwortlich sind und sich positive Zustände "verdienen" müssen. Gerade bei Kindern, die von Beruf "Tochter" oder "Sohn" überversorgender Eltern sind, tauchen solche Phänomene verstärkt auf.
Welche direkten und indirekten Zusammenhänge zwischen einem behütetem Elternhaus und einem späteren Verhalten im Sinne der Theorie der gelernten Sorglosigkeit zu erkennen sind, soll folgende Abhandlung zeigen. Ein Problem bei dieser Arbeit war, dass in der Literatur keine Untersuchungen über direkte Zusammenhänge dieser beiden Faktoren zu finden waren. Es ließen sich jedoch zahlreiche Hinweise darauf finden, die einen solchen Zusammenhang vermuten lassen. Diese sollen im Folgenden näher erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufzeigen der Hinweise auf Zusammenhänge zwischen einem behütetem Elternhaus und einem späteren sorglosen Verhalten der Kinder
- Definition von „behütetem Elternhaus“
- Erläuterung der Entstehung des angenommenen Zusammenhanges
- Bestrafung als Einflussfaktor
- Angst vor Strafe hemmt sorgloses Verhalten
- Fehlendes Setzen von Grenzen begünstigt sorgloses Verhalten
- Erlernen von Strategien zur Problemlösung
- Erziehung zu selbständigem und verantwortungsbewusstem Handeln
- Sorge als prima lex educationis
- Erziehung und Geld
- Erziehung und Kriminalität
- Schlussgedanke und Forschungsideen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung zielt darauf ab, die Zusammenhänge zwischen einem behütetem Elternhaus und einem späteren sorglosen Verhalten von Kindern im Sinne der Theorie der gelernten Sorglosigkeit aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die Entstehung dieser Zusammenhänge, indem sie verschiedene Faktoren wie Bestrafung, Problemlösungsverhalten und Erziehungsstile beleuchtet.
- Definition von „behütetem Elternhaus“ und seine verschiedenen Ausprägungen
- Einfluss der Bestrafung auf das sorglose Verhalten von Kindern
- Bedeutung von Problemlösungsstrategien und selbstständigem Handeln
- Rolle der Erziehung im Kontext von Sorglosigkeit
- Unterschiedliche Erziehungsstile und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sorglosigkeit bei Kindern aus einem behütetem Elternhaus ein und stellt die Problematik dar, dass in der Literatur keine Untersuchungen über direkte Zusammenhänge dieser beiden Faktoren zu finden sind. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und betont die Wichtigkeit der Analyse von indirekten Hinweisen, die einen Zusammenhang zwischen einem behütetem Elternhaus und einem späteren sorglosen Verhalten von Kindern vermuten lassen.
Das Kapitel „Aufzeigen der Hinweise auf Zusammenhänge zwischen einem behütetem Elternhaus und einem späteren sorglosen Verhalten der Kinder“ befasst sich mit der Definition von „behütetem Elternhaus“ und analysiert verschiedene Aspekte der Erziehung, die einen Einfluss auf das Verhalten von Kindern haben können. Hierzu werden Themen wie Bestrafung, Problemlösungsverhalten, Erziehung zu selbständigem Handeln und die Rolle der Eltern als Vorbild behandelt.
Schlüsselwörter
Sorglosigkeit, behütetes Elternhaus, Theorie der gelernten Sorglosigkeit, Erziehung, Bestrafung, Problemlösung, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, antiautoritäre Erziehung, Frustration, Erziehungsstile, Kinderverhalten.
- Quote paper
- Eva Pisinger (Author), 2001, Sorglosigkeit bei Kindern aus einem behüteten Elternhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2781