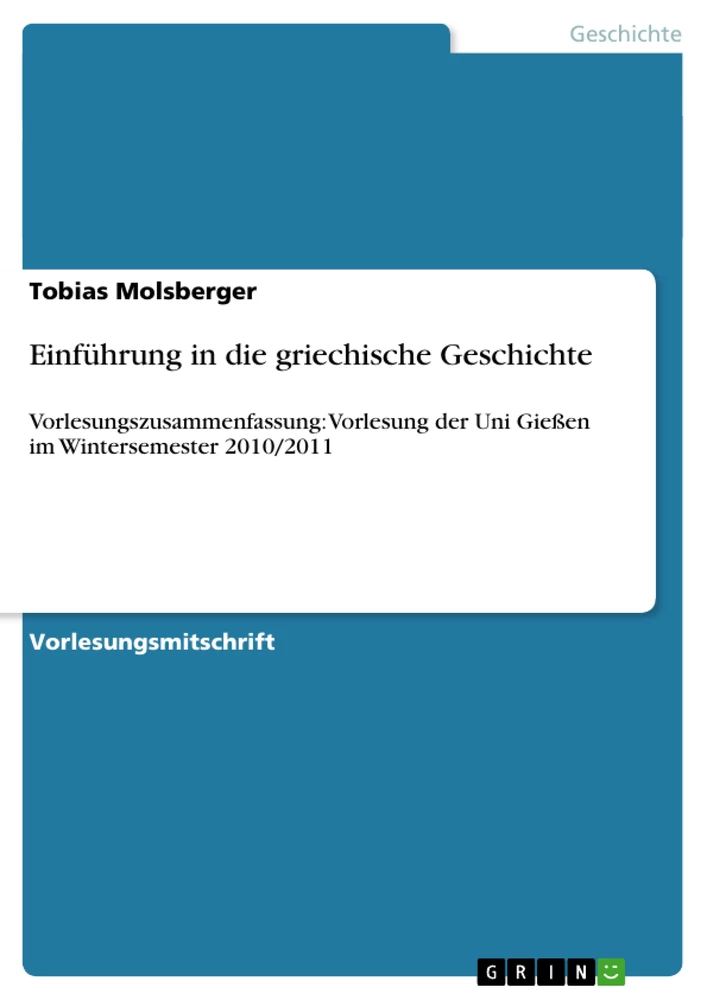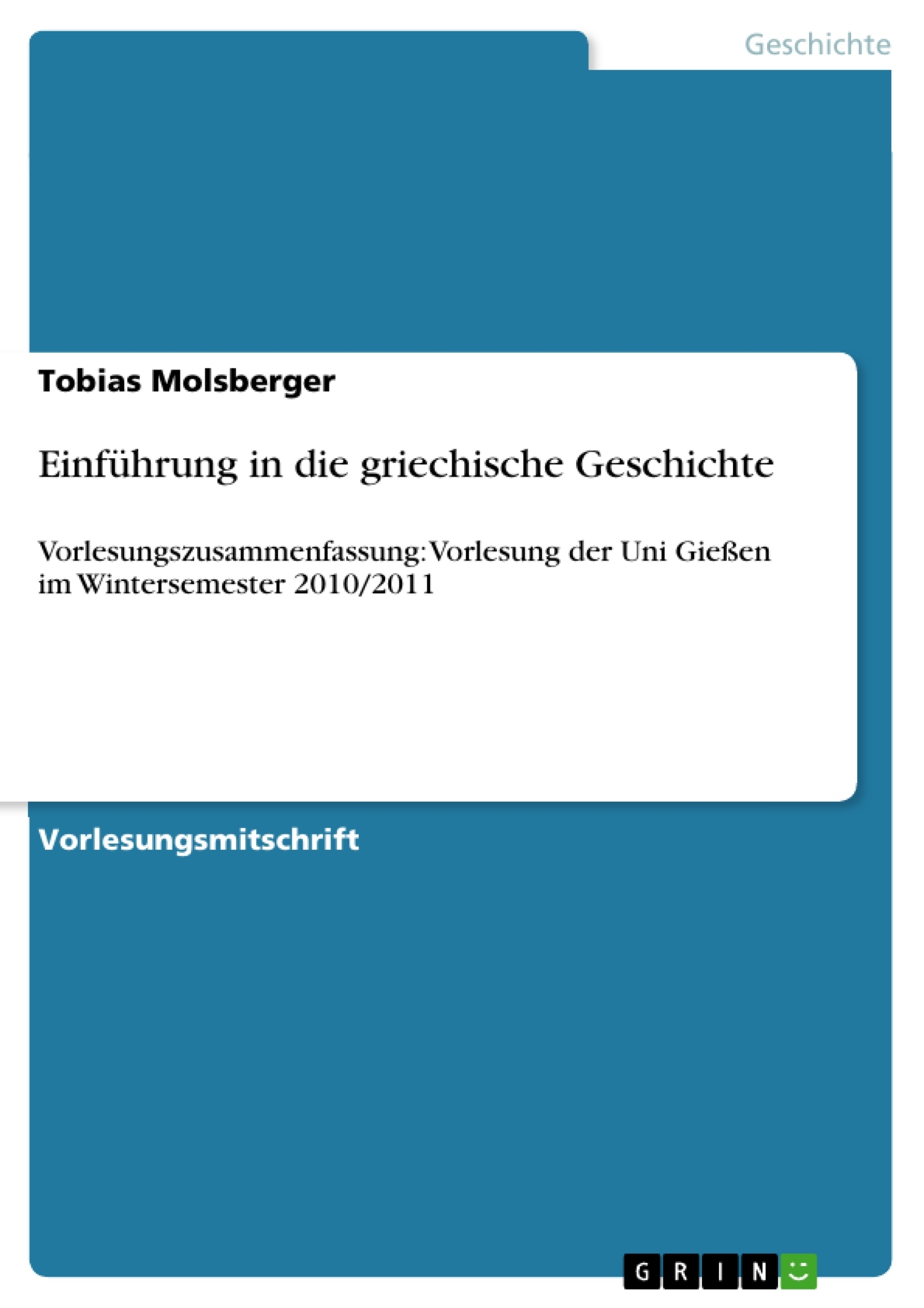VL 1: Die Gegenstände: Raum und Zeit
• in allen nachantiken Gesellschaften Rückgriffe auf Antike:
siehe Renaissance durch Wiederbelebung antiker Ideale
• griech. Antike als normsetzende Instanz
Vermehrung des Wissens/Vervielfältigung antiker Texte durch Buchdruck
• jedoch bis heute: griech. Antike omnipotent (Aristokratie, Demokratie…)
• „Griechen lebten in freiem Gemeinwesen“
• Ab 4. Jh. freie Poleis verlieren an Einfluss - Untergang altgriech. Kunst
• Ab 1850 erste Lehrstühle für Alte Geschichte; Geschichtslehrerausbildung
Inhaltsverzeichnis
- Die Gegenstände: Raum und Zeit
- Quellen und Materialien
- Quellen und Materialien (2)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesung „Einführung in die griechische Geschichte“ zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die griechische Antike zu vermitteln. Sie behandelt die wichtigsten Ereignisse, Personen und Entwicklungen der griechischen Geschichte von ihren Anfängen bis zum Untergang des römischen Reiches. Die Vorlesung beleuchtet die griechische Kultur, Politik, Gesellschaft und Religion und analysiert die Quellen und Materialien, die uns über diese Epoche informieren.
- Die Entwicklung der Polis als Staatsform
- Die Bedeutung der Quellen und Materialien für die Geschichtsforschung
- Die Rolle der Literatur und der Inschriften in der antiken Gesellschaft
- Die Bedeutung der Archäologie für das Verständnis der griechischen Geschichte
- Die Herausforderungen der Interpretation antiker Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Vorlesung befasst sich mit den grundlegenden Begriffen Raum und Zeit in der griechischen Geschichte. Es werden die geographischen und chronologischen Rahmenbedingungen der griechischen Antike definiert und die Bedeutung der Polis als prägende Staatsform erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich den Quellen und Materialien, die uns über die griechische Geschichte informieren. Es werden die verschiedenen Arten von Quellen, wie literarische Zeugnisse, Inschriften und archäologische Funde, vorgestellt und ihre Bedeutung für die Geschichtsforschung diskutiert. Das dritte Kapitel setzt sich mit den Quellen und Materialien auseinander, die uns über die griechische Geschichte informieren. Es werden die verschiedenen Arten von Quellen, wie literarische Zeugnisse, Inschriften und archäologische Funde, vorgestellt und ihre Bedeutung für die Geschichtsforschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die griechische Antike, die Polis, die Quellen und Materialien der Geschichtsforschung, die literarischen Zeugnisse, die Inschriften, die Archäologie, die Papyrologie, die Historiographie, die griechische Kultur, die griechische Politik, die griechische Gesellschaft und die griechische Religion.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die griechische Antike bis heute wichtig?
Sie gilt als normsetzende Instanz für Demokratie, Philosophie, Kunst und Wissenschaft in der westlichen Welt.
Was war die „Polis“?
Die Polis war der antike griechische Stadtstaat, ein freies Gemeinwesen, das die politische und soziale Identität der Griechen prägte.
Welche Quellen nutzt die Geschichtsforschung für die Antike?
Man unterscheidet zwischen literarischen Zeugnissen (Historiographie), Inschriften (Epigraphik), archäologischen Funden und Papyri.
Wann entstanden die ersten Lehrstühle für Alte Geschichte?
Die akademische Etablierung des Fachs Alte Geschichte und die systematische Lehrerausbildung begannen um das Jahr 1850.
Was markiert das Ende der altgriechischen Kunst und Freiheit?
Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. verloren die freien Poleis zunehmend an Einfluss, was oft mit dem Aufstieg Makedoniens und später Roms in Verbindung gebracht wird.
- Citar trabajo
- Tobias Molsberger (Autor), 2011, Einführung in die griechische Geschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278106