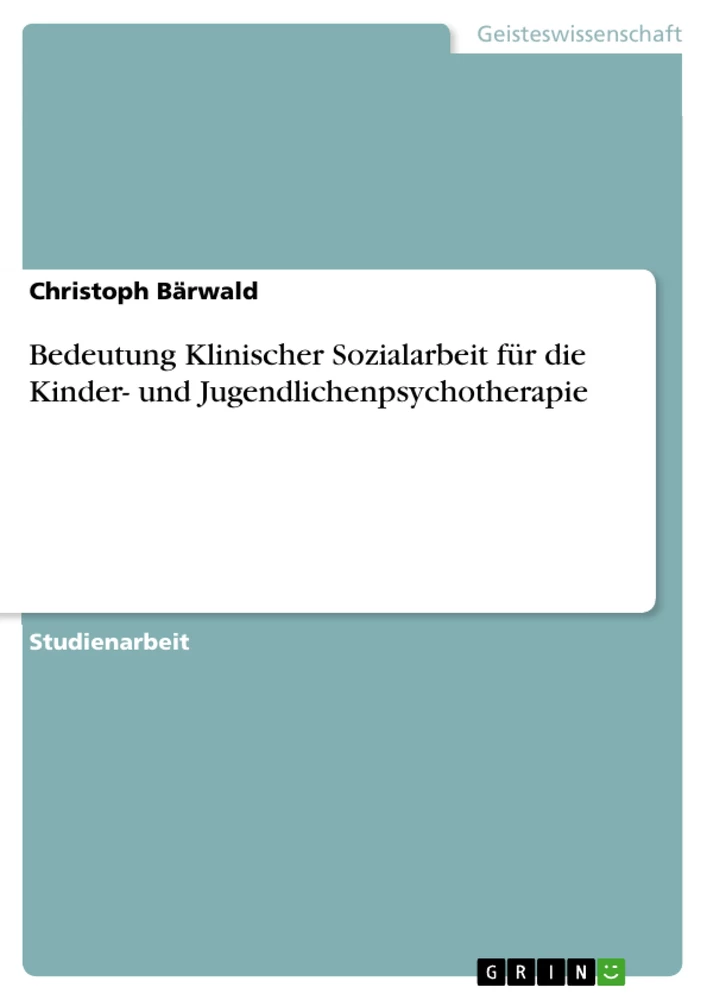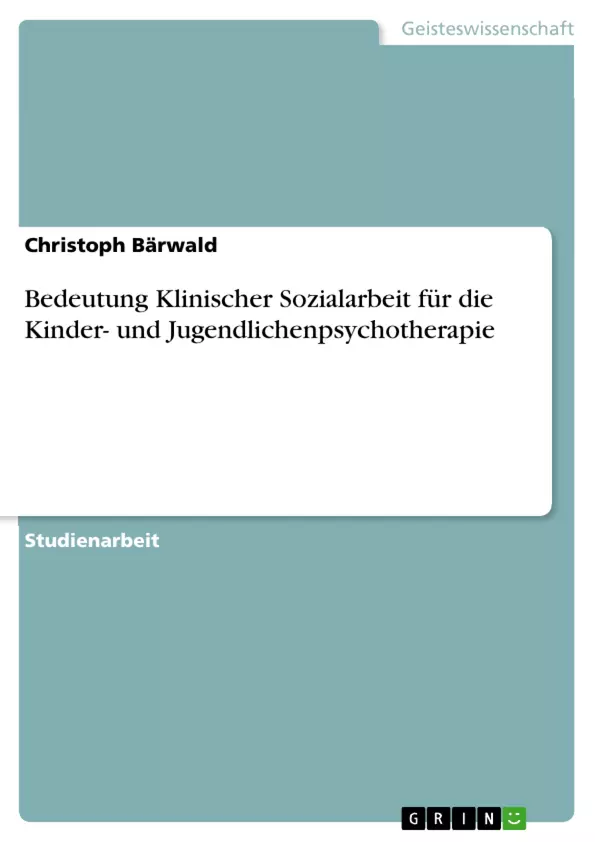In der heutigen Zeit wird der Rolle der Gesundheit eine immer größere Bedeutung beigemessen. Gesundheit ist das wohl wichtigste menschliche Gut und sie bildet die Grundlage für ein langes und glückliches Leben. Psychische Befindlichkeiten erhalten eine zunehmende Bedeutung und Anerkennung. Mittlerweile kann das komplexe menschliche Leben von einer Vielzahl psycho-sozialer Problemlagen und belastender Lebensereignisse geprägt sein, welche das System der Familie vollends umspannen, dauerhaft belasten und überfordern können.
Der heutige Mensch sieht sich mit steigenden Sorgen, Nöten und Unsicherheiten konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Beispielsweise prekäre Jobsituationen, chronischer Stress, Armut und Arbeitslosigkeit oder familiäre Probleme wie chronische Disharmonie, häusliche Gewalt, Scheidungen, Krankheiten und Todesfälle. Vor solchen oft unvorhersehbaren sozialen Veränderungen und Ereignissen, mit zum Teil traumatischem Gehalt, sind Kinder und Jugendliche, eingebettet in ihre familiären Strukturen, nicht immer gefeit. Besonders Kinder nehmen Nuancen familiärer Veränderung sensibel wahr und reagieren auf Belastungen gehäuft emotional mit Verhaltensauffälligkeiten und anderen psychischen Störungsbildern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Charakteristika „Klinischer Sozialarbeit“
- 3. Wissenschaftstheoretische Modelle und Konzepte der Klinischen Sozialarbeit
- 3.1 Das bio-psycho-soziale Modell
- 3.2 Das Modell der Salutogenese
- 3.3 Das Konzept der Sozialen Unterstützung
- 3.4 Das Konzept des Person-in-Environment - Person-in-Situation
- 4. Psycho-soziale Behandlung als spezifisches Instrument klinisch-sozialarbeiterischen Handelns
- 4.1 Psycho-soziale Diagnostik
- 4.1.1 Exkurs USA: Das Person-In-Environment System (PIE)
- 4.1.2 Bio-psycho-soziale Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe
- 4.2 Psycho-soziale Beratung
- 4.3 Klinisches Case Management
- 4.4 Soziale Therapie
- 4.1 Psycho-soziale Diagnostik
- 5. Bedarf an Klinischer Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe
- 6. Spannungsfeld zwischen Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
- 7. Fazit: Bedeutung Klinischer Sozialarbeit für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Klinischen Sozialarbeit im Kontext der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Ziel ist es, die Rolle und die Arbeitsweise der Klinischen Sozialarbeit zu beleuchten und ihren Beitrag zur Versorgung psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher zu erörtern. Der Fokus liegt dabei auf den spezifischen Instrumenten und Methoden der psycho-sozialen Behandlung und dem Bedarf an klinisch ausgebildeten Sozialarbeitern im deutschen Gesundheitssystem.
- Definition und Charakteristika der Klinischen Sozialarbeit
- Wissenschaftstheoretische Modelle und Konzepte der Klinischen Sozialarbeit (bio-psycho-soziales Modell, Salutogenese, Soziale Unterstützung)
- Psycho-soziale Behandlungsinstrumente (Diagnostik, Beratung, Case Management, Soziale Therapie)
- Bedarf an Klinischer Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe
- Zusammenspiel von Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht die steigende Bedeutung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sie beleuchtet die unzureichende Versorgung und lange Wartezeiten auf Behandlungsplätze und verweist auf Studien wie KiGGS und BELLA, die einen hohen Anteil psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aufzeigen und den Zusammenhang mit ungünstigen familiären und sozioökonomischen Faktoren herausstellen. Der Mangel an Versorgung wird als Ausgangspunkt für die Notwendigkeit einer unterstützenden Klinischen Sozialarbeit dargestellt.
2. Definition und Charakteristika „Klinischer Sozialarbeit“: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine weiteren Informationen enthält)
3. Wissenschaftstheoretische Modelle und Konzepte der Klinischen Sozialarbeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene wissenschaftliche Modelle und Konzepte, die die Grundlage der Klinischen Sozialarbeit bilden. Es werden das bio-psycho-soziale Modell, das Modell der Salutogenese, das Konzept der Sozialen Unterstützung und das Person-in-Environment-Modell erläutert. Diese Modelle liefern ein umfassendes Verständnis des Menschen in seinem sozialen Kontext und betonen die Interaktion zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Problemen. Das Kapitel liefert somit die theoretische Basis für das Verständnis klinisch-sozialarbeiterischen Handelns.
4. Psycho-soziale Behandlung als spezifisches Instrument klinisch-sozialarbeiterischen Handelns: Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Instrumente der psycho-sozialen Behandlung. Es werden psycho-soziale Diagnostik (einschließlich des Person-In-Environment Systems und der bio-psycho-sozialen Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe), psycho-soziale Beratung, klinisches Case Management und soziale Therapie detailliert vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Methoden im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, um die Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder und Jugendliche aufzuzeigen.
5. Bedarf an Klinischer Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine weiteren Informationen enthält)
6. Spannungsfeld zwischen Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine weiteren Informationen enthält)
Schlüsselwörter
Klinische Sozialarbeit, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, psychische Auffälligkeiten, bio-psycho-soziales Modell, Salutogenese, Soziale Unterstützung, Person-in-Environment, psycho-soziale Behandlung, Diagnostik, Beratung, Case Management, Soziale Therapie, Kinder- und Jugendhilfe, Versorgung, Bedarf, Deutschland, KiGGS-Studie, BELLA-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Klinische Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Bedeutung der Klinischen Sozialarbeit im Kontext der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Deutschland. Es analysiert die Rolle, Arbeitsweise und den Beitrag der Klinischen Sozialarbeit zur Versorgung psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika der Klinischen Sozialarbeit, relevante wissenschaftstheoretische Modelle (bio-psycho-soziales Modell, Salutogenese, Soziale Unterstützung, Person-in-Environment), Instrumente der psycho-sozialen Behandlung (Diagnostik, Beratung, Case Management, Soziale Therapie), den Bedarf an Klinischer Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe sowie das Spannungsfeld zwischen Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Welche wissenschaftlichen Modelle werden erläutert?
Das Dokument erläutert das bio-psycho-soziale Modell, das Modell der Salutogenese, das Konzept der Sozialen Unterstützung und das Person-in-Environment-Modell. Diese Modelle dienen als theoretische Grundlage für das Verständnis klinisch-sozialarbeiterischen Handelns und betonen die Interaktion zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren.
Welche Instrumente der psycho-sozialen Behandlung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die psycho-soziale Diagnostik (inklusive Person-In-Environment System und bio-psycho-sozialer Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe), psycho-soziale Beratung, klinisches Case Management und soziale Therapie als zentrale Instrumente der psycho-sozialen Behandlung im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe.
Warum ist Klinische Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe wichtig?
Das Dokument hebt die steigende Bedeutung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und die unzureichende Versorgung in Deutschland hervor. Es argumentiert für die Notwendigkeit einer unterstützenden Klinischen Sozialarbeit aufgrund langer Wartezeiten auf Behandlungsplätze und dem hohen Anteil psychischer Auffälligkeiten, wie in Studien wie KiGGS und BELLA gezeigt wird.
Wie steht die Klinische Sozialarbeit zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie?
Das Dokument untersucht das Spannungsfeld zwischen Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Es beleuchtet den Beitrag der Klinischen Sozialarbeit zur Versorgung psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher und wie beide Bereiche zusammenarbeiten können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Klinische Sozialarbeit, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, psychische Auffälligkeiten, bio-psycho-soziales Modell, Salutogenese, Soziale Unterstützung, Person-in-Environment, psycho-soziale Behandlung, Diagnostik, Beratung, Case Management, Soziale Therapie, Kinder- und Jugendhilfe, Versorgung, Bedarf, Deutschland, KiGGS-Studie, BELLA-Studie.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Das Dokument enthält Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, die wissenschaftstheoretischen Modelle, die psycho-sozialen Behandlungsinstrumente. Die Zusammenfassungen zu den Kapiteln über die Definition der Klinischen Sozialarbeit, den Bedarf an Klinischer Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und das Spannungsfeld zwischen Klinischer Sozialarbeit und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie fehlen, da der zugrundeliegende Text keine weiteren Informationen dazu enthält.
- Arbeit zitieren
- Christoph Bärwald (Autor:in), 2014, Bedeutung Klinischer Sozialarbeit für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278168