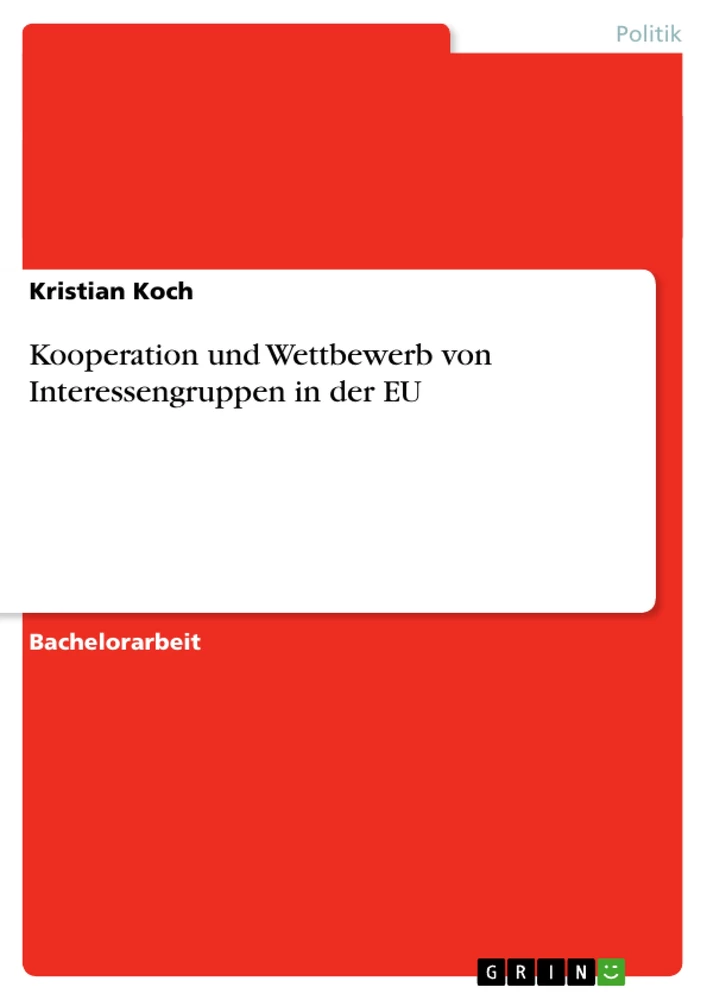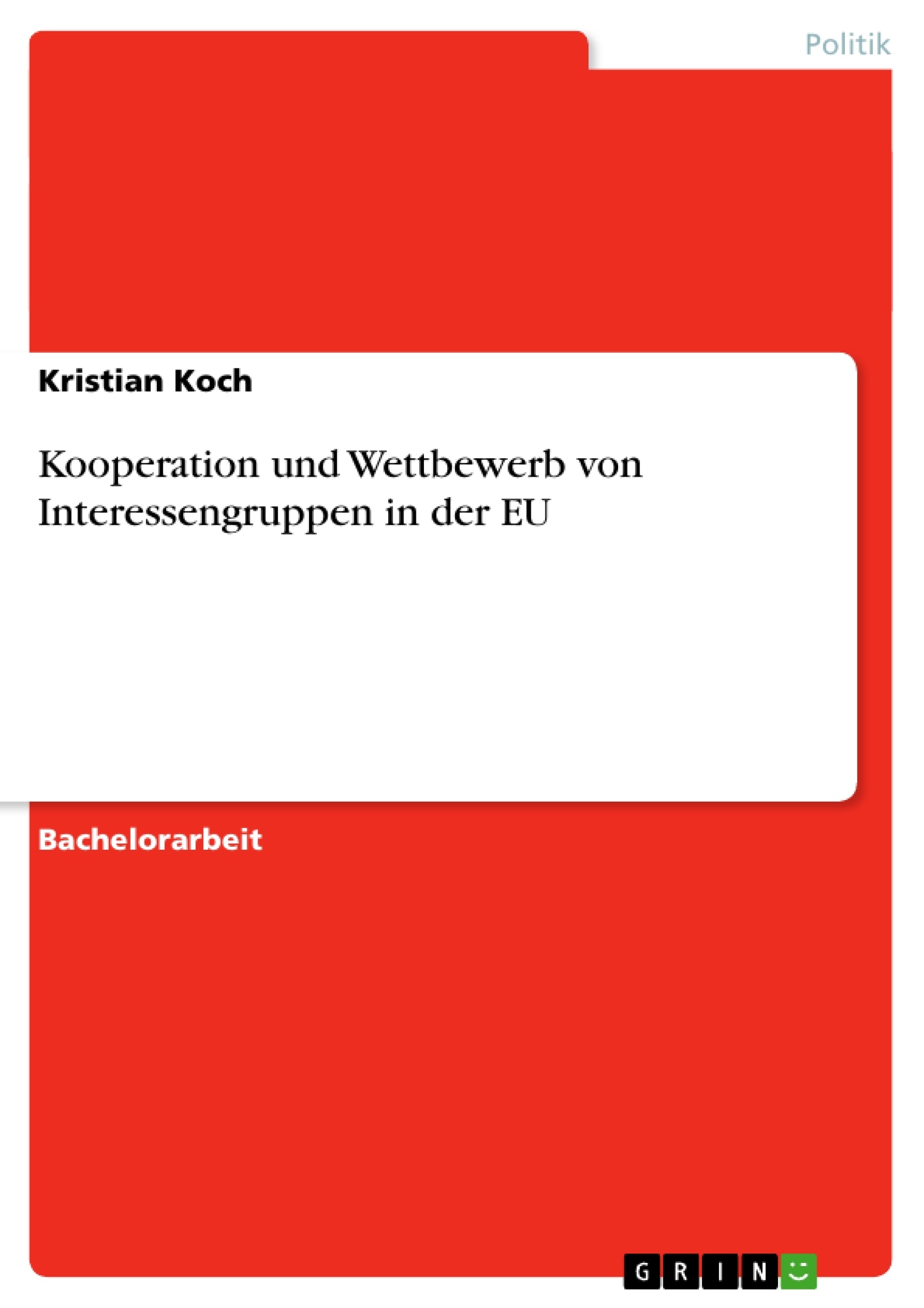Kaum ein internationales politisches Gebilde ist so empfänglich für die Einflussnahme
durch Interessengruppen wie die Europäischen Union (EU). Zahlreiche nationale und
europäische Verbände, Gebietskörperschaften, Einzelunternehmen und freie Lobbyisten
versuchen in Brüssel und Straßburg, Einfluss auf die europäische Politik zu nehmen. Im
gleichen Maße, wie die Kompetenzen der EU im Laufe der Jahre erweitert worden sind,
ist auch die Anzahl der Interessengruppen in den vergangenen Dekaden rapide angestiegen
und wird nach einhelliger Meinung auch weiterhin steigen. Die Interessengruppen agieren auf europäischer Ebene jedoch nicht in einem geordneten,
einheitlichen System. Interessen und Aktivitäten sind –wie obiges Zitat erkennen
lässt- sehr heterogen und oft einander entgegengesetzt. Die Aktivitäten und Interessen
großer, finanzstarker europäischer Chemie- und Pharmaverbände unterscheiden sich
beispielsweise in Struktur und Umfang von den Aktivitäten und Interessen europäischer
Konsumentenvereinigungen. Es sind jedoch auch Fälle vorstellbar, in denen bei gleichgerichteten
Interessen trotz heterogener Strukturen ein kooperatives Vorgehen verschiedener Interessengruppen für alle Beteiligten vorteilhaft sein kann.
Die Vermittlung von Interessen in der EU kann darüber hinaus nicht ohne weiteres mit
dem Einfluss von Interessengruppen auf Ebene der Nationalstaaten gleichgesetzt werden.
Insbesondere die Ausgestaltung der EU als Mehrebenensystem und die Vielzahl der
an Entscheidungen beteiligten Institutionen macht es für die Interessengruppen notwendig,
geeignete Strategien für ein erfolgreiches Lobbying auf europäischer Ebene zu
entwickeln. Der Interaktion von Interessengruppen mit politischen Institutionen und Organen
ist in der politikwissenschaftlichen Literatur in den letzten Jahren eine umfangreiche Palette an Veröffentlichungen gewidmet worden. Neben theoretischen Arbeiten der Public Choice-Literatur zur Modellierung der Rolle von Interessengruppen im
politischen Entscheidungsprozess (AUSTEN-SMITH, 1993; GROSSMAN/HELPMAN, 1996;
CROMBEZ, 2002) sind es im europäischen Kontext vor allem empirische Arbeiten, die
mithilfe von Experteninterviews und Fragebögen versuchen, ein klareres Bild von den
Aktivitäten und Zielen der Lobbyisten zu erhalten. Über die Analyse einzelner Politikfelder
und Entscheidungen auf europäischer Ebene werden hierbei politische Hypothesen
bezüglich des Einflusses von Interessengruppen untersucht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgehen
- Kollektives Handeln
- Grundlegende Merkmale einer Interessengruppe
- Entstehen von Interessengruppen
- Mittel der Beeinflussung
- Interaktion zwischen Interessengruppen
- Wettbewerb
- Kooperation
- Das Modell
- Einflussnahme in der Europäischen Union
- Definition des politischen Systems der EU
- Institutionen der EU
- Interessenvertretung in der EU
- Formale Darstellung des Lobbyingprozesses
- Ablauf des Lobbyingprozesses
- Annahmen über die Interessengruppen
- Kooperationsentscheidungen der Interessengruppen
- Einfluss der Institutionen auf die Kooperationsentscheidung
- Rat
- Kommission
- Europäisches Parlament
- Einfluss veränderter Rahmenbedingungen
- EU-Erweiterung
- Europäische Verfassung
- Fazit
- Kollektives Handeln und Entstehung von Interessengruppen
- Wettbewerb und Kooperation zwischen Interessengruppen
- Einflussnahme von Interessengruppen auf europäische Politik
- Die Rolle von EU-Institutionen im Lobbyingprozess
- Herausforderungen durch EU-Erweiterung und die Europäische Verfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Interaktion von Interessengruppen im politischen System der Europäischen Union. Sie zielt darauf ab, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Einflussnahme durch Interessengruppen in diesem komplexen Mehrebenensystem zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und zeigt die Bedeutung von Interessengruppen in der EU auf. Das zweite Kapitel beschreibt das Vorgehen und die Methodik der Arbeit. Im dritten Kapitel wird das Konzept des kollektiven Handelns erläutert, wobei die Merkmale von Interessengruppen und deren Entstehungsmechanismen im Fokus stehen.
Das vierte Kapitel analysiert die Interaktion zwischen Interessengruppen, insbesondere den Wettbewerb und die Kooperation. Im fünften Kapitel wird ein Modell zur Analyse der Einflussnahme von Interessengruppen in der EU vorgestellt. Dieses Modell umfasst die Definition des politischen Systems der EU, die Analyse der EU-Institutionen und die Beschreibung des Lobbyingprozesses.
Schlüsselwörter
Interessengruppen, Europäische Union, Lobbying, Wettbewerb, Kooperation, EU-Institutionen, politische Einflussnahme, Mehrebenensystem, kollektives Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es so viele Interessengruppen in der Europäischen Union?
Die EU ist als Mehrebenensystem sehr empfänglich für Einflussnahme. Mit der Erweiterung der EU-Kompetenzen stieg auch die Zahl der Verbände und Lobbyisten in Brüssel rapide an.
Wann kooperieren Interessengruppen miteinander?
Kooperation findet statt, wenn verschiedene Gruppen gleichgerichtete Interessen haben und ein gemeinsames Vorgehen für alle Beteiligten vorteilhafter ist als Wettbewerb.
Welche Rolle spielen die EU-Institutionen beim Lobbying?
Institutionen wie die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament sind die Zielobjekte der Einflussnahme und beeinflussen durch ihre Struktur die Kooperationsentscheidungen der Lobbyisten.
Was ist der Unterschied zwischen Lobbying in der EU und auf nationaler Ebene?
In der EU müssen Strategien an die Vielzahl der beteiligten Institutionen und die Komplexität des europäischen Entscheidungsprozesses angepasst werden.
Wie beeinflussen EU-Erweiterungen die Arbeit von Interessengruppen?
Erweiterungen verändern die Rahmenbedingungen und machen das System heterogener, was neue Strategien für die politische Einflussnahme erfordert.
- Arbeit zitieren
- Kristian Koch (Autor:in), 2004, Kooperation und Wettbewerb von Interessengruppen in der EU, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27821