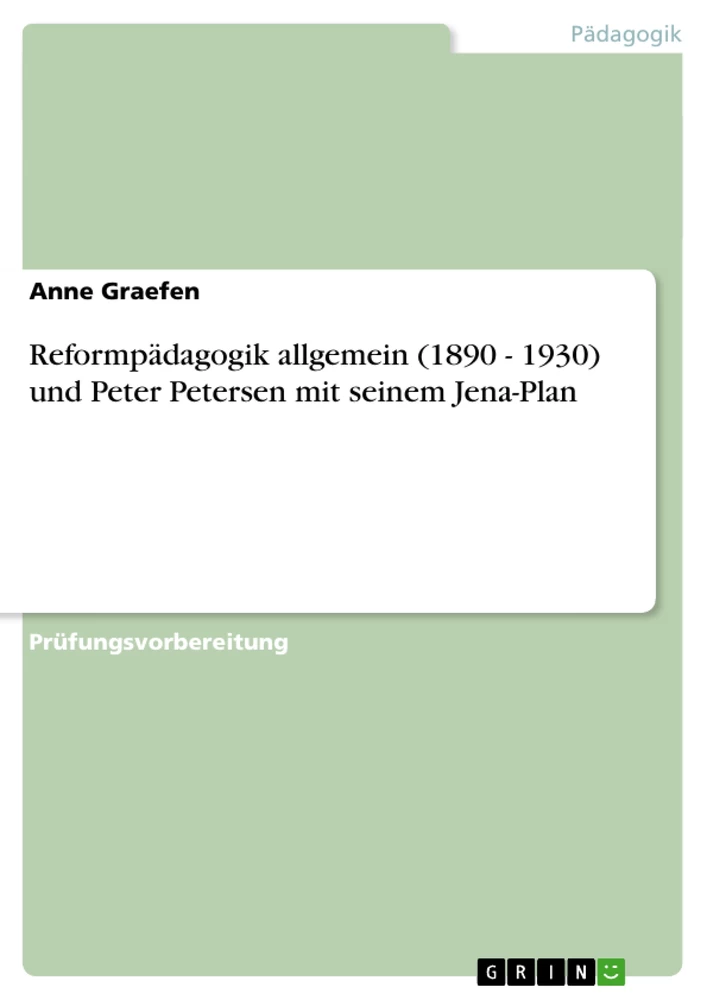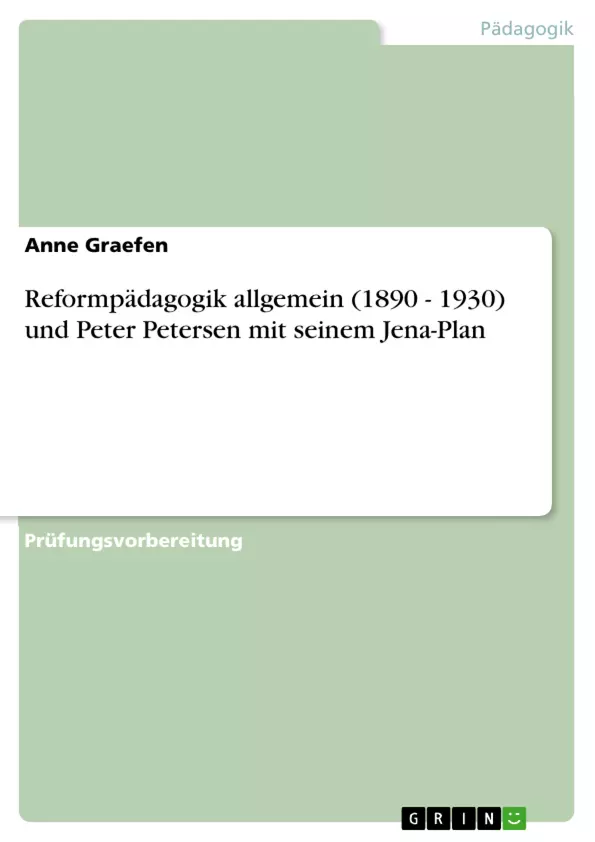Diese Lernzusammenfassung behandelt in Stichpunkten und kurzen Absätzen die Reformpädagogik zwischen 1890 bis 1930, sowie Peter Petersen und seinen Jena-Plan.
Inhaltsverzeichnis
- Begriff der Reformpädagogik
- Politische und gesellschaftliche Entwicklung
- Grundmotive / Merkmale der Reformpädagogischen Bewegung
- Neue schulische Formen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Reformpädagogik, eine Bewegung, die zwischen 1890 und 1933 ihren Höhepunkt erlebte, zielte auf eine grundlegende Umgestaltung des Bildungssystems. Sie kritisierte die starre, autoritäre und wissensorientierten Methoden der traditionellen Schule und strebte nach einer Pädagogik, die dem Kind und seinen Bedürfnissen gerecht wird.
- Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft und dem Bildungssystem
- Forderung nach einer neuen Pädagogik, die vom Kind ausgeht
- Betonung der Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit des Kindes
- Entwicklung neuer Unterrichtsformen und -methoden
- Einfluss auf die Entwicklung der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin
Zusammenfassung der Kapitel
Begriff der Reformpädagogik
Der Begriff "Reformpädagogik" bezeichnet eine historische Epoche, die durch eine Vielzahl von pädagogischen Ideen und Reformbewegungen geprägt war. Es gibt keine einheitliche Definition, sondern eher ein Syndrom von Hoffnungen, Ansprüchen, Erfahrungen und Konzepten. Die Reformpädagogik entstand als Reaktion auf die traditionellen Schulformen und die gesellschaftlichen Veränderungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Politische und gesellschaftliche Entwicklung
Die Reformpädagogik entstand in einem Kontext von gesellschaftlichen Umbrüchen. Die Industrialisierung, die Ausweitung des Bildungswesens und die politische Entwicklung in Deutschland (von der wilhelminischen Epoche zur Weimarer Republik) führten zu neuen Anforderungen an die Bildung. Die Ideen der Französischen Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) fanden zunehmend Eingang in die pädagogische Diskussion.
Grundmotive / Merkmale der Reformpädagogischen Bewegung
Die Reformpädagogik war durch eine Reihe von Grundmotiven und Merkmalen geprägt. Dazu gehören die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft und dem Bildungssystem, die Forderung nach einer neuen Pädagogik, die vom Kind ausgeht, die Betonung der Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit des Kindes, die Entwicklung neuer Unterrichtsformen und -methoden sowie der Einfluss auf die Entwicklung der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Reformpädagogik, die traditionelle Schule, die Kritik am Bildungssystem, die Pädagogik vom Kinde aus, Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit, neue Unterrichtsformen, die Entwicklung der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin, die wilhelminische Epoche, die Weimarer Republik, die Industrialisierung, die Französische Revolution und die gesellschaftlichen Umbrüche des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Reformpädagogik?
Das Hauptziel war die Umgestaltung der Schule hin zu einer „Pädagogik vom Kinde aus“, die Selbsttätigkeit, Individualität und die Bedürfnisse des Kindes ins Zentrum stellt.
Wann war die Blütezeit der reformpädagogischen Bewegung?
Die Bewegung hatte ihren Höhepunkt etwa zwischen 1890 und 1930, geprägt durch gesellschaftliche Umbrüche in der wilhelminischen Epoche und der Weimarer Republik.
Was kritisierte die Reformpädagogik an der traditionellen Schule?
Kritisiert wurden vor allem autoritäre Strukturen, bloße Wissensvermittlung ohne Praxisbezug („Paukschule“) und die mangelnde Berücksichtigung der kindlichen Lebenswelt.
Wer war Peter Petersen und was ist der Jena-Plan?
Peter Petersen war ein bedeutender Reformpädagoge, der den Jena-Plan entwickelte – ein Schulkonzept, das auf jahrgangsübergreifenden Gruppen, Rhythmisierung des Schullebens und Gemeinschaftserziehung basiert.
Welche Rolle spielt die Selbsttätigkeit des Kindes?
Selbsttätigkeit bedeutet, dass das Kind durch eigenes Handeln und Experimentieren lernt, anstatt nur passiv Wissen aufzunehmen, was als Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung gilt.
Wie beeinflusste die Industrialisierung die Pädagogik?
Die Industrialisierung schuf neue Anforderungen an die Bildung und führte gleichzeitig zu einer Sehnsucht nach natürlicheren Lebens- und Lernformen, was die Reformbewegungen befeuerte.
- Arbeit zitieren
- Sonderpädagogin Anne Graefen (Autor:in), 2005, Reformpädagogik allgemein (1890 - 1930) und Peter Petersen mit seinem Jena-Plan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278334