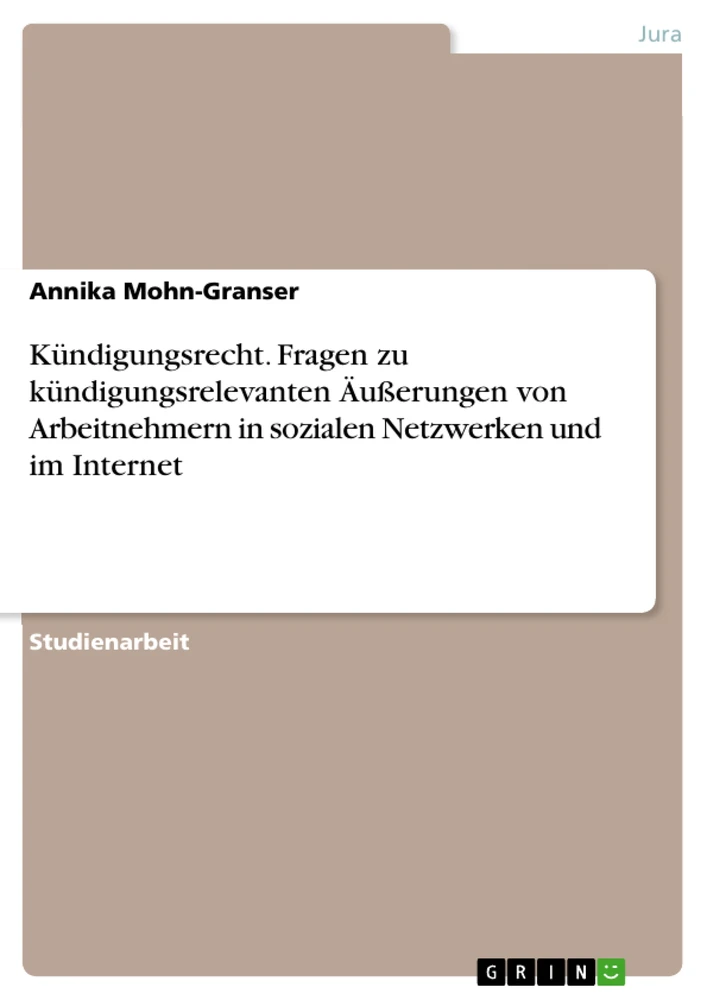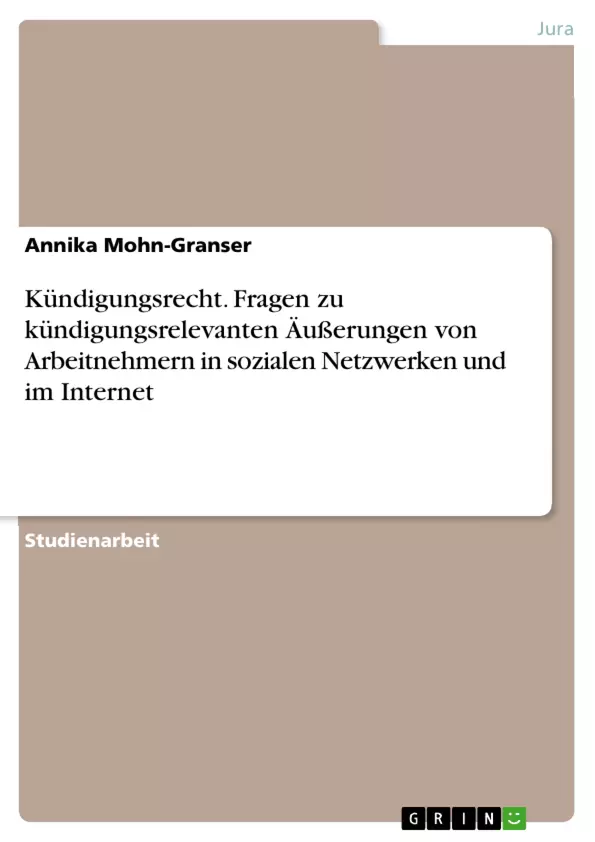Art. 5 Abs. 1 GG hat jeder Mensch das Recht, seine Meinung wörtlich, schriftlich oder durch Bilder frei zu äußern und zu verbreiten. Dieses Grundrecht findet jedoch seine Schranken, wenn die Menschenwürde nach Art.1 Abs. 1 GG, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art.2 Abs. 1 GG, die persönliche Ehre nach Art. 5 Abs. 2 GG und die Berufsfreiheit im Sinne der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers nach Art. 12 GG betroffen sind . Der Schutz des Arbeitgebers hat jedoch Vorrang vor der Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers, falls es sich um Beleidigungen und Schmähkritik handelt oder die Menschenwürde angegriffen wird. Selbst wahren Tatsachenbehauptungen des Arbeitnehmers sind Schranken gesetzt, wenn die Intim-, Sozial- oder Privatsphäre des Betroffenen verletzt wird und können als Formalbeleidigung strafrechtlich verfolgt werden (§ 192 StGB) . Die Grenzen bei der Feststellung, ob eine Äußerung in die Intim-, Sozial- oder Privatsphäre eingreift, sind fließend. Die Intimsphäre ist ausnahmslos geschützt, wie z.B. die Veröffentlichung von Nacktfotos. Eine wahre Äußerung, die in die Sozialphäre eingreift, wie z.B. in die berufliche Stellung, ist nur zulässig, wenn sie nicht der persönlichen Kränkung oder Stigmatisierung dient. Die Abwägung, ob eine Äußerung in die Privatsphäre des Betroffenen eingreift, fällt am schwierigsten bei der Abwägung, ob die Äußerung aus persönlichen Gründen erfolgte oder gesellschaftlich/politisch motiviert war.
In Abgrenzung zu Äußerungen des Arbeitnehmers mit beleidigendem Charakter, wird die sachliche Kritik gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Vorgesetzten durch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung gedeckt, sofern die oben genannten Schranken....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung und Problemstellung
- Zielsetzung
- Gang der Arbeit
- Meinungsäußerungsfreiheit des Arbeitnehmers
- Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit
- Kündigungsrechtliche Bedeutung von Äußerungen des Arbeitnehmers
- Zeitpunkt der Äußerung
- Zugänglichkeit der Äußerung
- Zuordnung von Äußerungen zu einem Arbeitnehmer
- Beweisverwertung
- Schlussbetrachtung
- Kritische Auseinandersetzung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der rechtlichen Problematik von Äußerungen von Arbeitnehmern im Internet, die potenziell zu Kündigungen führen können. Der Fokus liegt dabei auf der Abgrenzung der Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers zu den Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber im Kontext sozialer Medien. Die Arbeit untersucht die Faktoren, die bei der Bewertung von Äußerungen als Kündigungsgrund relevant sind, und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die bestehende Rechtsprechung zu diesem Thema. Dabei werden insbesondere die Aspekte der Beweisverwertung und des Persönlichkeitsschutzes des Arbeitnehmers beleuchtet.
- Die Bedeutung der Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis
- Die kündigungsrechtliche Relevanz von Äußerungen im Internet
- Die Abgrenzung von Meinungsfreiheit und Loyalitätspflichten
- Die Bedeutung von Faktoren wie Zeitpunkt, Zugänglichkeit und Zuordnung von Äußerungen
- Die Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes des Arbeitnehmers bei der Beweisverwertung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problematik von Äußerungen im Internet im Kontext des Arbeitsrechts vor und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen für die Meinungsäußerungsfreiheit des Arbeitnehmers im Kontext des Grundgesetzes beleuchtet. Es wird insbesondere auf die Schranken der Meinungsfreiheit, wie z.B. die Schutzwürdigkeit der Persönlichkeitsrechte des Arbeitgebers, eingegangen.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel behandelt die kündigungsrechtlichen Aspekte von Äußerungen des Arbeitnehmers im Internet. Es werden verschiedene Faktoren, wie z.B. Zeitpunkt, Zugänglichkeit und Zuordnung der Äußerungen, sowie die Beweisverwertung im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmers, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Meinungsfreiheit, Kündigungsrecht, Äußerungen im Internet, soziale Medien, Loyalitätspflichten, Persönlichkeitsschutz, Beweisverwertung, Rechtsprechung, und unternehmensspezifische Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt dabei auf der Abgrenzung der Meinungsfreiheit von den Pflichten des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber im digitalen Kontext. Die Arbeit veranschaulicht anhand von Beispielen und Rechtsprechung die kündigungsrechtliche Relevanz von Äußerungen im Internet und bietet Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen.
Häufig gestellte Fragen zu Kündigungen wegen Internet-Äußerungen
Darf ein Arbeitgeber kündigen, wenn ein Mitarbeiter ihn im Internet beleidigt?
Ja, grobe Beleidigungen und Schmähkritik verletzen die Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers und können eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen, da sie den Betriebsfrieden stören.
Wo liegen die Grenzen der Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis?
Die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) endet dort, wo die persönliche Ehre, die Menschenwürde oder die wirtschaftliche Existenz des Arbeitgebers durch unwahre Tatsachenbehauptungen oder Beleidigungen geschädigt wird.
Spielt die Zugänglichkeit eines Posts (z. B. privat vs. öffentlich) eine Rolle?
Ja, Äußerungen in einem geschlossenen, privaten Kreis werden rechtlich oft anders bewertet als öffentliche Posts, da bei letzteren der potenzielle Schaden für den Arbeitgeber größer ist.
Sind wahre Tatsachenbehauptungen immer erlaubt?
Nicht zwingend. Wenn wahre Behauptungen nur der Stigmatisierung des Arbeitgebers dienen oder die Intimsphäre verletzen, können sie dennoch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
Was versteht man unter der Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers?
Arbeitnehmer sind verpflichtet, auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen und dessen Ruf nicht mutwillig zu schädigen.
- Quote paper
- Annika Mohn-Granser (Author), 2014, Kündigungsrecht. Fragen zu kündigungsrelevanten Äußerungen von Arbeitnehmern in sozialen Netzwerken und im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278401